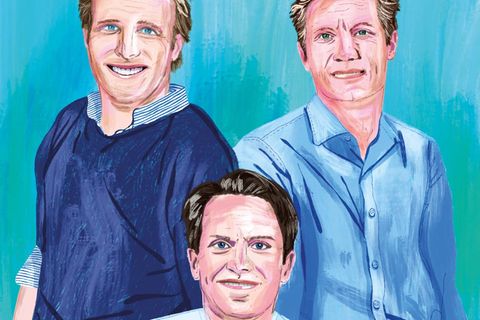Martin Kaelble ist Capital-Redakteur und schreibt an dieser Stelle über Digitalisierung, Start-ups und die neue Wirtschaft.
Als die Digitalisierung noch ganz am Anfang stand, Ende der 90er-Jahre, und die ersten Startups entstanden, wurden sie belächelt. Es stellte sich die Frage: Haben die Kleinen überhaupt eine Chance gegen die großen, etablierten Player?
Heute muss man die Frage so langsam umformulieren. Tatsächlich fragt man sich vielerorts: Haben die großen Konzerne überhaupt eine Chance gegen die vielen Startups.
Ein bisschen ist es so, wie wenn Tanker gegen Schnellboote in einer Regatta antreten. Der Tanker hat viel mehr PS, ist groß und mächtig, aber die kleinen Schiffe sind eben wendiger. Bis ein Tanker den Kurs geändert hat, hat das Schnellboot schon längst drei Haken geschlagen.
In Zeiten der Digitalisierung kann Wendigkeit wichtiger sein als PS.
Das Konzern-Dilemma
Es ist Mode über die großen Konzerne zu schimpfen und die kleinen Start-ups zu überhöhen. Doch kann man allen Konzernen einen Vorwurf machen? Es ist ja nicht so, dass sie nicht sehen, was passiert.
Klar, manche glauben, dass eine App als Digitalstrategie reicht. Doch es gibt auch viele smarte Strategen in den Chefetagen. Und die stecken mitunter in einem verflixten Dilemma: Wann ist der richtige Zeitpunkt um einen Geschäftsbereich zu killen, der heute noch gutes Geld bringt, morgen aber erkennbar nicht mehr? Wann setzt man mit Vollgas auf ein Zukunftsfeld, das auf absehbare Zeit nur Kosten bringt? Und das in einer Organisationsstruktur, in der Risikobereitschaft nicht incentiviert wird. Sondern nur Kostenkontrolle.
Keine einfache Entscheidung, unter Druck, in einem Markt im Abwärtssog. Viele Firmen stecken in diesem Dilemma, mitten im Rückzugsgefecht: Medienkonzerne ebenso wie Energiekonzerne, Werbeagenturen ebenso wie Banken.
Geglückte Strategiewechsel
Es lassen sich Beispiele finden, für radikale Strategiewechsel, für geglückte Neuerfindungen zum richtigen Zeitpunkt. IBM war so ein Beispiel, Fuji ebenso. Oder der einstige Gummistiefelhersteller Nokia (die haben dann allerdings später wieder daneben gelegen). Vielleicht wird Eon mit seinem radikalen Move so etwas geglückt sein. Ebenso Philips, die sich von ihrer Lichtsparte getrennt haben, die Philips eins seine Identität gab.
Doch all dies sind harte, mutige, radikale Entscheidungen. Und deshalb eher die Ausnahme.
Ein Mittelmanager im Konzern kann nicht zu seinem Chef gehen und sagen: Lass uns in ein neues Produkt investieren, es wird zwei Jahre Geld verbrennen und ich kann Dir nicht garantieren, dass es jemals Geld verdienen wird.
Konzerne haben viel zu verlieren - laufende Geschäftsfelder, große Rechtsurteile, ihr Image. Abteilungsleiter ebenso, nämlich ihren Job, wenn Sie auf ein neues, riskantes Produkt setzen.
Startups hingegen haben nichts zu verlieren.
Der Vorteil der Kleinen
Genau das ist der entscheidende Vorteil der Kleinen gegenüber den Großen. Sie sitzen den Konzernen im Nacken, fordern sie heraus wie ein großmäuliger Boxer den etablierten Champion. Sie können per Definition Neues ausprobieren, Geld verbrennen, ohne zu wissen, ob es am Ende funktioniert. Venture Capital sei Dank. Gegen diese Stärke sind die Großen machtlos.
Hinzu kommt die Flexibilität und Schnelligkeit der Kleinen. Viele Konzerne sind weit entfernt davon. Sie bremsen sich selbst, durch Konzernmühlen und Grabenkämpfe. Viele Manager verbringen mehr Zeit damit, sich abzusichern und politische Spielchen zu pflegen als das Produkt voranzubringen. Ihre größte Kompetenz besteht manchmal darin, die eigene Inkompetenz zu kaschieren. Das lernt man schnell in einem Großkonzern. So versickern Ideen in den Lehmschichten des mittleren Managements. Neue Ansätze werden zerfressen von Fehlern, rechtlichen Bedenken und bürokratischen Prozessen.
Dabei haben die Herausforderer aus den Fabriketagen oft genug auch nicht die Weisheit gefressen. Auch wenn sie gerne so tun. Doch der entscheidende Unterschied ist: Ihre kleinen Fehler, von denen sie mit Sicherheit viel mehr machen als die Konzerne, fallen weniger ins Gewicht. Sie sind vielmehr erlaubt. Sie können davon einige machen und kommen trotzdem voran.
Die Konzerne machen dagegen einen großen Fehler: Nämlich dass sie sich nicht erlauben, kleine Fehler zu machen. Und dadurch verharren sie in einer gefährlichen Kultur. Im Zweifel lieber so wie bisher, als etwas Neues zu wagen.
Haben die Großen eine Chance?
Können die etablierten Großen also in Zeiten des Umbruchs überhaupt gegen die kleinen, wendigen Start-ups bestehen?
Die Antwort lautet: ja. Wenn der Tanker seine Größe richtig einsetzt. Der Vorteil gegenüber den Start-ups: Die Großen haben das Know-how. Sie haben die Synergien. Sie haben mehr Erfahrung. Und sie haben das Geld. Das können sie im Zweifel dazu einsetzen, sich das Neue einzuverleiben. Indem sie Start-ups kaufen. Aber das müssen sie rechtzeitig tun. Sie können die Impulse der Start-ups aufnehmen und sich von innen heraus erneuern. Dafür müssen sie Strukturen für den konstanten Wandel schaffen.
Sie können sich einiges abschauen. Doch am Ende können und sollen die Konzerne natürlich keine Start-ups werden. Und vielleicht ist das letztlich Teil der wirtschaftlichen Evolution. Altes stirbt irgendwann, Neues wächst nach. Auch in der Wirtschaft. Ein Prozess, den man einfach akzeptieren muss. Wir werden uns daran gewöhnen, dass einige der großen Tanker einfach verschwinden werden. Und einige Start-ups stattdessen zu Konzernen werden. Bis dann eines Tages sie die Großen sind. Und wieder von neuen kleinen Herausforderern geärgert werden.
Weitere Kolumnen von Martin Kaelble: Sorgt die Digitalisierung für mehr Ungleichheit? und Wo bleibt das deutsche Tesla?
Newsletter: „Capital- Die Woche“
Jeden Freitag lassen wir in unserem Newsletter „Capital – Die Woche“ für Sie die letzten sieben Tage aus Capital-Sicht Revue passieren. Sie finden in unserem Newsletter ausgewählte Kolumnen, Geldanlagetipps und Artikel von unserer Webseite, die wir für Sie zusammenstellen. „Capital – Die Woche“ können Sie hier bestellen: