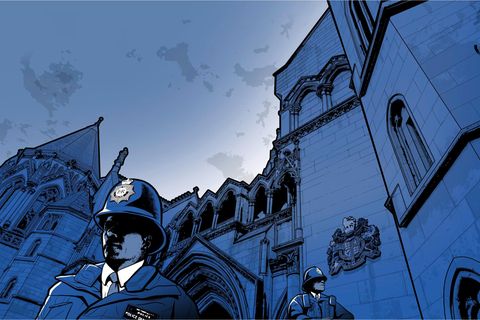Iran oder Russland, Kuba oder Nordkorea - Sanktionen waren schon immer ein willkommenes Kriegsinstrument, wirtschaftlich und politisch. In den Beziehungen zwischen dem Westen und Russland gehören Sanktionen seit Putins Krim-Annexion 2014 praktisch zum Alltag. Seitdem hat Russland der Welt immer wieder neue Gründe geliefert, die Sanktionen nicht nur beizubehalten, sondern sogar auszubauen. Von der opportunistischen Einmischung im Nahen Osten, über die Beeinflussung der Präsidentschaftswahlen in den USA, bis hin zum Giftgasanschlag auf den Ex-Geheimagenten Sergej Skripal und dessen Tochter Julia. Um nur einige Beispiele zu nennen.
Die Kritik an den Sanktionen hält sich in Grenzen. Einige wenige Gegenstimmen kommen vor allem aus Europa, überwiegend aus Deutschland . Dutzende andere Staaten haben eine klare und kompromisslose Haltung. Sie haben ihre Zusammenarbeit mit Russland massiv zurückgefahren und deutlich gemacht: Internationale Finanzpolitik, Energiepolitik und Rüstungspolitik funktionieren auch ohne Russland als Partner. Wenn es sein muss, auch dauerhaft. Anzeichen für eine drastische Kursänderung gibt es jedenfalls nicht.
Warum? Weil viele der unsichtbaren Sanktionen erst langsam ihre Wirkung entfalten und damit eine langfristige Bedrohung für die noch immer sowjetisch geprägte Wirtschaft - und für Putin persönlich - darstellen. Kurzfristig betrachtet - sagen wir über die nächsten sechs Jahre – werden die Sanktionen dem “System Putin” weiterhin als lästig und störend erscheinen. Gleichzeitig stellen sie keine ernsthafte Bedrohung für sein Machtgefüge dar.
Russlands Präsident Wladimir Putin hat von Anfang an mit langfristigen Sanktionen gerechnet. Bei einem Treffen in Moskau 2015 soll Putin den damaligen Minister für wirtschaftliche Entwicklungsarbeit, Alexej Uljukajew, korrigiert haben, als dieser Sanktionen bis Ende 2018 voraussagte. Das bestätigen Menschen, die bei dem Treffen dabei waren. Putin selbst sprach damals davon, dass 2028 die realistischere Jahreszahl sei. Uljukajew sitzt heute im Gefängnis .
Putin spielt auf Zeit
Putins Einschätzung macht deutlich, dass der Kreml kein ernsthaftes Interesse daran zu haben schien, weiteren Sanktionen aus dem Weg zu gehen. Mehr noch: Der Kreml hat zu keinem Zeitpunkt eine Strategie entwickelt, um die Auswirkungen der Sanktionen auf die russische Wirtschaft und die Bevölkerung in irgendeiner Form abzufedern. Stattdessen müht sich eine Ad-hoc-Gruppe von Finanz- und Wirtschaftsexperten aus Putins engstem Zirkel nach jedem neuen Schlag ab, den sofortigen Niedergang der russischen Wirtschaft irgendwie zu verhindern.
Die langfristigen Auswirkungen auf die russische Wirtschaft sind dramatisch. Die Verschlechterung nahezu aller relevanten Wirtschaftsfelder, die künstlich von dem Mantel der internationalen Bedrohungen verdeckt werden, ist die eigentliche Gefahr. Eine Gefahr, die der kurzfristig denkende Taktiker Putin anscheinend ignoriert.
Umfragen und das Ergebnis der letzten Präsidentschaftswahl bestätigen Putin in dessen Kurs. Die Mehrheit der in Russland lebenden Menschen scheint mit ihren Verhältnissen zufrieden zu sein. Die Tatsache, dass das reale Einkommen der meisten Menschen seit 2014 langsam geschrumpft ist, bereitet Putin keine großen Sorgen . Schließlich hatte das nicht die geringsten Auswirkungen auf die politische Landschaft. Aus seiner Sicht werden die Menschen auch weiterhin loyal bleiben und “ihren Präsidenten” unterstützen.
Also wartet Putin. Er weiß von Angela Merkels Abneigung gegenüber Donald Trump. Und er weiß auch um ihre Abhängigkeit von russischer Energie. Er hofft darauf von der gegenwärtigen Stimmung zu profitieren und spekuliert auf eine Schwächung des internationalen Sanktionsregimes. Die Sanktionen gegen seine Oligarchen-Freunde sind für Putin nichts weiter als kleine Nadelstiche. Auswirkungen auf sein engstes Umfeld haben sie nicht. Der Sturz eines einzelnen Oligarchen ist für ihn keine Gefahr und führt stattdessen zu einer Umverteilung des Reichtums innerhalb eines - nun noch kleineren - Zirkels von Landsleuten.
Wenn es gegen die Banken geht, wird es gefährlich
Beispiel “RUSAL”: Als der russische Aluminium-Riese zusammen mit seinem Großaktionär Oleg Deripaska im April auf der Sanktionsliste der USA auftauchte, zeigte sich die russische Regierung nicht sonderlich besorgt. Und das, obwohl Werksschließungen drohten und hunderttausende Arbeitsplätze in Gefahr waren. All das reichte scheinbar nicht aus, um Putins strategische Pläne zu durchkreuzen. Und als das US-Finanzministerium vor kurzem verkündete, dass die Sanktionen vielleicht sogar ganz aufgehoben werden – unter der Voraussetzung, dass Deripaska die Kontrolle über das Unternehmen abgibt – wurde klar, dass Putins Regime selbst nichts zu befürchten hat .
Gedankenspiel: Wenn aber RUSAL-ähnliche Sanktionen gegen Russlands größte, staatlich-kontrollierte Banken eintreten würden, dann könnte die Welt dramatische, fast schon brutale Folgen beobachten. Ein solcher Schritt würde eine sich schnell entwickelnde Finanzkrise provozieren, zu einem Fall des Rubel-Kurses führen, Banken zusammenbrechen lassen. Die Ersparnisse der einfachen Menschen in Russland wären weg, eine lange Phase wirtschaftlicher Instabilität wäre die Folge. Der Rückhalt der Bevölkerung, den Putin derzeit als zufriedenstellend beurteilt, könnte kippen.
Sanktionen gegen staatlich-kontrollierte Banken sind gar nicht so unwahrscheinlich, wie viele denken. Grund: Die Geschäfte dieser Banken konzentrieren sich weitgehend auf Russland. Die möglichen Sanktionen würden also mit ziemlicher Sicherheit keinen globalen Finanzschock verursachen, da der russische Bankensektor - anders als der Energiesektor - klein und schlecht in das internationale Bankensystem integriert ist.
Wahrscheinlicher ist eine Krise innerhalb Russlands. Eine Krise mit unbestimmtem Ausgang. Beispielsweise könnten “Silowiki” an Macht gewinnen. Eine Fraktion von sicherheitsorientierten Politikern und Militärs, die Russland als “belagerte Festung” betrachten, die nur isoliert überleben kann.
Moskau bleibt unberechenbar
Wenn die Sanktionen des Westens - wie ein möglicher Angriff auf die großen Banken - sich ernsthaft auf die Innenpolitik Russlands auswirken, könnten sich die “Silowiki” für reaktionäre Gegensanktionen einsetzen. So könnten die Vermögenswerte westlicher Unternehmen in Russland beschlagnahmt werden, was wiederum zu noch schärferen Sanktionen des Westens führen könnte. Eine Teufelsspirale. Eine solche Spirale von Sanktionen und Gegensanktionen könnte den “Silowiki”-Instinkt aller Russen wecken und das Land in einen neuen Isolationismus des 21. Jahrhunderts führen. Das wäre ein völlig neues globales politisches Phänomen mit unvorhersehbaren Folgen - bis auf eine: Eine solche Bewegung würde mit ziemlicher Sicherheit Putins Regime zu einem seiner ersten Opfer machen.
Was sind also die Möglichkeiten? Weder die europäischen Bündnispartner, noch die USA - ganz gleich wie zerstritten sie auch sein mögen - können ein Interesse daran haben, ein solches Chaos in Russland zu provozieren. Ein direkter Angriff auf die staatseigenen Banken ist daher unwahrscheinlich.
Wenn der Westen dagegen an seinen langfristigen Sanktionen gegen Russland festhält und Putin seinen Kurs nicht ändert, dann wird die russische Wirtschaft in einer totalen Katastrophe enden. Für den Westen wäre die Durchführung strategischer und wirtschaftlicher Geschäfte mit Russland eine Gefahr, weil jederzeit ein wirtschaftlicher Zusammenbruch möglich wäre.
Sanktionen sind nichts anderes als stumpfsinnige Instrumente der Außenpolitik. Es sei denn, man setzt sie präzise ein, um bestimmte Wirtschaftsfelder anzuvisieren. Eine korrekte Analyse und Voraussage der Auswirkungen von Sanktionen - spezifisch und allgemein - erfordert große Sorgfalt und einen starken politischen Willen. Kluge Köpfe aus Politik und Wirtschaft werden gefordert sein, Strukturen im Bereich Risiko-Management aufzubauen, um auf verschiedene Eventualitäten vorbereitet zu sein. Am Ende des Tages bleibt Russland unberechenbar.