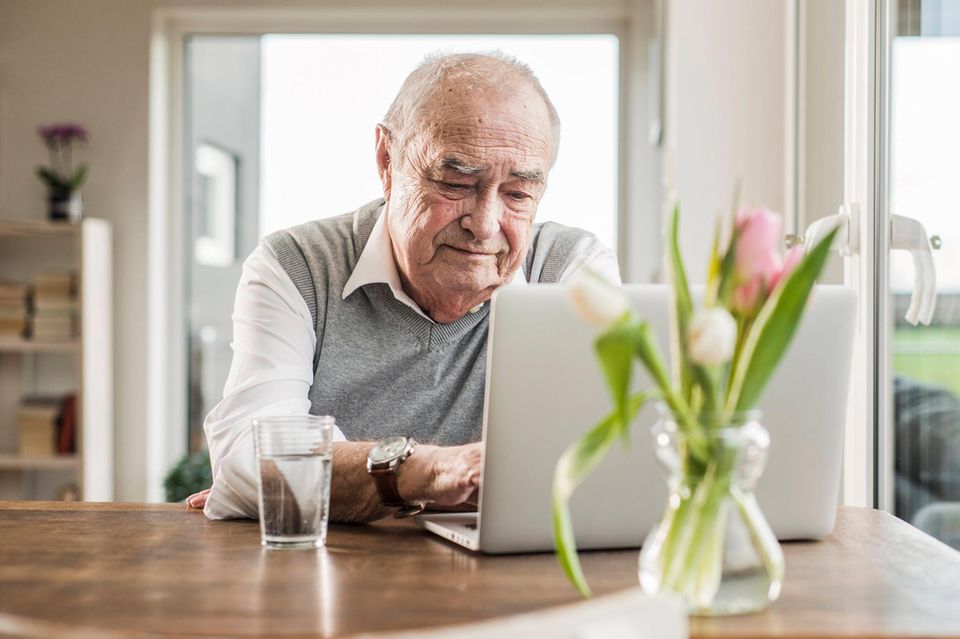Die Corona-Krise zwingt die Zentralbanken zum Handeln. Die US-Notenbank Fed hat in den vergangenen zwei Wochen gleich zweimal die Leitzinsen in den Vereinigten Staaten gesenkt. Die Europäische Zentralbank (EZB) hat erst ein großes und dann ein noch größeres Anleihekaufprogramm angekündigt. Untätigkeit kann man den Notenbankern kaum vorwerfen – trotzdem wachsen die Sorgen vor einer massiven globalen Rezession und weiteren Kursstürzen an den Börsen. Zahlreiche Ökonomen, Analysten und Fondsmanager sagen: Die Geldpolitik kommt in der Corona-Pandemie an ihre Grenzen. Um Anleger zu beruhigen und die Wirtschaft zu stützen, seien drastische fiskalpolitische Schritte nötig.
Unter dem Schlagwort Fiskalpolitik werden sämtliche Instrumente zusammengefasst, mit denen ein Staat über die Veränderung der öffentlichen Einnahmen und Ausgaben die Konjunktur lenken und konjunkturelle Schwankungen ausgleichen kann. Meist zielen fiskalpolitische Schritte darauf ab, die gesamtwirtschaftliche Nachfrage zu beeinflussen, nach oben oder nach unten.
Die Politik ist am Zug
Derzeit stehen viele Staaten vor der Herausforderung, die Nachfrage trotz der teils drastischen Einschränkungen des gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Lebens zu stützen. Gleichzeitig müssen Regierungen auch der Angebotsseite unter die Arme greifen, also Unternehmen und Unternehmern helfen, die ihr Geschäft wegen der Corona-Krise nicht mehr oder nur noch sehr eingeschränkt fortführen können.
Die Notenbanken können mit niedrigen Zinsen die Grundlage dafür schaffen, dass es sich Regierungen leisten können, höhere Schulden zu machen, um die Wirtschaft anzukurbeln. Die Fed hat diesen Weg bereits beschritten. Die EZB sieht bisher von Zinssenkungen in den negativen Bereich ab, hat aber ein Pandemie-Notkaufprogramm mit einem Volumen von 750 Mrd. Euro angekündigt . Damit haben die Notenbanken den Ball ins Feld der Politiker gespielt. Diese haben ihn aufgenommen: Die Regierungschefs der G7-Länder haben jüngst erklärt, „alles Notwendige“ zu tun, um die Weltwirtschaft zu stützen.
Die Amerikaner brauchen jetzt Cash. Und der Präsident will ihnen Cash geben
US-Finanzminister Steven Mnuchin
Welche fiskalischen Schritte es geben wird und welche die größte Wirkung entfalten, wird sich in den kommenden Wochen und Monaten zeigen. Die USA arbeiten derzeit an einer Krankengeld-Regelung für Unternehmen, leisten Finanzhilfe für besonders stark von der Krise betroffene Branchen wie die Hotellerie und denken über Wege nach, Einzelpersonen rascher finanzielle Unterstützung zukommen zu lassen. In Deutschland hat die Regierung betroffenen Unternehmen Kredite in unbegrenzter Höhe zugesagt. Für Solo-Selbständige soll es voraussichtlich eine Art Notfallfonds geben.
Die Vereinigte Staaten und Europa sollten „ohne mit der Wimper zu zucken“ jeweils rund eine Billion US-Dollar ausgeben , um die Krise abzumildern, fordert der Starökonom Kenneth Rogoff. Im Rahmen fiskalpolitischer Hilfen drücken Regierungen ihren Bürgern am besten direkt Schecks in die Hand, sagt er. Sie sollten also sogenanntes Helikoptergeld verteilen . Die USA wollen Berichten zufolge diesen unorthodoxen Schritt tatsächlich tun: „Die Amerikaner brauchen jetzt Cash. Und der Präsident will ihnen Cash geben“, erklärte US-Finanzminister Steven Mnuchin kürzlich auf einer Pressekonferenz. Jeder US-Bürger soll angeblich bald von der Regierung einen Scheck über mindestens 1000 Dollar zugeschickt bekommen.
Diese direkteste aller Finanzhilfen wäre in der aktuellen Krise eine gute Idee, glauben viele Wirtschaftsexperten. „Sollte sich die Situation erheblich verschlechtern, könnte dies der Zeitpunkt sein, ein zeitlich begrenztes universelles Grundeinkommensprogramm aufzulegen“, sagt etwa Sonal Desai, Analystin der Investmentgesellschaft Franklin Templeton. Ein solches Programm würde Arbeitnehmern in besonders prekären Branchen Einkommenssicherheit bieten und könnte als Brücke zu einer Normalisierung der Wirtschaft fungieren.
Kennen Sie schon unseren Newsletter „Die Woche“ ? Jeden Freitag in ihrem Postfach – wenn Sie wollen. Hier können Sie sich anmelden