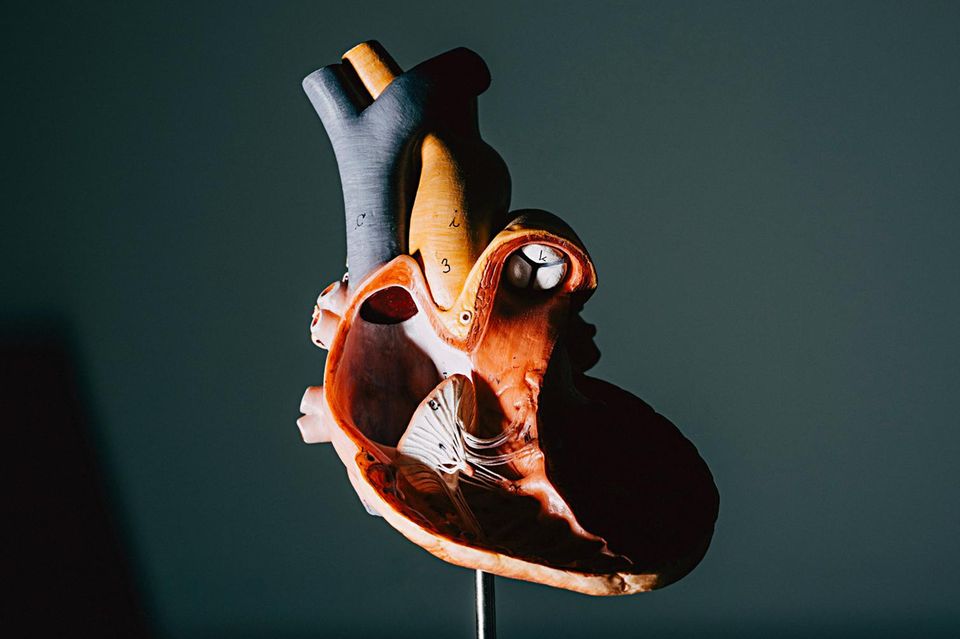Capital: Frau Erb-Herrmann, Herzinfarkte von Frauen werden zu spät diagnostiziert, sie werden falsch medikamentiert, viele Erkrankungen werden nicht entdeckt oder als Depression abgetan. Haben wir eine Macho-Medizin?
ISABELLA ERB-HERRMANN: Wir haben eine Medizin, die immer noch auf Jahrtausende alten Glaubensprinzipien basiert. Vor 2500 Jahren erklärte Aristoteles den männlichen Körper zum Standard und Frauen zur „verunglückten“ Abweichung von dieser Norm – eine Perspektive, die sich im Wissen und Praktiken über Jahrhunderten gehalten hat. Bisher werden die meisten Medikamente immer noch an Männern mit 80 Kilogramm getestet. Diese einseitige Ausrichtung war und ist fatal für die Gesundheit der Frauen.
Welche Folgen hat das?
Frauen leiden erheblich unter Falschdosierung und der unzureichenden Berücksichtigung ihres Stoffwechsels und Hormonhaushalts. Sie erleiden viel öfter als Männer Nebenwirkungen bei Medikamenten. Hinzukommt, dass die Packungen systematisch zu groß sind und ein Teil am Ende im Müll landet. Für die Krankenkassen und damit auch die Versicherten führt das zu hohen Kosten und ist auch nicht nachhaltig.
Klinische Studien wurden jahrzehntelang fast nur mit Männern gemacht. Hat sich das denn inzwischen geändert?
In der EU müssen Arzneimittelhersteller klinische Studien seit dem 31. Januar 2022 mit einer repräsentativen Geschlechter- und Altersverteilung durchführen. Eine solche Vorgehensweise kann künftig in eine sichere und gleichberechtigte Arzneimittelversorgung münden. Allerdings dauert es von der klinischen Forschung bis zur Markteinführung eines Medikaments einige Jahre. Daher wird sich die Regelung wohl erst frühestens in fünf Jahren wirklich auswirken am Markt. Übrigens fängt die Dysbalance bereits davor an: Auch in den Tiermodellen vorklinischer Studien werden männliche Tiere bevorzugt eingesetzt. Natürlich reagieren auch hier die Geschlechter unterschiedlich auf Wirkstoffe. Und in dem Bereich wurde meines Wissens noch keine geschlechteradjustierte Regelung getroffen.
Schwangerschaft, Endometriose und Wechseljahre werden aktuell sehr stigmatisiert in der Forschung. Wie lässt sich das ändern?
Pharmahersteller orientieren sich bei der Entwicklung und den Investitionen in neue Medikamente und Therapien am „medizinischem Zusatznutzen“. Dieser ist Voraussetzung für eine Zulassung. Um diesen Zusatznutzen zu bewerten, braucht man Daten. Diese sind für Forschungsgebiete wie Endometriose und Wechseljahresbeschwerden jedoch noch nicht vorhanden, da Frauen das traditionell „lautlos“ ertragen haben und es dazu fast keine Statistiken gibt. Erst wenn wir mehr Daten haben, wird sich wohl auch etwas in der Pharmaforschung dazu tun. Wichtig ist, dass wir diese Lücken jetzt schließen, denn sonst wird der Nachteil für Frauen in der Gesundheitsversorgung noch größer, da Algorithmen und KI in der Gesundheitsversorgung eine zunehmend größere Rolle spielen. Und die stützen ihre Ergebnisse auf vorhandene Daten. Auch die Politik muss das Thema stärker aufgreifen und Frauengesundheit als „Investition in die Gesellschaft“ begreifen. Frankreich hat beispielsweise eine nationale Endometriose-Strategie.
Wie können Sie als große Krankenkasse da Verbesserungen erzielen und Anreize setzen?
Als Krankenkassen können wir vor allem aufklären. Wir als AOK planen zum Beispiel gerade eine Aktionskampagne zur Frauengesundheit im kommenden Jahr. Die Themen gewinnen an Bedeutung, die Frauen werden sichtbarer, da sie sich vernetzen und politisch aktiv sind. Es gibt die Spitzenfrauen Gesundheit, die Healthcare Frauen, aber auch den Deutsche Ärztinnenbund und den Hebammenverband.