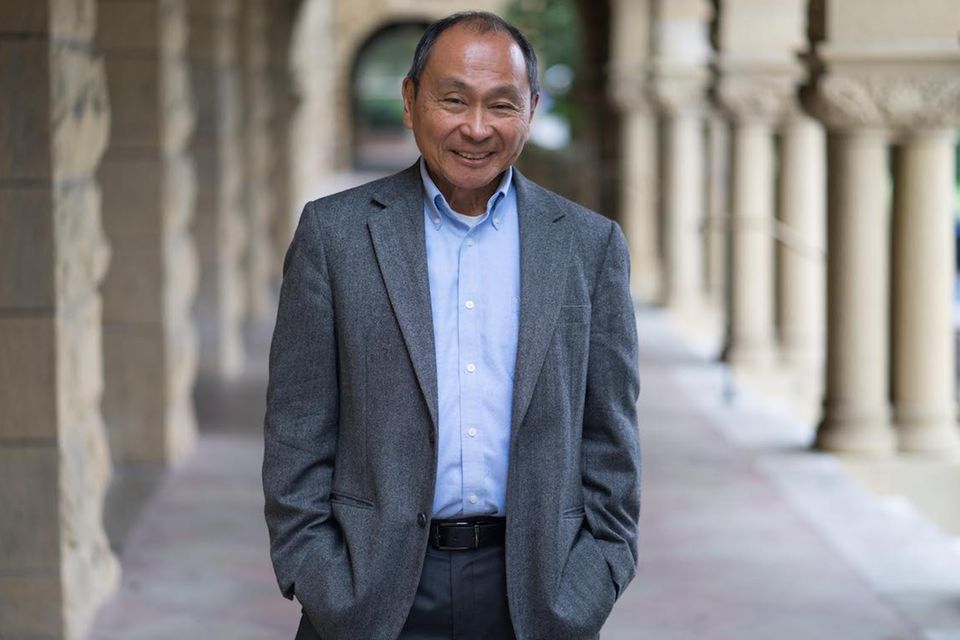Vor zwei Jahren veröffentlichte der Volkswirt und Historiker Adam Tooze mit „Crashed“ eine viel beachtete Analyse über die Folgen der Finanzkrise 2008. Nach seinem Studium in Cambridge und Berlin blieb der Brite Deutschland eng verbunden und gehörte unter anderem einer Historikerkommission an, die die Rolle des damaligen Reichsfinanzministeriums im NS-Regime untersuchte. Er lehrt heute an der Columbia-Universität in New York.
Herr Tooze, Deutschland gilt zwar auch in dieser Krise als Musterschüler, aber wie sehr greift der Corona-Schock die Basis unseres Wohlstands an?
ADAM TOOZE: Das Einzigartige an dem, was wir erleben, ist die Gleichzeitigkeit. Der simultane Einbruch des Konsums, der Investitionen und der Arbeitstätigkeit. Allein die Zahlen der Internationalen Arbeitsorganisation ILO: 2,7 Milliarden Arbeitskräfte weltweit waren vom Lockdown betroffen. Gleichzeitig! Das ist irrwirtzig. Auf den französischen, spanischen und italienischen Arbeitsmärkten wartet ein Desaster auf uns – wohl auch in Deutschland. Wir wissen nicht, wie man eine Erholung aus so einem Schock bewerkstelligt.
Man sagt, China mache es vor.
Ich verfolge die Nachrichten aus China mit sehr, sehr großer Aufmerksamkeit, weil man dort sieht, wie schwierig es ist. Die letzten Zahlen deuten ja darauf hin, dass die Erholung sich eher schwertut. Dass China erneut – wie 2008 – ein gigantisches Konjunkturprogramm startet und quasi den Rest der Welt aus der Rezession reißt, können wir diesmal nicht erwarten.
Also können wir uns auch nicht auf die gängigen Prognosen verlassen?
Wir haben in den letzten Jahren viel über radikale Unsicherheit geredet. Aber wenn wir ehrlich sind, hatten wir keine Ahnung, was das wirklich bedeutet. Es braucht ja nur eine zweite Welle der Infektion, oder einen Rückschlag bei der medizinischen Entwicklung – und wir wären dann mit sehr harten Fragen konfrontiert.
Was können, was müssen wir dann dagegen aufbieten?
Deutschland hat bereits viel auf den Weg gebracht, aber es wäre gut, wenn auch Europa ein offenes Portemonnaie hätte und sagen könnte: Okay, das war die erste Runde der Krise, aber wenn es mehr Geld braucht, dann bringen wir auch noch mehr.
Der Staat als Arbeitgeber letzter Instanz, als Zahler letzter Instanz
Adam Tooze
Das, was die Europäer bisher beschlossen haben, reicht nicht?
Das Paket, das jetzt auf dem Tisch liegt, ist ein schlechter Kompromiss für die erste Runde, der mit Ächzen und Krächzen zustande gekommen ist, aber einfach nicht reichen wird. Diese Krise geht über mehrere Runden. Wir wissen, nach der Krise 2008 war es ein großer Fehler, dass es nur in der ersten Runde der Krise ein Konjunkturpaket gab. 2010 wurde dann dichtgemacht. Jetzt ist es umso wichtiger, dass wir die Erwartungen der Unternehmen und der Menschen stimulieren. Denn welcher Unternehmer würde unter diesen Bedingungen investieren, welcher Konsument shoppen gehen?
Aber ist damit nicht klar, dass das deutsche Wirtschaftsmodell – wir beliefern die Welt – verloren ist?
Sicherlich ist das für Deutschland eine Riesenherausforderung. Aber nehmen Sie Volkswagen, die produzieren wieder in China: Forschung und Entwicklung zentral in Deutschland, aber die Produktion läuft global. Das schafft Flexibilität, und man kann regional schalten und walten. Aber dieses Modell hängt auch davon ab, dass der Staat oder die heimische Notenbank, also bei VW die EZB, hilft. Letztendlich ist es ein Spiel mit der Idee, dass im Grunde, wenn alles abgeschaltet ist, der Staat einsteigt als Arbeitgeber letzter Instanz, als Zahler letzter Instanz. Und es kann sein, dass so das Modell der Zukunft aussieht.
Diese Welt klingt ziemlich gespenstisch: Staaten, die ihre Schulden, also ihre Anleihen, an die Zentralbank verkaufen, ein ähnliches Spiel bei Unternehmen – das zeichnet sich ja schon ab. Wie funktioniert eine Wirtschaft, deren Finanzierung nur vom Staat und der Zentralbank abhängt?
Yeah, you‘re not in Kansas anymore! Das sagen die Leute hier in Amerika: Willkommen in der Realität. Aber im Ernst. Es ist nicht so schlimm. Das ist doch die Realität des Kapitalismus seit den 80er-Jahren. Seit Greenspan Ende der 80er-Jahre Vorsitzender der amerikanischen Zentralbank wurde, unterstützt die Fed die Aktienmärkte. Und das meine ich gar nicht polemisch, das ist eine realistische Beschreibung. Der große Wachstumsmotor der Welt ist der Staatskapitalismus in China, wo die Schulden seit Ende der 90er-Jahre aufgehäuft wurden.
Für Anhänger einer liberalen Marktwirtschaft ein Albtraum.
Na ja, es muss ja nicht heißen, dass wir alles einfrieren und den Fortschritt beenden. Die Chinesen machen es vor, die betreiben wenn nötig von oben ganz radikale Strukturveränderungen. Es muss auch nicht heißen, dass alles Kapital nur noch in sinnlose Projekte fließt und Zombie-Firmen entstehen. Nehmen wir nur mal den Kampf gegen den Klimawandel: Von ganz allein fließt das Kapital nicht in die richtigen Unternehmen und Projekte. Aber ja, in die heile Welt der sozialen Marktwirtschaft der 50er-Jahre kommen wir nicht zurück.
Ein gelenkter Kapitalismus?
Für mich ist die Regulierung der Banken nach der Finanzkrise zukunftsweisend: Hier haben Staaten, Aufseher und Notenbanken ja massiv in die Finanzmärkte eingegriffen. Nach diesem Modell funktioniert heute China, funktionieren die USA. Und die Eurozone mehr und mehr inzwischen auch.
Sie meinen, so wie wir seit zehn, 15 Jahren den Bankensektor managen, so machen wir das auch im Rest der Wirtschaft in den nächsten Jahren?
Sie klingen jetzt ein bisschen entsetzt: Wenn die Zentralbank eingreift, ist ja alles manipuliert. Worauf die Antwort ist: Ja, aber in einem positiven Sinne. Wir haben die Fähigkeit demonstriert, aus Krisen zu lernen. Das stellt nicht den Kapitalismus infrage, gar nicht. Aber er wird einfach nur intelligenter gemanagt. Wir eliminieren noch nicht mal die Risiken, wir verdrängen sie nur. Aber das ist ja schon etwas. Im Finanzsektor schlummern die Risiken jetzt auch nicht mehr in den Bilanzen der Deutschen Bank oder bei Lehman. Sondern bei der Zentralbank. Dort sind sie immerhin transparenter.
Das ist eine Vision von Technokraten.
In den USA und in Großbritannien verfahren die Zentralbanken pragmatisch. Aber sie haben recht, natürlich brauchen wir für diese Politik eine politische Legitimation und nach dem Urteil des deutschen Verfassungsgerichts erst recht. Man sollte sich aber von den deutschen Verfassungsrichtern und den Kleinsparern nicht in die Defensive treiben lassen. Im Gegenteil. Es geht um eine zeitgemäße Austarierung der Verantwortungen. Die Technokraten betteln doch darum. Christine Lagarde von der EZB, selbst Jens Weidmann von der Bundesbank, sie alle sagen: Wir stützen die Eurozone über die Geldpolitik, weil sonst der Karren vor die Wand fährt. Aber wir brauchen eine politische Grundlage: ein Mandat und als Ergänzung eine vernünftige Fiskalpolitik.
Die fehlende Legitimation ist das Stichwort: Europa wirkt in diesen Wochen so zerstritten und wie selten. Wie lange kann das noch gut gehen – droht gar ein Bruch der Eurozone?
Wenn man mit einem englischen Akzent von New York aus über die Eurozone urteilt, dann sollte man vorsichtig sein. Der Euroskeptizismus hat zum Teil utopische Dimensionen. Einen Bruch der Eurozone halte ich für sehr unwahrscheinlich. Meine Vision für die Eurozone ist eine zunehmend schlechte Ehe, aus der sich niemand trennt. Denn eine Scheidung wäre zu schlimm, die Kosten zu hoch. Es ist eine Verelendung – politisch, ökonomisch, emotional.
Was bräuchten wir denn, um die Beziehungen zu unseren Nachbarn zumindest zu bessern?
Zunächst einmal muss man sich bewusst machen, wie schlecht die Stimmung in der EU und zwischen den Euro-Partnern inzwischen ist. Es gibt so viel aufzuarbeiten in der europäischen Wirtschaftspolitik der letzten Jahrzehnte, so viel Misstrauen und Frustrationen und Demütigungen – das ähnelt in gewisser Weise bürgerkriegsähnlichen Erinnerungsstrukturen inzwischen, und die vergehen nicht ohne weiteres!
Und dann?
Ein Weg wäre, tatsächlich ernst zu machen mit der Konstruktion eines europäischen Staatsgebäudes. Das ist natürlich schwierig, ich weiß das. Aber das wäre die Legitimation, die Europa so dringend bräuchte.
Meinen Sie mit so einem Staatsgebäude einen gemeinsamen Haushalt und gemeinsame Haftung?
Wir brauchen für Europa eine sichere Anlage, einen gemeinsamen Anleihenmarkt – wie ihn die USA haben. Ansonsten werden wir in einer Krisensituation wie jetzt immer diese Dynamik haben, dass das Geld ganz Europas – das ist ja nicht nur deutsches Geld, sondern italienisches Geld – in die Anleihen eines Landes flüchtet, weil in Deutschland heile Welt herrscht und in Italien akute Krise. Längerfristig bräuchte so eine europäische Anleihe aber auch eine Unterfütterung durch eigene europäische Steuereinnahmen. Was wir bräuchten, ist ein großer fiskalpolitischer Kompromiss. Das wäre eine stabile Konstruktion.
Aber Europa entwickelt sich doch in die Gegenrichtung, so ein Aufschlag ist schlicht unrealistisch.
Jetzt sprechen Sie wirklich einen Knackpunkt an. Das ist ja in gewisser Weise die defensive Bastion Merkels. Die Bundeskanzlerin schätzt ab und sie definiert, was realistisch ist. Das ist natürlich schwer zu kritisieren. Wenn jemand mit Realismus kommt, dann ist der andere gleich in der Ecke der Utopie, des Irrealismus oder des Postfaktischen. Man kann aber auch anders ansetzen und fragen: Welche Struktur haben wir jetzt? Funktioniert die? Man könnte mit genauso einem starken, realistischen Anspruch sagen: Nein, die Struktur funktioniert nicht.
Die Europäische Zentralbank stabilisiert die Staaten und macht die Arbeit
Adam Tooze
Mag sein, aber realistischer wird die Gegenposition deshalb nicht.
Realistisch ist dann das, was diese Struktur funktionsfähiger machen würde. Dazu müsste man sagen, was uns momentan fehlt – und das ist vielleicht ein weiter Sprung, er ist zugegeben gewagt. Das wäre ein gemeinsames Staatsgebäude, eine gemeinsame Fiskalpolitik. Aber es ist unter diesen Bedingungen das einzig Realistische. Das ist die Position des französischen Präsidenten Emmanuel Macron, der sagt: Wir brauchen einen föderalen Ausbau der EU und das muss Geld kosten und dafür müssen Eurobonds her...
Forderungen, die Union und SPD in Deutschland abtropfen lassen...
Es ist so leicht, zu sagen: Das ist unrealistisch. Aber beschreiben wir mal die heutige Situation: De facto ist es so, dass Europa und die Eurozone mit dem Hin und Her nur durchkommen, weil es eine Institution gibt, die sie rauskauft: Die Europäische Zentralbank stabilisiert die Staaten und macht die Arbeit.
Indem sie seit Jahren für hunderte Milliarden Anleihen der Eurostaaten kauft – jetzt mit einem zusätzlichen Ankaufprogramm über 750 Mrd. Euro. Gerade erst hat das Bundesverfassungsgericht, Sie haben es erwähnt, geurteilt, dass es diese Geldpolitik für grundfalsch hält...
Das Urteil ist eine Katastrophe für die Integrität des europäischen Rechts. Die EZB wird es vermutlich ignorieren, was die Bundesbank und die Deutschen in den EZB-Spitze, allen voran Direktoriumsmitglied Isabell Schnabel, in eine ungemütliche Position bringen wird. Es wäre aber eine verlorene Gelegenheit, wenn sonst nichts dabei herauskäme. Für mich demonstriert der Fall, dass die EZB tatsächlich ein neues, zeitgemäßes Mandat braucht, das den deutschen Nostalgikern schwarz auf weiß ausbuchstabiert, welche Herausforderungen heute auf eine Zentralbank zukommen.
Meinen Sie nicht, dass Sie etwas übertreiben?
Es gibt im Englischen den Begriff crooked timber , verbogenes Holz. In der Realität entstehen Dinge aus etwas Verbogenem – und so sehen sie dann auch aus. Die Eurozone ist ein verbogenes, mehr oder weniger improvisiertes Vehikel. Irgendwie etwas Zusammengestricktes. Das wäre dann die Antwort auf Ihre Realismusfrage.
Aber das Vehikel fährt.
Es gibt in der Geschichte Momente des Sprungs: Die USA verweisen dann immer auf Alexander Hamilton, den ersten Finanzminister hier, einer der Gründerväter des Landes. Wir können auch Bismarck nennen. Ich habe den Eindruck Deutschland schwankt momentan zwischen einem solchen Bismarck'schen Anspruch und dem Denken in der Logik von Haushaltskonten und Sozialsystemen. Das sind zwei verschiedene Realitäten, die miteinander kollidieren: die Realität der Offenheit der Geschichte, der möglichen Gestaltungsmöglichkeiten auf der einen Seite und auf der anderen Seite die Realität der Berechnung.
Wahrscheinlich sehen deutsche Politiker die Skepsis ihrer Wähler – und zudem eine starke AfD, für die solche Ideen Steilvorlagen für ihre Stimmungsmache sind.
Natürlich, aber jeder von uns kennt doch den Impuls, auf der richtigen Seite der Geschichte gestanden zu haben. Wir wollen vor der Geschichte gut aussehen, es ist ein sehr fundamentales menschliches Motiv. Ich verstehe nicht, warum es in der deutschen Politik so wenig Figuren gibt, die in gewisser Weise diesen Macron'schen Anspruch haben, eine gute Figur abgeben zu wollen.
Weil es politischer Selbstmord wäre.
Das kann gut sein. Aber ja, wir sagen: Why don't you wanna die young and leave a beautiful corpse? Glauben Sie mir, ich war in den 80er-Jahren weiß Gott kein Fan von Helmut Kohl – aber im Nachhinein ist klar, dass er diesen heroischen politischen Anspruch hatte. Es war natürlich sehr ungewohnt für einen hochprovinziellen Menschen, aber trotzdem sagte er: Ja okay, jetzt machen wir mal den Bismarck.
Merkel hat diesen Impuls nicht?
Sie ist eine sehr, sehr kluge Frau, die bestimmt über die Geschichte und die Welt nachdenkt. Aber nicht auf die Art, dass sie sich selbst als gestaltend wahrnimmt. Ab einem bestimmten Punkt ist das nicht mehr realistisch, wenn man nicht einkalkuliert, wie viel Einfluss man tatsächlich ausübt. Das wirkt ja wie eine Selbstentmächtigung. Es geht ja bei gemeinsamen Bonds zur Finanzierung eines großen Konjunkturprogramms in Europa nicht darum, dass Deutschland jetzt hegemoniale Führung ausübt. Es ging nur darum, dass Deutschland Ja sagt und ein bisschen Einfluss auf die Holländer ausübt.
Dieser Ansatz, Corona-Bonds, ist ja nun zunächst gescheitert. Reicht es nicht auch, wenn die EZB einfach weiter kauft?
Wenn die Stabilisierung nur von den Zentralbanken abhängt, ist das kein stabiles Konstrukt. Das ist eher Improvisation. In ein oder zwei Jahren werden wir uns den Schuldenstand der verschiedenen Eurozonen-Länder ansehen und dann steht die Frage im Raum: Was machen wir jetzt mit den italienischen Schulden, die auf 145 oder 150 Prozent des Bruttosozialprodukts gestiegen sind? Und mit den französischen, die bei 120 Prozent plus liegen? Was ich zutiefst befürchte, ist, dass in diesem Moment wieder die Rede sein wird von Konsolidierung wie nach der Finanzkrise, von der Nachhaltigkeit der Staatsfinanzen. Doch das bedeutet im Grunde eine Verschärfung des fiskalpolitischen Drucks – und damit das Gegenteil von einem starken Impuls, der wieder für Wachstum, Investitionen der Unternehmen und mehr Konsum sorgt.
Lassen Sie uns zum Abschluss noch mal die Rechnung aufmachen: Wer zahlt für diese Krise?
Wir alle zahlen jetzt sofort. Der Einbruch des Bruttosozialprodukts ist der Schaden.
Also zahlen die, die ihre Jobs verlieren?
Das ist der Schaden, und er ist jetzt real. Die Frage ist, ob wir uns in drei Jahren dieses schwere verteilungspolitische Problem zum Verhängnis machen oder ob wir es einfach begraben. Wenn wir es begraben, dann entsteht der Schaden jetzt – aber nichts weiter darüber hinaus.
Was meinen Sie mit begraben? Die Schulden, die wir aufgenommen haben, um die Kosten der Krise abzufedern, sollen wir streichen?
Ich meine, wir sollten uns die aktuelle Lage nicht noch zusätzlich vergiften durch eine Verteilungsfrage. Bei der Frage, wer die Kosten der Krise trägt, geht es ja um die Frage, welche Mehrheiten ich habe. Der Vorschlag für eine Weltvermögensteuer ist super, bin ich sofort dafür! Hat aber leider null Realisierungschancen! Was hat Realisierungschancen, was ist verteilungspolitisch und politisch nicht giftig? Im Moment wäre ich zufrieden, wenn wir so etwas finden.
Dann bleiben wirklich nur die Notenbank übrig, die alles kaufen.
Sie sagen es, und ich finde es genial. Wir machen das über die Notenbank. Das ist nicht das Ende der Welt. Am besten machen wir es wie die Briten – die Regierung hat einfach ein Konto bei der Bank of England. Und wir reden nicht über Zimbabwe, sondern über die zweitälteste moderne Zentralbank der Welt. Die britische Regierung hat das dann als Verbindlichkeit in ihrer Bilanz stehen, das muss irgendwie mal abgerechnet werden. Macht man bei Gelegenheit, wenn es viele Sparer gibt, die britische Staatsanleihen wollen, und dann wird es umgebucht. Endlich wieder verlässliche, langfristige, verzinste Staatsanleihen – das ist es doch, was auch die Deutschen wollen.
Kennen Sie schon unseren Newsletter „Die Woche“ ? Jeden Freitag in ihrem Postfach – wenn Sie wollen. Hier können Sie sich anmelden