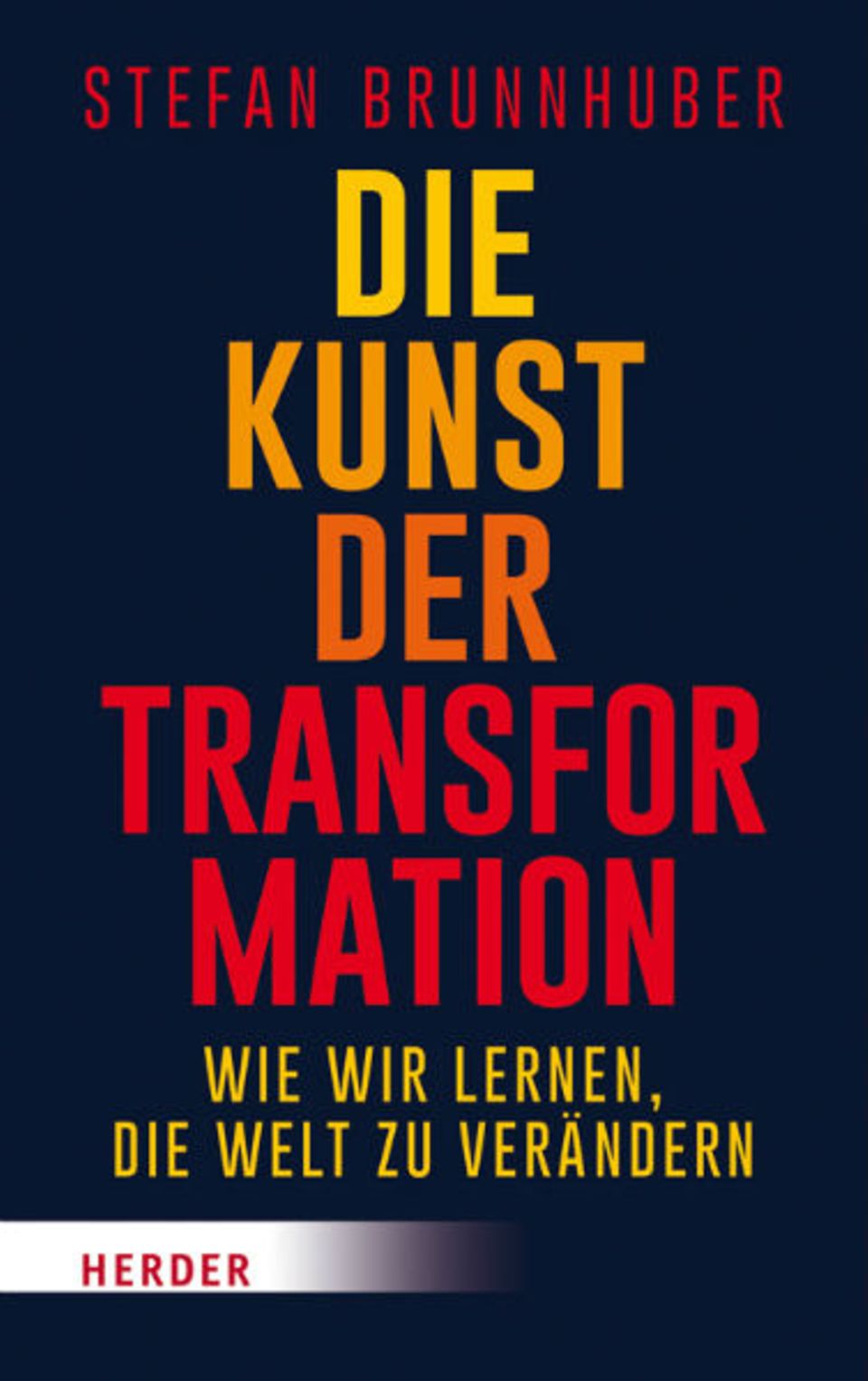Stefan Brunnhuber ist Ökonom und Psychiater, Mitglied des Club of Rome und Senator der Europäischen Akademie der Wissenschaften sowie ärztlicher Direktor einer Diakonie-Klinik für Integrative Psychiatrie. Weitere Informationen: stefan-brunnhuber.de
Bundeskanzlerin Angela Merkel, US-Präsident Barack Obama und die anderen G7-Vertreter wissen: Wir leben inzwischen im Erdzeitalter des Anthropozän, das ökonomischen Entscheidungen geoökologische Grenzen setzt. Expansives Wachstums mit unendlichen technologischen Substitutionseffekten und nachgeordnerter sozialer Umverteilungen ist daher kein zukunftsträchtiges Konzept mehr. Nachhaltiges Leben und Wirtschaften setzt jedoch voraus, nicht nur die äußeren, sondern auch die inner-psychischen Faktoren, die Grenzen des Denkens zu kennen. Diese acht Erkenntnisse sind zu beachten.
1. Frames statt Fakten
Wenn wir unser Verhalten ändern wollen, geschieht dies nicht über Fakten, Zahlen und Nummern. Zwei Grad-Ziel, 20.000 Verhungerte am Tag oder Zahlen um den Verlust an Biodiversität lösen keine nachhaltige Veränderung aus. Dazu benötigen wir Frames. Frames sind kognitive Deutungsrahmen im Kopf innerhalb deren wir denken, sprechen, interagieren und sprachgeleitet handeln. Wir sprechen und handeln somit niemals kontextfrei oder schier rational an Fakten orientiert, sondern immer perspektivisch.
Der Frame Klimaerwärmung etwa ist psycholinguistisch ungeeignet, unser Verhalten zu ändern. Der Begriff Erwärmung löst eher den Reflex aus, dass man sich zwei weitere T-Shirts kauft oder dass einem warm ums Herz wird. Ähnlich ist es beim Begriff Klimawandel. Auch er aktiviert einen Frame, der alles andere als verhaltensändernd wirkt. Ein Wandel ist semantisch in beide Richtungen offen, gleichsam nach oben und nach hinten. Besser wäre wohl Klimaüberhitzung. Mit den richtigen kognitiven Frames lässt sich somit mehr bewirken als mit simplen Appellen und Daten.
2. Kognitive Dissonanz und Bestätigungseffekt
Die Realität, so wie sie ist, ist psychologisch nahezu unerträglich, wenn wir die reinen Fakten betrachten: Die CO2-Menge, die uns bleibt bis 2050, um innerhalb des Zwei-Grad-Zieles zu verbleiben, die tausenden von Menschen, die täglich an Unterernährung sterben, die hunderttausenden Kinder, denen eine adäquate Schulbildung verwehrt wird, oder die Millionen von Erwachsenen, die keine Arbeit haben - all dies ist im Grunde unerträglich.
Aus der Psychologie ist die kognitive Dissonanz bekannt. Wir aktivieren daher ständig Frames in unserer Innenwelt, um diese äußere Realität erträglich zu machen, etwa: „Vielleicht ist es doch nicht so schlimm.“ „Die Statistik ist gefälscht.“ Oder: „Mal sehen, was die anderen so machen“ etc. Damit wird das aktuelle Verhalten bestätigt, aber nicht verändert. Aber wir betrachten eben keine Fakten, sondern immer nur Frames und handeln auch nur danach. Wenn wir eine gesellschaftliche Transformation anstreben hin zu mehr Gerechtigkeit, mehr Nachhaltigkeit und mehr Frieden innerhalb der geo-ökologischen Grenzen unseres Planeten, brauchen wir schlicht völlig andere Frames.
3. Paralleles und lineares Denken
Unser Verstand hat prinzipiell zwei Möglichkeiten, die Welt zu erkennen und in ihr Entscheidungen zu treffen. Psychologen sprechen von System 1 und System 2: System 1 ist dadurch charakterisiert, dass wir intuitiv vorgehen, meist unbewusst, gleichsam automatisch und implizit. Die Fähigkeit zu Kreativität, Humor und Gestaltwahrnehmung gehört hierher. System 2 arbeitet anders: Hier geht es eher um langsame Vorgänge, abstraktes Denken und sprachlich geleitete Ereignisse. Der Aufwand ist höher, die Kapazität ist durch das Arbeitsgedächtnis begrenzt und ist logisch, analytisch, regel- und pfadgeleitet.
Obwohl die allermeisten Denk-, Wahrnehmungs- und Entscheidungsprozesse parallel verschaltet und damit dem System 2 näher sind, verwenden wir vorrangig lineare, perspektivische, sequentielle Problemlösungsstrategien. Sie haben zwar den Vorteil, dass man recht präzise und zuverlässige, aber eben langsame Aussagen bekommt. Solche Aussagen sind dann nicht falsch, aber unvollständig, da sich komplexe Systeme häufig erst durch paralleles Denken hinreichend abbilden lassen.
Wenn wir aber nur linear vorgehen, etwa: erst wachsen, dann umverteilen, sehen wir auch nur Handlungsfelder entlang dieses Pfades. Viele Vorgänge aber sind simultan, parallel und entziehen sich dann dem linearen Denken als Problemlösung, weil man nur Einzelereignisse sieht und die Aufmerksamkeit darauf fokussiert, doch der Überblick geht verloren. Wir sehen, bewerten und entscheiden dann nur innerhalb der Regeln von System 2.
Wenn es um einen Paradigmenwechsel geht, sollte das Gehirn zunächst im System 1 aktiv sein, um alle möglichen Varianten, Strategien, Gefahren und Risiken rasch einschätzen zu können. Wenn man sich dann innerhalb eines vorgegebenen Paradigmas bewegt, ist das System 2 besser. Jetzt können zielgenau, lineare, konkrete Detailfragen sequentiell abgearbeitet werden. Parallele Währungssysteme, aber auch Musizieren, Kochen und Diskutieren sind Beispiele für System 1.
4. Kooperation statt Kompetition
Wir kommen nicht mit einem Wettbewerbs-Gen auf die Welt, sondern mit der Fähigkeit und dem Bedürfnis zur Kooperation, zum gegenseitigen Verstehen und zur Solidarität. Erst wenn die Integrität des Einzelnen oder basale Bedürfnisse in Gefahr geraten, werden Wettbewerbsverhalten und Ausgrenzungsstrategien mobilisiert. Kooperative Strategien, vor allem Tit-for-Tat-Strategien (Wie du mir, so ich dir), sind langfristig immer erfolgreicher als kompetitive Strategien. Kompetitive Vorgehensweisen hingegen führen früher oder später ins Aus.
Als Menschen haben wir ein Gefühl dafür, wann Verteilungen noch gerecht sind. Wenn Verteilungsmuster zu asymmetrisch werden, etwa beim Einkommen oder beim Vermögen, verweigern die Akteure die weitere Zusammenarbeit. Die 25 bestbezahlten Hedgefonds-Manager haben letztes Jahr fast 13 Mrd. USD verdient. Das sind 13-mal 1000 Mio. US-Dollar. Empirisch wird eine Verteilung, die außerhalb von 80:20 oder 70:30 liegt gesellschaftlich verweigert. Vielleicht sind wir an einem solchen Punkt angelangt.
Die klinische Psychologie kann hier noch mehr beitragen: Nicht nur dass weniger mehr, auch anders sein kann, sondern dass Wohlbefinden durch Geben, soziales Engagement und Solidarität nachhaltiger ist und dass Glückserleben bekanntlich bei einem Jahreseinkommen von 50-75.000 Euro für eine dreiköpfige Familie bereits ein Plateau erreicht.
5. Demut und Größenwahn
Bekanntlich haben wir erhebliche Schwierigkeiten im Umgang mit exponentiellen Funktionen. Am Anfang reagieren wir gar nicht, dann ist es meist zu spät. Kausalitäten und Korrelation werden ebenfalls ständig verwechselt, und bei der Zuordnung von extrem großen sowie extrem kleinen räumlichen und zeitlichen Dimensionen haben wir kein wirkliches Wahrnehmungsorgan. Etwa, was ist eine Nanosekunde? Eine Nanosekunde verhält sich zu einer Sekunde wie ein Tag zu 2,7 Millionen Jahren. Wer kann sich eine Nanosekunde vorstellen? Niemand. Oder was nützt uns der Bezug, dass unsere globale Schuldenlast bei 150 Billionen US-Dollar liegt, was auf einander gestapelt 50 Mal bis zum Mond reicht.
Wir als Spezies reagieren innerhalb der sogenannten „mittleren Dimension“ offenbar am adäquatesten. Das heißt, erst wenn es uns gelingt, die Beziehung zu Größenordnungen wie Meter und Zentimeter, Stunden und Tage herzustellen, gelingen verhaltensgeleitete Veränderungen. Wir wissen eigentlich viel zu wenig, als dass wir in komplexe Systeme einfach so eingreifen könnten.
Das gilt auch für die Energiewende und Elektroautos. So diskutieren wir noch viel zu wenig, dass erneuerbare Energiekonzepte einen deutlich höheren primären Ressourcen- und Landverbrauch (vor allem Kupfer, Stahl, Zement) mit sich bringen und die Anzahl der umweltbedingten Todesfälle eher zu als abnehmen wird. Das hat damit zu tun, dass wir den zusätzlichen Strom weltweit vor allem durch Kohlekraftwerke decken müssen, die die Luftverschmutzung erhöht. Gut gemeinte Interventionen führen so schnell zu negativen, nicht beabsichtigen Effekten.
6. Wahrnehmungsillusionen
Was haben eine Plastiktüte, ein verfehltes 2,5 Prozent Wachstum und die Idee des Multitasking gemeinsam? Alle drei leben von etwas, was Mediziner und Psychologen eine Wahrnehmungsillusion nennen. Die Plastiktüte ist viel zu billig. Wenn wir alle Kosten internalisieren würden, wäre sie unbezahlbar. Ein verfehltes expansives Wachstumsziel im Vergleich zum Vorjahr kann zwar in absoluten Zahlen immer noch mehr als im Vorjahr sein, doch wir würden es als Verlust empfinden. Und wenn wir mit unseren elektronischen Geräten ständig zwei Dinge gleichzeitig machen, haben wir zwar das Gefühl, besonders effizient zu sein, wir bekommen aber - das ist empirisch nachgewiesen - nur die Hälfte mit. Unser Gehirn kann nicht Multitasking.
Solche Wahrnehmungsillusionen sind hilfreich, da es dem menschlichen Geist schwerfällt, Unsicherheiten, unbequeme Wahrheiten, Dissonanzen und Widersprüche auszuhalten. Stattdessen erzählen wir uns ständig Geschichten, die zwar in zunehmendem Maße mit der Realität nichts mehr zu tun haben, die aber unser Gewissen beruhigen. Noch ein Beispiel: Wenn wir vor einem Einkaufsregal stehen und aus 24 Naturjoghurt-Produkten auswählen können und uns dies als Ausdruck von Freiheit verkauft wird, reagiert der menschliche Geist mit einer Aversion, mit Kaufverweigerung und Rückzug. Man nennt das dann die Paradoxie der Wahl. Mehr ist eben nicht immer besser, manchmal auch schlechter.
7. Knappheit und Überfluss
Es gibt so etwas wie eine Psychologie der Knappheit. Knapp heißt, zu wenig von etwas, beispielsweise Nahrungsmittel, medizinische Versorgung, Geld, soziale Kontakte oder Zeit. Auch wenn es einen grundlegenden Unterscheid gibt, ob man zu wenig Geld zum Leben hat (Armut) oder zu wenig Zeit (wie so mancher Manager), so lösen sie doch beim Menschen ähnliche mentale Zustände aus. Menschen, die unter Knappheitsbedingungen Entscheidungen treffen müssen, haben eine eingeschränkte kognitive Leistungsfähigkeit. Empirisch korreliert das mit einem Abfall des IQ um mindestens 13 Punkte oder einem Zustand einer Nacht ohne Schlaf. Höhere Ablenkbarkeit, kurzfristige Fehlentscheidungen, reduzierte Impulskontrolle usw. sind dann die Folge.
Warum ist das wichtig? Weil wir im Anthropozän mit Knappheiten konfrontiert werden und dafür psychologische Lösungen benötigen. Wenn - wie einer aktuellen IWF-Studie zufolge – mehr als 80 Prozent der Weltbevölkerung ab 2016 von der Austeritätspolitik betroffen ist, hat das auch Auswirkungen auf unseren Verstand und in der Folge auf unser Entscheidungsvermögen. Vielleicht müssen wir angesichts solcher empirischen Ergebnisse über andere Finanzierungsformen nachdenken. Die Marshall-Plan-Initiative oder das Green-QE-Konzept gehören hierher.
8. Weniger ist mehr, aber anders
Nur zur Erinnerung für diejenigen, die in einer unübersichtlichen Lage nicht mehr die Zeit haben, nachzulesen: Es gibt derzeit weltweit keine einzige Technologie, die eine CO2-Senke darstellt, und selbst Lebenszyklusanalysen und zyklische Wirtschaftsmodelle (Cradle to Cradle) berücksichtigen nicht den immensen Energiebedarf beim Rück- und Umbau der Industrie und der Landnutzung. Hinzu kommt, dass unser globaler Anteil an erneuerbarer Primär-Energie immer noch bei circa ein Prozent des gesamten Energiebedarfs liegt. Demut, Achtsamkeit und Ehrfurcht vor dem Leben hat das Albert Schweitzer vor hundert Jahren einmal genannt. Spazierengehen im Wald, Gartenarbeit, Meditieren, Fahrrad fahren, Schweigen, Fasten sind Beispiele hierfür.
Fazit:
Wirtschaften im Anthropozän erfordert ein anderes Denken, Handeln und Entscheiden. Die ersten Schritte heißen: Klärung der Frames, Erkennen von Dissonanzen, mehr paralleles Denken, mehr Demut und Wissen um die Grenzen unseres Denken und mehr Kooperation als Wettbewerb. Die Idee, dass man in einer unübersichtlichen Situation, die Geschwindigkeit erhöht, den Durchsatz weiter steigert (drei Prozent jährliches Wachstum), durch Großtechnologien den möglichen Kontrollverlust psychologisch kompensiert und durch ständige lineare wie sequentielle Denk- und Entscheidungsvorgänge den gegebenen Pfad immer wieder bestätigt und doch den Überblick verliert, ist theoretisch denkbar, aber eindeutig dysfunktional und sicherlich nicht nachhaltig.
Im Anthropozän wird es um die Wahrnehmung, den Respekt und den konstruktiven Umgang mit Grenzen gehen. So stellen Initiativen wie Nachbarschaftshilfen, Car-Sharing, Ehrenamt, Zeitkonten, die Entkopplung von Nutzung und Eigentum, Reparaturkultur, neue Mobilitätsformen, Komplementärwährungen, Re-regionalisierung mit mehr Subsistenz und Suffizienzstrategien usw. keine Fehler im System, krankhafte Entwicklungen oder Lebensstile von Sonderlingen und Minderheiten dar. Vielmehr sind es sozial-psychologische Praktiken, die die kommende gesellschaftliche Entwicklung im Kleinen bereits vorwegnehmen.
Es geht eben um das richtige Narrativ: Business as usual, wait-and-see oder einfaches Greening sind psychologisch irrational, dysfunktional, ineffizient, teilweise ungesund und auf Dauer teuer und so nicht überlebensfähig. Damit die Transformation in ein nachhaltiges Zeitalter gelingt, müssen wir Technologien, Good Governance und grünen Wachstumspfad an die Eigenheiten des Humanfaktors binden.