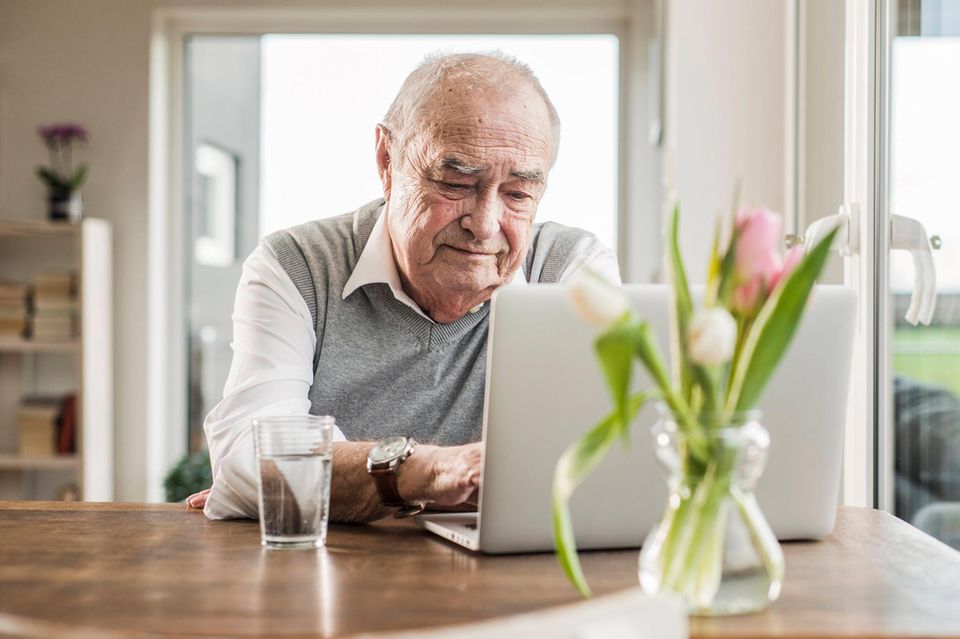David Milleker ist seit 2006 Chefvolkswirt bei Union Investment, einer der größten deutschen Fondsgesellschaften. Sie gehört zur genossenschaftlichen Finanzgruppe.
Im Dezember 2015 zeichnet sich ab, dass die Geldpolitik diesseits und jenseits des Atlantiks komplett unterschiedliche Wege einschlägt: Die US-Notenbank Federal Reserve (Fed) will straffen, die Europäische Zentralbank (EZB) weiter lockern. Nimmt man beide Wirtschaftsräume jeweils für sich als Insel, kann man die unterschiedliche Ausrichtung rechtfertigen. Die USA haben eine längere wirtschaftliche Erholung hinter sich als Europa. Entsprechend ist der Zyklus dort reifer als hierzulande. Andererseits lehrt die historische Erfahrung, dass geldpolitische Divergenz in der Vergangenheit immer nur ein kurzes Intermezzo war.
Für eine transatlantische Divergenz gab es historisch zwei Beispiele: Im Jahr 1977 ging die Fed auf Straffungskurs, während die Bundesbank noch lockerte. In den Jahren 1990 und 1991 lockerte die Fed zur Rezessionsbekämpfung, die Bundesbank hingegen straffte zur Dämpfung des Wiedervereinigungsbooms. In beiden Fällen hielt dies nicht lange an: Im Zuge der Erholung nach der ersten Ölkrise konnte die Bundesbank der Fed 1978 mit Zinserhöhungen folgen. 1992 zwang das Auseinanderbrechen des Europäischen Währungssystems die Bundesbank zur Trendumkehr in Richtung Zinssenkungen. Man kann also festhalten, dass sich die Geldpolitik in den großen Wirtschaftsräumen in der Regel im Konvoi bewegt und eine diametral gegensätzliche Ausrichtung nicht lange durchzuhalten ist.
Zwei Szenarien
Seit 2009 haben mehrere Zentralbanken – etwa die EZB sowie die australische, kanadische, neuseeländische, norwegische und schwedische Notenbank – versucht, sich aus diesem Konvoi mit Zinserhöhungen zu lösen. Wirklich geschafft hat das aber keine Zentralbank. Wahlweise wurde der Versuch schnell abgebrochen (Kanada) oder man leitete zügig den Rückzug mit neuen Zinssenkungen ein (alle anderen). Die Standardkausalkette in diesen Fällen: Die Zinserhöhung löst eine kräftige Aufwertung aus, die zu einer merklichen Konjunkturabkühlung und ungewünscht niedriger Inflation führt.
Folgende Szenarien sind denkbar: Einmal könnten sich die Weltwirtschaft und Europa so dynamisch erholen, dass sich die Notwendigkeit einer fortgesetzt lockeren Geldpolitik außerhalb der USA erledigt. Die US-Notenbank könnte dann auf Straffungskurs bleiben, ohne dass sich der Wechselkurs bewegt. Der Effekt einer sich ausweitenden Zinsdifferenz würde dann durch eine abnehmende Wachstumsdifferenz ausgeglichen. Dann könnte es natürlich auch sein, dass die US-Notenbank eben nicht weiter strafft – genau wie die anderen Zentralbanken, die es versucht haben.
Ganz egal, in welchem Szenario wir nun landen – entscheidend wird sein, ob sich die konjunkturelle Situation in den Schwellenländern merklich stabilisiert. Gegenwärtig sehen wir hierfür leider kaum Anzeichen, sondern das genaue Gegenteil: einen verstärkten Abwärtstrend – sowohl in den Rohstoffökonomien wie im innerasiatischen Handel. Gut möglich also, dass die Fed sich nur zaghaft mit Zinserhöhungsschritten vortasten kann, um dann postwendend den Rückzug antreten zu müssen.