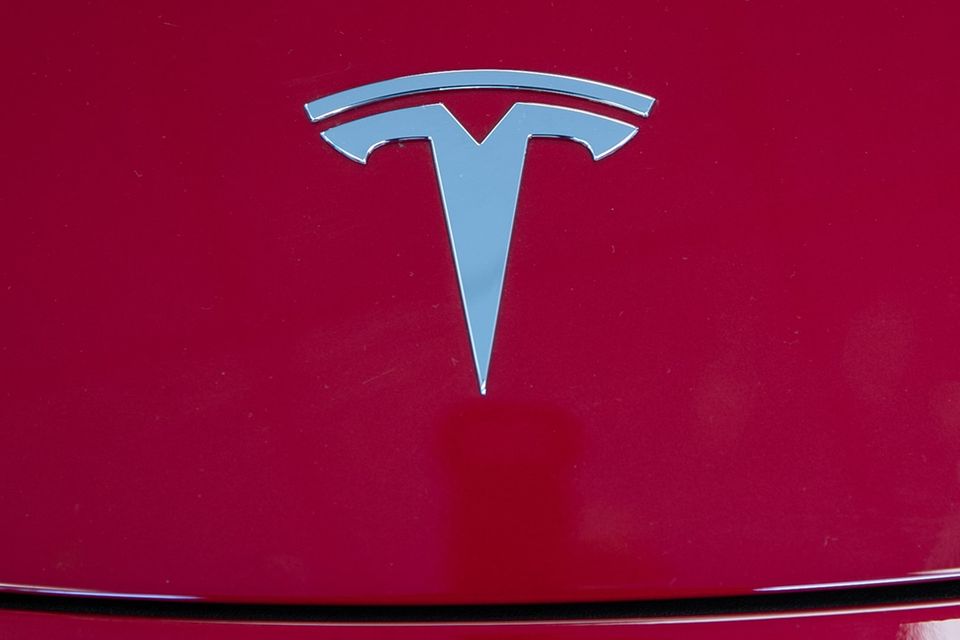Als Ende 2019 der Plan für eine Tesla-Fabrik in Grünheide enthüllt wurde, kündigte das Unternehmen an, schon Mitte 2021 die ersten Autos vom Band rollen zu lassen. Das gelang nicht ganz, ein Dreivierteljahr Verspätung hatte das Projekt am Ende.
Und dennoch: Weniger als 30 Monate für Bau und Genehmigung eines komplett neuen Werks, das im Jahr eine halbe Million Autos produzieren soll? Es ist eine bemerkenswerte Leistung. Und eine neue Erfahrung für Deutschland, wo sich Großprojekte sonst schier unendlich in die Länge zu ziehen scheinen, ausgebremst von Paragrafen, Bürokraten und einer derartigen Megavorhaben höchst skeptisch gegenüberstehenden Bevölkerung.
Dass das Experiment gelang, liegt daran, dass nicht alles, aber viel richtig gemacht wurde. Fünf Antworten auf die Frage: Wie war das möglich?
1. Die Gesetze
Im „Gesetz zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Luftverunreinigungen, Geräusche, Erschütterungen und ähnliche Vorgänge“, kurz Bundes-Immissionsschutzgesetz, findet sich unter Paragraph 8a ein interessanter Passus: Genehmigungsbehörden wird hier nämlich die Möglichkeit eingeräumt, Bauanträge vorläufig zuzulassen, wenn mit einer Entscheidung zugunsten des Antragstellers gerechnet werden kann, ein öffentliches Interesse an dem Projekt besteht und der Projektträger auch das Risiko für mögliche Schäden und den theoretisch denkbaren Rückbau übernimmt.
Genau diesen Spielraum hat Tesla genutzt: Um nicht auf die Behörden warten zu müssen, baute der Konzern im Rahmen dieser Sonderregelung im Umweltrecht mit insgesamt fast zwei Dutzend vorläufigen Zulassungen für verschiedene Teile der Fabrik – auf eigenes Risiko. Hätte das Landesumweltamt seinen Antrag für das Gesamtprojekt final abgelehnt, hätte der Konzern das Gelände wieder so herrichten müssen, wie er es vorgefunden hat. Im schlechtesten Fall hätte Tesla einen dreistelligen Millionenbetrag versenkt.
In Brandenburg wurden so schon viele andere Projekte geplant, von Windparks bis zu einer BASF-Fabrik. Aber noch kein Unternehmen hat die rechtlichen Möglichkeiten so konsequent genutzt wie Tesla – in erster Linie wohl wegen der immensen Risiken.
2. Das Risiko
Der unbedingte Wille Teslas, das Projekt voranzutreiben und riesige Beträge zu investieren, obwohl nicht letztendlich geklärt war, ob die Genehmigung kommen würde, würde den meisten deutschen Konzernen wohl abgehen. Vermutlich zeigt sich hier am krassesten, wie sich das Unternehmen aus dem Silicon Valley von Corporate Germany abhebt: Tesla ließ sich von dem Risiko nicht abschrecken.
Das Genehmigungsverfahren gehe „nur deshalb so schnell, weil Tesla bereit ist, ein hohes unternehmerisches Risiko zu tragen“, sagte Wirtschaftsminister Jörg Steinbach (SPD) Ende 2020 zu Capital. Das unterscheide den E-Autobauer von deutschen Konzernen, in denen Bedenkenträger das Wort führen: „Bis jetzt haben die meisten Unternehmen in Deutschland nicht die Mentalität, um das Tesla-Projekt als Blaupause nutzen zu können“, so Steinbach.
3. Die Politik
Steinbach, der Wirtschaftsminister, rollte Tesla schon früh den Teppich aus. Im Januar 2019 schickte er etwa einen Brief an den Firmensitz in Palo Alto, in dem er Brandenburg als Standort für die geplante nächste Gigafabrik anpries – woraufhin regelmäßige Telefonschalten folgten, in der Regel jeden Montag, aus denen Steinbachs Leute mit langen Aufgabenlisten herauskamen. Deadline für die Erledigung: Donnerstag. „Das war eine Prüfung, ob wir mithalten können“, sagt einer, der dabei war.
Als die Tesla-Vertreter ein Dreivierteljahr später zum ersten Mal persönlich in Potsdam auftauchten, nahm sich der Minister einen ganzen Tag Zeit für die Detailfragen der Konzernexperten. „Es galt die Antwort zu vermeiden: Das sagen wir euch nächste Woche“, erzählte Steinbach später. „Oder sogar: Das geht nicht.“ Nach den Gesprächen flog er mit den Tesla-Leuten noch über Grünheide – in einer sowjetischen Propellermaschine vom Typ Antonow An-2, die Fans „Anuschka“ nennen.
Tesla war für Steinbach, seit Herbst 2018 im Amt, stets Chefsache. Das zeigte er mit solchen Gesten, aber auch an der Geschwindigkeit, die seine Verwaltung an den Tag legte, und dem Willen des Bundeslandes, diese Ansiedlung wirklich an sich zu ziehen.
Gleichzeitig galt es, an den richtigen Stellen Musks Unternehmen auch Grenzen aufzuzeigen. Nichts wäre für die Akzeptanz des Projekts so verhängnisvoll gewesen wie der Vorwurf, es hätte eine „Lex Tesla“ gegeben. Die Landesregierung hat deshalb stets beharrlich die Formel wiederholt, dass „alles nach Recht und Gesetz“ ablaufe.
Und als der örtliche Versorger Anfang Oktober 2020 der Baustelle das Wasser abdrehte, weil Tesla die Rechnungen nicht bezahlt hatte, waren sie in Potsdam folglich nicht nur verärgert: Auch für Tesla gibt es keine Extrawürste.
4. Die Bevölkerung
Widerstand gab es – so klagten etwa zwei Umweltverbände gegen die Rodung eines Kiefernwaldes auf dem 300-Hektar-Areal, letztlich vergeblich. In dem Genehmigungsverfahren, das genau in die Zeit der Corona-Krise fiel, gingen mehr als 800 Einwendungen ein, von Anwohnern, Bürgerinitiativen und Umweltverbänden. Die häufigste Kritik bezog sich auf Befürchtungen, dass die Fabrik negative Auswirkungen auf den Wasserhaushalt der Oder-Spree-Region haben könnte.
Als Musk bei einem Vor-Ort-Termin auf die Kritik angesprochen wurde, lachte er die Frage weg, verwies auf die Bäume ringsum und sagte: „Wir sind nicht in der Wüste.“ Die Flapsigkeit hätte Tesla noch auf die Füße fallen können. Dass es am Ende dennoch nicht zu einem Widerstand in kritischer Masse kam, lag auch daran, dass die Gegner im Vergleich zu anderen Großprojekten wie Windparks, Mega-Ställen oder dem Flughafen BER nicht so zahlreich waren.
5. Der Standort
Brandenburg ist kein Bundesland, in dem es von großen Industrieprojekten von Weltkonzernen nur so wimmelt. Von entsprechend großer Bedeutung war und ist die Ansiedlung von Tesla für die Landesregierung, aber auch für die regionale Wirtschaft. So sollen in Grünheide schon bald mehr als 10.000 Arbeitsplätze entstehen – mit großer Sogwirkung auch für viele Firmen in der Region, von Zulieferern für Tesla bis hin zu Einzelhändlern und Handwerkern, die vom Zuzug eines Teils der neuen Mitarbeiter profitieren.
Tesla hat diese Rolle als enormer Wirtschaftsfaktor stets geschickt genutzt – auch in Phasen, in denen es im Verhältnis zu manchen Behörden mal ruckelte. Dabei setzte der Konzern darauf, dass auch die Politik ein Interesse daran hat, dass das Projekt erfolgreich wird. Im Großen und Ganzen verzichtete Tesla deshalb darauf, öffentlich Druck auf Politiker und Behörden auszuüben oder sich über die Besonderheiten des deutschen Planungsrechts zu beklagen.
Zwar platzte Tesla-Chef Elon Musk das eine oder andere Mal der Kragen, wenn er auf bürokratische Hürden stieß. Er verkniff es sich aber, sich als Silicon-Valley-Milliardär aufzuspielen, der den Deutschen zeigt, wie es geht. Auch deshalb blieb das Verhältnis zwischen Unternehmen und Politik bis zum Ende intakt.