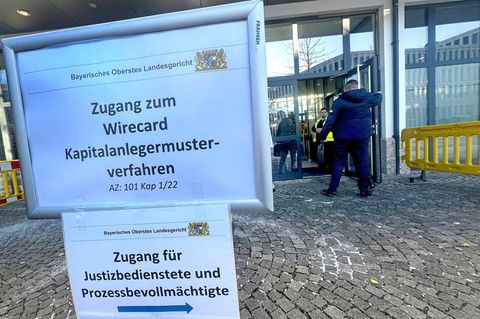Noch Anfang des Jahres 2020 hätte es niemand für möglich gehalten, wie fundamental eine Pandemie das gesellschaftliche und wirtschaftliche Gefüge hierzulande verändern würde. Schnell wurden Großveranstaltungen wie Konzerte oder Fußballspiele als mögliche Superspreader-Events identifiziert und abgesagt. Hauptversammlungen börsennotierter Unternehmen traf es dagegen in anderer Form: Sie wurden im Zuge der Präventionsmaßnahmen einfach in den virtuellen Raum verschoben. Durch die Verlegung konnten sie zwar technisch ermöglicht werden, wurden als zentrale Informations- und Entscheidungsplattform für Konzerne aber auch indirekter und statischer. Nach rund fünf Monaten ist es Zeit für eine erste Bilanz zur virtuellen HV: Was hat sich bewährt? Und was muss aus Sicht der Aktionäre geändert werden?
Betrachtet man die zurückliegende Saison virtueller Hauptversammlungen unter rein technisch-organisatorischen Aspekten, ergibt sich bei den Dax-Unternehmen ein positives Bild: Überwiegend verliefen sie reibungslos und die Aktionäre zeigten sich offen gegenüber den Online-Veranstaltungen. So verzeichnete beispielsweise Henkel eine „Präsenz“ von 90 Prozent des stimmberechtigten Grundkapitals und bewegte sich damit auf ähnlichem Niveau wie in den Vorjahren. Auch SAP konnte auf virtuellem Weg die üblichen rund 72 Prozent erreichen, ebenso die Deutsche Bank mit etwa 40 und Bayer mit 64 Prozent.
Ursächlich dafür ist sicherlich die Aktionärsstruktur der Unternehmen: So ist etwa bei der Bayer AG die Bedeutung der Privataktionäre relativ gering, und auch eine höhere Präsenz dieser Gruppe an der Hauptversammlung würde wenig am Verhältnis der Stimmberechtigten zum Grundkapital ändern. Doch so gering der Effekt auf die Beteiligung der Aktionäre durch die Umstellung auf Online-Hauptversammlungen auch ist – es gibt zahlreiche kritische Stimmen, die in dem Konzept der virtuellen HV Gefahren für das Aktionärsrecht sehen.
Defizite bei Beteiligungs- und Kontrollrechten
Bei aller berechtigten Erleichterung über die Möglichkeit, Hauptversammlungen auch in Zeiten von Corona abzuhalten, gibt es einige kritikwürdige und veränderungsbedürftige Aspekte, die aus Sicht der Aktionäre mit virtuellen Hauptversammlungen verbunden sind. Denn schon jetzt steht fest, dass die Aktionäre auch künftig mit diesem Format werden leben müssen. Eine einfache Rückkehr zum Status quo ante bei Großveranstaltungen wird es so schnell nicht wieder geben. Umso wichtiger ist es nun, die richtigen Schlüsse zu ziehen und Veränderungen im Sinne des Aktionariats einzuleiten.
Aus Sicht der Klein- und Minderheitsaktionäre geht es vor allem um Beteiligungs- und Kontrollfragen. Sie sind aktuell bei virtuellen Hauptversammlungen deutlichen Einschränkungen unterworfen. Das betrifft beispielsweise die Einengung wesentlicher Aktionärsrechte wie das Frage- und Anfechtungsrecht oder die Rechtssicherheit und Klarheit bezüglich des Risikos von Übertragungsstörungen bei virtuellen Hauptversammlungen.
Aktionären und ihren Vertretern ist bei aller Kritik völlig bewusst, dass das Konzept der virtuellen HV und die unter dem Handlungsdruck der Corona-Krise verabschiedeten Notfallgesetze Defizite aufweisen würden. Dennoch ist es nun an der Zeit, die problematischen Aspekte zu adressieren. Das sollte am besten in einem offenen Dialog zwischen den Unternehmen und ihren Aktionären geschehen. Denn nur so kann am Ende sichergestellt werden, dass die Kritikpunkte im Sinne aller Beteiligten geklärt werden können.
Bleibt dieser Dialog aus und erfolgt die Stimmabgabe des Aktionärs wie bisher vor dem heimischen PC, degenerieren die Versammlungen zu reinen Informationsveranstaltungen. Diese Entwicklung gilt es zu verhindern. Denn eine Hauptversammlung – auch die virtuelle – lebt vom aktiven Austausch zwischen den Aktionären als Grundlage ihrer Kontrollfunktion. Im Interesse einer lebendigen Aktienkultur ist es daher notwendig, tätig zu werden und diesen Austausch auch im virtuellen Raum zu ermöglichen.
Der DWS-Experte Hendrik Schmidt kritisierte kürzlich im Rahmen eines Webinars die Hauptversammlung in ihrer aktuellen Form. Sie sei beinahe ausschließlich auf „eine virtuelle Stimmabgabe reduziert“ worden. Diese Kritik trifft zu. Allerdings wird es spätestens im kommenden Jahr sogar noch problematischer: Nach dem Inkrafttreten der Aktionärsrechte-Richtlinie ARUG II und der damit verbundenen „Say on Pay“-Regelung werden Aktionäre dann über die Vergütung der Vorstände abstimmen. Wie das bei einer rein virtuellen Abstimmung ohne vorausgehende Debatte funktionieren soll, ist im Moment schleierhaft.
Hybridlösung als Zukunft
Seit zehn Jahren erlaubt der Gesetzgeber virtuelle Hauptversammlungen. Ein Erfolgsmodell waren sie bis dato eher nicht. Möglicherweise hängt das mit den Risiken für Anfechtungsklagen nach einem technischen Blackout oder einem Zusammenbruch der Übertragung zusammen. Wie das gelöst werden soll, ist weiterhin offen. Wenn die virtuelle Hauptversammlung von den Aktionären getragen werden soll, dann ist Rechtssicherheit bei Übertragungsstörungen unumgänglich. Für die Minderheitsaktionäre ist eine Verlängerung der aktuellen Notfallgesetzgebung keine Option.
Diesbezüglich ist der Meinung von Professor Tim Drygala von der Universität Leipzig zuzustimmen, der das Risiko von Übertragungsstörungen auf die Aktionäre übertragen möchte. So würde die Voraussetzung dafür geschaffen, dass auch Onlineteilnehmer als rechtlich ordentliche Teilnehmer der Versammlung zugelassen werden können. Das ist sicherlich ein gangbarer Weg, der dieses Defizit beheben würde.
Die Pandemie dauert an. Selbst wenn sie sich deutlich abschwächen sollte, werden wir Hauptversammlungen künftig wahrscheinlich als eine Mischung aus physischer Präsenz und virtueller Teilnahme erleben. Aber nur wenn Frage- und Kontrollrechte uneingeschränkt ausgeübt werden können, ein lebendiger Austausch zwischen den Aktionären garantiert und Rechtssicherheit bei Übertragungsstörungen gegeben ist, wird sich die hybride Hauptversammlung auch als akzeptierter Standard etablieren. Vor dem Hintergrund, dass ab 2021 Anleger auch über Vorstandsvergütungen entscheiden sollen, ist die Möglichkeit für breite Abwägungen und Debatten im Vorfeld für Aktionäre essenziell.
Es ist an der Zeit, den Notfallmodus zu beenden, die Defizite zu beseitigen und die nächsten Schritte zu gehen. Rechtssicherheit für Aktionäre muss in den Mittelpunkt gestellt werden. Diese Aufgabe liegt nun vor allen Beteiligten, den Unternehmen, den Aktionären – und vor allem dem Gesetzgeber.
Robert Peres ist Rechtsanwalt in Wiesbaden und Vorsitzender des Vorstands der Initiative Minderheitsaktionäre. Die Initiative, die für die Förderung von Aktionärsrechten eintritt, wurde 2016 gegründet und wird von unabhängigen Anlegern getragen.