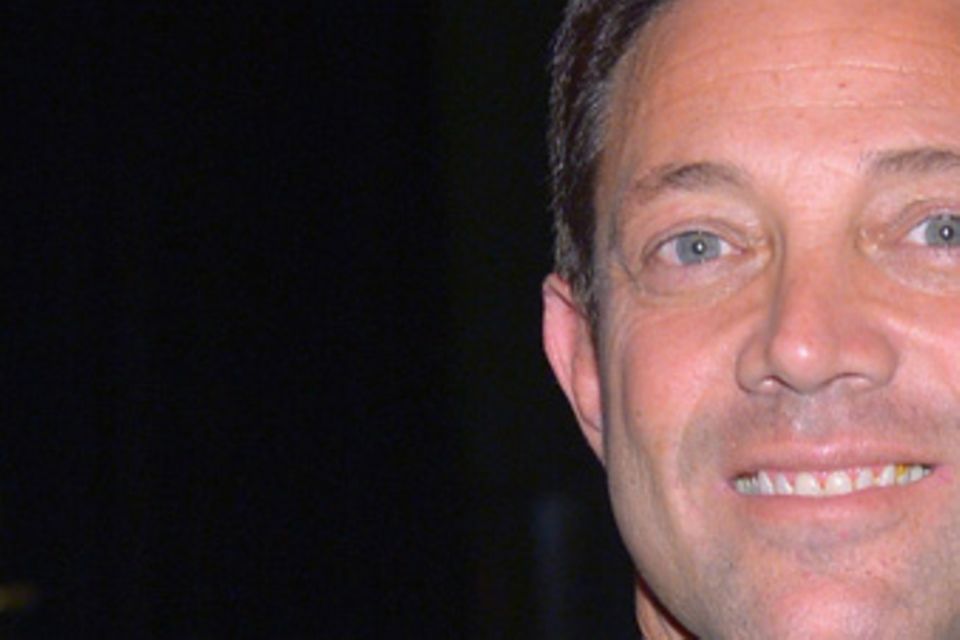„Welch ein Kommentar zum Zustand des Kapitalismus im 20. Jahrhundert“, sinnierte der „Motivationssprecher“ Jordan Belfort, als er auf sein Leben von Betrug, Sex und Drogen zurück blickte. Als Leiter der Brokerfirma Stratton Oakmont erleichterte er in den frühen 1990er Jahren Investoren um Hunderte Millionen Dollar. Nachdem ich Martin Scorseses Film The Wolf of Wall Street gesehen hatte, war ich fasziniert genug, um Belforts Memoiren zu lesen, auf denen das Drehbuch basiert. Ich habe eine Menge gelernt.
Die als „aufblasen und abladen“ bekannte Masche beispielsweise, durch die Belfort und seine Kollegen bei Stratton ihre illegalen Gewinne erzielten, wird in den Memoiren viel deutlicher als im Film. Die Technik funktioniert, indem man Aktien wertloser Unternehmen über Mittelsmänner aufkauft, in einem steigenden Markt an echte Investoren verkauft und sie dann komplett ablädt.
Nicht nur kleine Investoren wurden ruiniert. Auffällig ist die Gier und Leichtgläubigkeit der Reichen, denen die „jungen und dummen“ Verkäufer, die Belfort bevorzugt einstellte, denselben Müll verkauften. Belfort war offensichtlich ein höchst geschickter und in seinem Geschäft brillanter Quacksalber, bis er seine Urteilsfähigkeit durch Drogen ruinierte.
Belfort, der nach einem kurzen Gefängnisaufenthalt sein Erfolgselixier erneut verkaufte, behauptet, sich für sein Verhalten zu schämen, aber ich vermute, dass tief in seinem Innern die Verachtung für seine Opfer stärker ist als seine Reue. In einem kürzlich erschienenen Buch, Capitalism in the Twenty-First Century, beschreibt der Ökonom Thomas Piketty die Firma Stratton Oakmont als Beispiel für „Leistungsextremismus“ – den Höhepunkt eines hundert Jahre langen Wandels weg von der alten Ungleichheit durch ererbten Reichtum und diskreten Lebensstil hin zu einer neuen Ungleichheit, die durch hohe Boni und ausschweifenden Konsum gekennzeichnet wird.
„Quelle jeden Betrugs ist die Gier“
Belfort ist als perverser Robin Hood beschrieben worden, der die Reichen beraubt, um sich selbst und seinen Kumpanen zu geben. Die Reichen waren die Mitglieder der protestantischen Elite des alten Geldes, die ihre Fähigkeiten verloren hatten, auf ihr Geld aufzupassen, und es daher zu Recht an durchtriebene – meist jüdische – Emporkömmlinge verloren, die unmoralisch genug waren, sich einfach zu bedienen. Aber Stratton Oakmonts Veruntreuungen waren an der Wall Street keine Ausnahme. Als ich einen guten Freund, der 20 Jahre lang Regulierer bei der SEC war, zum Ausmaß des Betrugs befragte, antwortete er: „Ich habe ihn als allgegenwärtig erlebt. Das System macht es einem einfach zu leicht, und die menschliche Natur spielt auf beiden Seiten zusammen. Die Quelle jeden Betrugs ist die Gier.“
Der Wolf der Wall Street war ein Raubtier, aber dies trifft auch auf all diese ehrenhaften Investmentbanken zu, die von ihnen verkaufte Produkte gleichzeitig leer verkauften, und die Geschäftsbanken, die Hypotheken an nicht kreditwürdige Schuldner vergaben und dann neu gebündelt als Wertpapiere mit hoher Bonität verkauften. Sie alle waren Wölfe im Schafspelz.
Ein vernünftiges Bankensystem erfüllt zwei Funktionen: sich um das Geld der Anleger zu kümmern, und Sparer sowie Investoren in für beide Seiten profitable Geschäftsbeziehung miteinander zu bringen. Ersparnisse werden Banken im Vertrauen übertragen, dass diese sie nicht stehlen, und eine solche Verwahrung hat ihren Preis. Die Geschäfte, die Banken zwischen Kreditgebern und -nehmer vermitteln, sind das Lebensblut moderner Volkswirtschaften – und eine riskante Arbeit, für die Banker eine gute Bezahlung verdienen. Aber jegliches Geld, das Banker über die Vergütung für eine grundlegende Dienstleistung hinaus verdienen, ist in den Worten des ehemaligen britischen Regulierers Adair Turner „sozialer Abfall“, früher auch „Wucher“ genannt.
Derivate verhalten sich wie Viren
Nicht das Ausmaß des Finanzsystems sollte uns alarmieren, sondern seine Konzentration und Vernetzung. In Großbritannien vereinen die fünf größten Banken einen immer größeren Anteil des Bankkapitals auf sich. In der grundlegenden Wirtschaftstheorie ist bekannt, dass exzessive Profite eine direkte Folge von konzentriertem Eigentum sind.
Die Banken sind durch starke Verbindungen vernetzt. Diese Verbindungen können, wie in der Wall Street oder der Londoner City, örtlich sein. Aber durch die Entwicklung der Derivate wurden sie global. Derivate sollten ursprünglich durch Risikostreuung die Stabilität des Bankensystems verbessern. Statt dessen steigern sie die Anfälligkeit des Systems, indem sie Risiken über einen viel größeren Raum hinweg korrelieren.
Andrew Haldane von der Bank of England und des Biologen Robert May schreiben in einer Studie, dass sich Derivate wie Viren verhalten. Finanzingenieure und Händler teilten dieselben Annahmen über die von ihnen eingegangen Risiken. Als sich diese Annahmen als falsch heraus stellten, wurde das gesamte Finanzsystem anfällig für Infektionen.
Die Lösung liegt in der Vereinfachung
Konzentration und Vernetzung verstärken sich gegenseitig. Zwei Drittel des jüngsten Bilanzwachstums der britischen Banken besteht nicht aus Forderungen zwischen Banken und Unternehmen außerhalb des Finanzsektors, sondern aus internen Forderungen zwischen Banken – ein klarer Fall von Geld, das durch Geld geschaffen wurde.
Reformer wollen die Boni der Banker begrenzen, Schutzwände zwischen den Abteilungen der Banken errichten und, radikaler noch, den Anteil einzelner Banken am Gesamtbankenvermögen einschränken. Aber die einzige dauerhafte Lösung besteht in der Vereinfachung des Finanzsystems. Haldane und May schreiben: „Exzessive Homogenität innerhalb eines Finanzsystems – alle Banken tun dieselben Dinge – kann das Risiko für jede einzelne Bank verringern, vergrößert aber die Gefahr, dass das Gesamtsystem kollabiert.“ Solange Banken Handelsgewinne erzielen können, werden sie weiterhin über den Absicherungsbedarf von Nichtbanken hinaus Derivate auflegen und so redundante Produkte erzeugen, deren einzige Funktion darin besteht, ihren Erfindern und Verkäufern Gewinne zu bescheren.
Wie Derivate eingeschränkt werden können, ist heute das wichtigste Thema der Bankenreform, und die Suche nach Lösungen sollte sich an der Erkenntnis orientieren, dass die Ökonomie keine Naturwissenschaft ist. Um mit May zu sprechen: „Die Wahrscheinlichkeit für das Auftreten eines Jahrhundertsturms wird nicht dadurch größer, dass Menschen denken, sie würde es.“
In den Finanzmärkten hingegen hängen die Wahrscheinlichkeiten sehr wohl davon ab, was Menschen denken. Je weniger sie denken müssen, desto besser. Jordan Belfort hatte teilweise recht: Diejenigen, die im Finanzwesen arbeiten, sollten nicht zu schlau sein.
Aus dem Englischen von Harald Eckhoff
Copyright: Project Syndicate, 2014.
www.project-syndicate.org