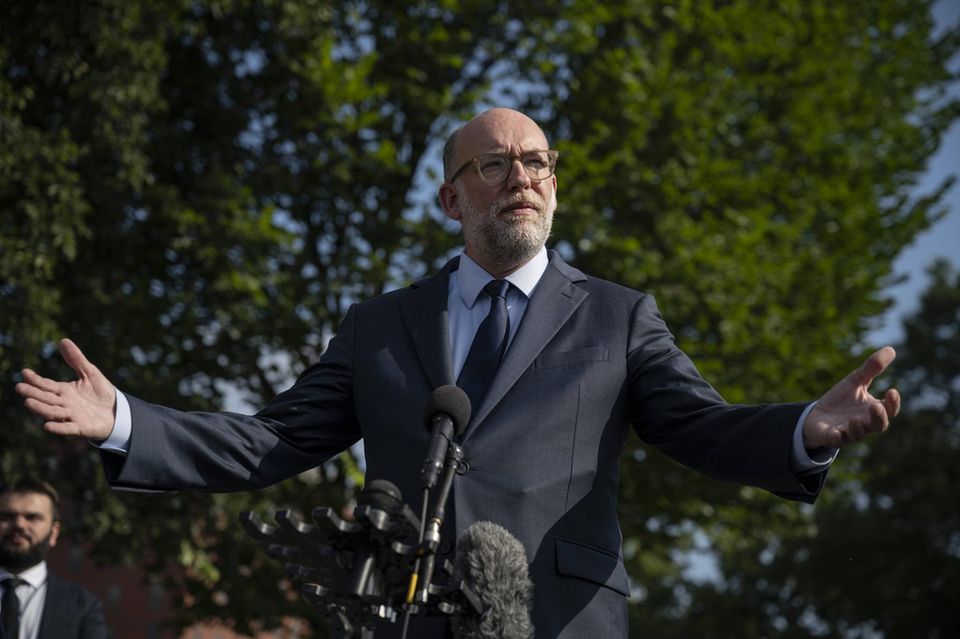Als in der New Yorker Finanzwelt die Hölle losbricht, ist John Pierpont Morgan mit Gott beschäftigt. Es ist der 17. Oktober 1907, und Morgan, damals wohl mächtigster Geschäftsmann der Vereinigten Staaten, hält sich seit zwei Wochen in Richmond, Virginia, auf. Als einer von 1000 Delegierten nimmt er an der Generalversammlung der Episkopalkirche teil. Er ist in einem komfortablen Haus einer Tabakdynastie untergekommen, in dem er Glaubensbrüder empfängt und über Gebetsordnungen berät, wenn er nicht gerade an einer der Veranstaltungen in Richmonds Kirchen teilnimmt.
Der Banker, ein kräftiger Mann mit eng stehenden Augen und einem markanten Schnurrbart, ist im gleichen Jahr 70 geworden – und hat eigentlich bereits begonnen, sich aus den täglichen Geschäften seines Hauses J. P. Morgan & Company zurückzuziehen. Für die kommenden drei Wochen aber steht ihm ein Kampf bevor, der ihm keine Zeit lassen wird, auch nur eine Nacht durchzuschlafen. Morgan soll es mit einer der größten Finanzkrisen in der Geschichte seines Landes zu tun bekommen. Sie wird Tausende Firmen in die Pleite treiben, die Arbeitslosenrate im Land mehr als verdoppeln und die Industrieproduktion der USA um elf Prozent drücken.