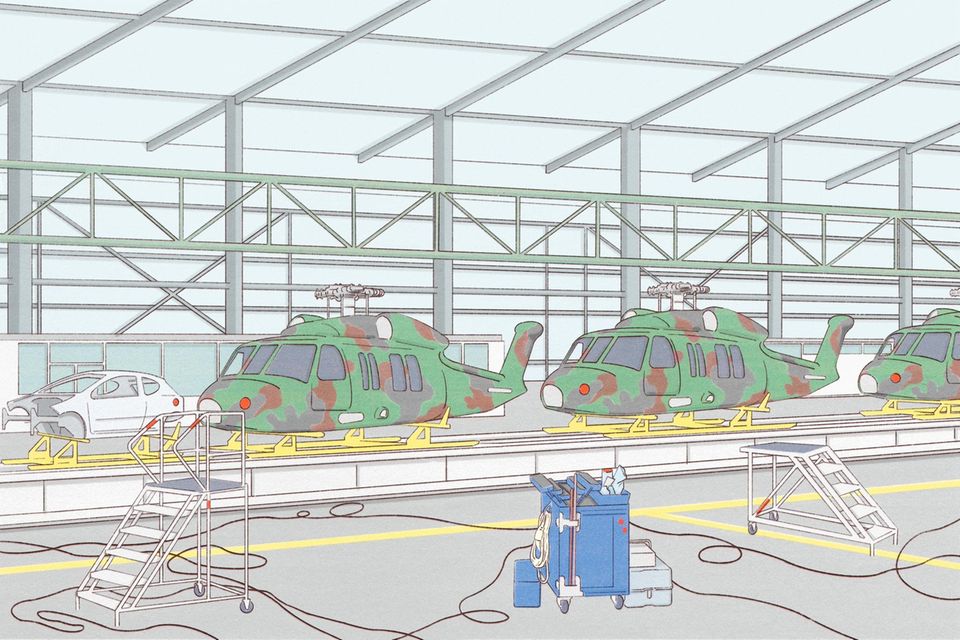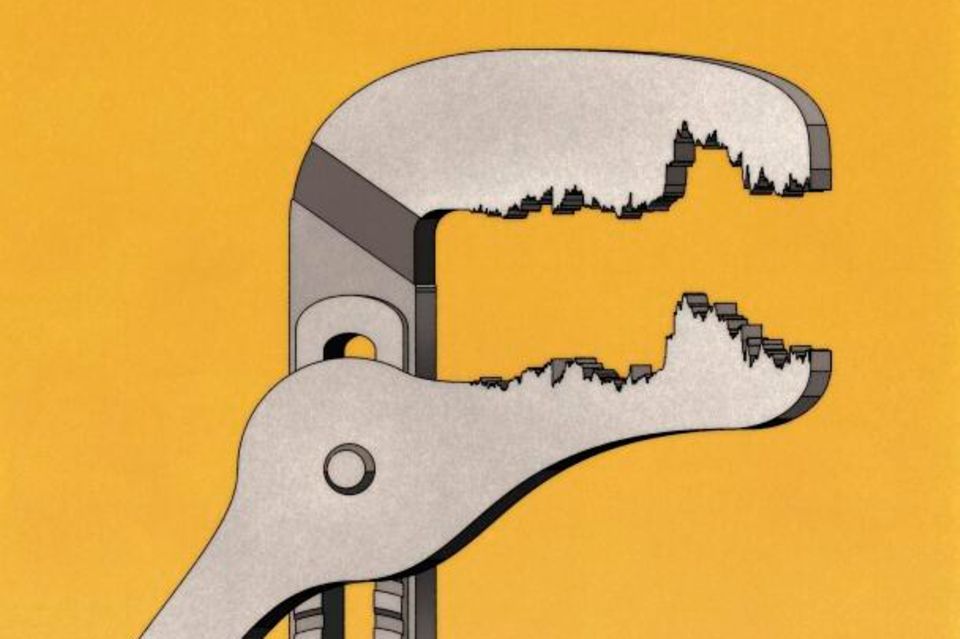Behavioral-Finance-Professor Oscar Stolper von der Universität Marburg leitet aus den realen Handelsdaten von Banken typische Muster ab, wie Anleger in Marktkrisen reagieren. Hier verrät er, wie sehr die Psychologie an der Börse die Geldanlage bestimmt.
Capital: Herr Stolper, wie ruhig sind Privatanleger zuletzt geblieben, als die Finanzmärkte wild schwankten?
OSCAR STOLPER: Grundsätzlich wissen wir, dass Anleger in Krisenphasen häufig nicht ganz rational handeln. Emotionen spielen immer eine große Rolle beim Anlegen, wie Angst, Reue oder Stolz. Sie beeinflussen das Handeln zumindest ganz stark mit, nicht nur die Fundamentaldaten. Und in Krisenzeiten wird die Rolle der Emotionen noch größer.
Weil dann die Angst überwiegt?
Wir haben uns in Studien angesehen, was bei einem Kursrutsch passiert. Erleiden Anleger Kursverluste, dann fragen sie sich: Kann ich die Verluste überhaupt tragen? Will ich das? Auch in der Anlageberatung wird immer die Frage nach der persönlichen Risikobereitschaft gestellt, und zwar unabhängig von der Vermögensaufstellung und vom Einkommen. Es geht darum, wie lange ein Anleger nachts noch ruhig schlafen kann, wenn sich sein Kapital verringert. Wird er schon bei zehn Prozent nervös oder erst bei 20 Prozent? Aber es ist eine sehr theoretische Frage. Viele Privatanleger erleben jetzt zum ersten Mal, was es heißt, einen Papierverlust zu erleiden.
Und wie reagieren sie darauf?
Es gibt zwei Möglichkeiten: Entweder lasse ich den Papierverlust einen Papierverlust sein. Oder ich verwandle ihn in einen realen Verlust, indem ich die Papiere abstoße. Weil ich fürchte, dass der Kurs morgen noch tiefer fällt. Viele Anleger realisieren die Verluste tatsächlich, das liegt an unserer Verlustaversion: Wir bewerten entstandene Verluste viel stärker als Gewinne in der gleichen Größenordnung. Verluste treiben uns Schweißperlen auf die Stirn, wir bewerten sie tendenziell über. Deshalb neigen wir dazu, Papiere dann kopflos zu verkaufen. Und es fällt uns deutlich schwerer, an unserem langfristigen Spar- und Anlageplan festzuhalten.
Passiert das wirklich oft?
Es passiert leider oft auf niedrigem Kursniveau, oder sogar auf dem Tiefpunkt des Marktes. Das Problem ist, dass wir dann an der darauffolgenden Kurserholung nicht mehr teilnehmen. Das Timing, also der richtige Ein- und Ausstieg im Markt, gelingt uns meist nicht. Die Folgen der Verlustaversion treten in solchen Börsenphasen deutlich zutage. Und besonders neuere Anleger waren sehr verwöhnt durch die steigenden Kurse zuvor. Viele erlebten im Frühjahr den ersten richtigen Kursrutsch.
Dabei hofft die Branche gerade auf die Jüngeren und dass sie langfristig im Kapitalmarkt investiert bleiben.
Die ganz Jungen haben noch nicht so viel Geld, es könnte daher plausibel sein, dass die schiere Höhe des investierten Kapitals eine Rolle spielt und viele cool blieben. Denn bei 5 Euro ist die Risikobereitschaft eine andere als bei 5000 Euro. Nichtsdestotrotz stellen wir aber grundsätzlich keine Generationenunterschiede fest. Wir haben zum Beispiel die Depotdaten von Partnerbanken in Marktkrisen anonymisiert ausgewertet, also die realen Entscheidungen der Anleger, und können daraus Muster erkennen: Man merkt keine Unterschiede zwischen den Generationen. Außer, dass Jüngere generell etwas risikobereiter sind, also mehr Risikoappetit haben. Ältere tendieren eher dazu, ihre Scherflein ins Trockene zu bringen – und zwar losgelöst von der Summe, mit der sie schon investiert sind.
Spielt die Erfahrung dabei eine Rolle?
Die Lebenserfahrung spielt schon eine Rolle, würde ich sagen. An der Investmenterfahrung hängt es aber nicht. Im Durchschnitt werden Anleger sogar risikofreudiger, wenn sie viel Investmenterfahrung haben. Aber der Risikoappetit nimmt generell mit dem Lebensalter ab, das ist ein stabiler Zusammenhang. Wir sehen also keine neue, völlig andere, Anlegergeneration.
Dann machen alle dieselben Fehler in unruhigen Zeiten?
Ja, Gewinne werden tendenziell zu früh realisiert. Es gibt ein paar Prozent Plus und schon nehmen viele die Kursgewinne mit. Das ist nicht vorteilhaft für die langfristige Rendite. Kursverluste werden dagegen häufig überbewertet, besonders in Krisen. Dann wollen viele lieber zu den Einstiegskursen und der schwarzen Null zurück und verkaufen sofort. Wir beobachten außerdem, dass in Krisenzeiten der Heimatfokus zunimmt, wir führen dies auf eine Flucht ins Vertraute zurück, die „flight to familiartity“. Internationale Aktien werden dann übervorsichtig beurteilt und am ehesten abgestoßen. Die Papiere des Heimatmarktes wirken vertrauter. Aber das ist eine Kompetenzillusion, denn es ist in aller Regel nicht so, als hätte man bei ihnen wirklich einen Informationsvorsprung.
Aktuell kaufen viele Großinvestoren und Privatanleger europäische Aktien. Ist das ein Fehler?
Es kann sein, dass die Renditeaussichten in Europa auf absehbare Zeit besser sind. Aber man weiß es nicht. Ich würde jedenfalls niemandem raten: Geh raus aus dem MSCI World und zu hundert Prozent rein in den Eurostoxx. Das Wichtigste bleibt eine breite Diversifikation – daran ändert sich nichts. Wir konnten aber eindrucksvoll beobachten, wie sich das Muster in den vergangenen zehn Boomjahren verschoben hat: Zuvor waren Dax-Werte wie Siemens, Allianz und die Autobauer die häufigsten Einzelaktien in deutschen Depots. Der Heimatbias lag bei rund 80 Prozent der wertgewichteten Bestände im Depot. Dieser Anteil ist 2024 erstmals unter 50 Prozent gerutscht. Zuletzt waren die Tech-Aktien von Apple, Nvidia und Co. die beliebtesten Aktien. Wie sich das nun erneut verschieben wird, müssen wir abwarten.
Der Anstieg des Dax lässt darauf schließen, dass die Flucht in heimische Aktien eingesetzt hat.
Wenn der Dax einen Rekord nach dem anderen hinlegt, bedeutet das aber nicht automatisch, dass bei deutschen Kleinanlegern die Korken knallen: Denn der Rückgang der Heimatinvestments zugunsten der Technologiewerte, den wir zuvor gesehen haben, hat dazu geführt, dass die Papiere der Daxunternehmen immer stärker in ausländischer Hand sind. Die Zahl der Dax-Holdings in den Privatanlegerdepots ist dagegen immer kleiner geworden. Die großen Gewinne machen deutsche Anleger deshalb nicht – die Rücksetzer der US-Aktien schlagen bei ihnen meist stärker durch.