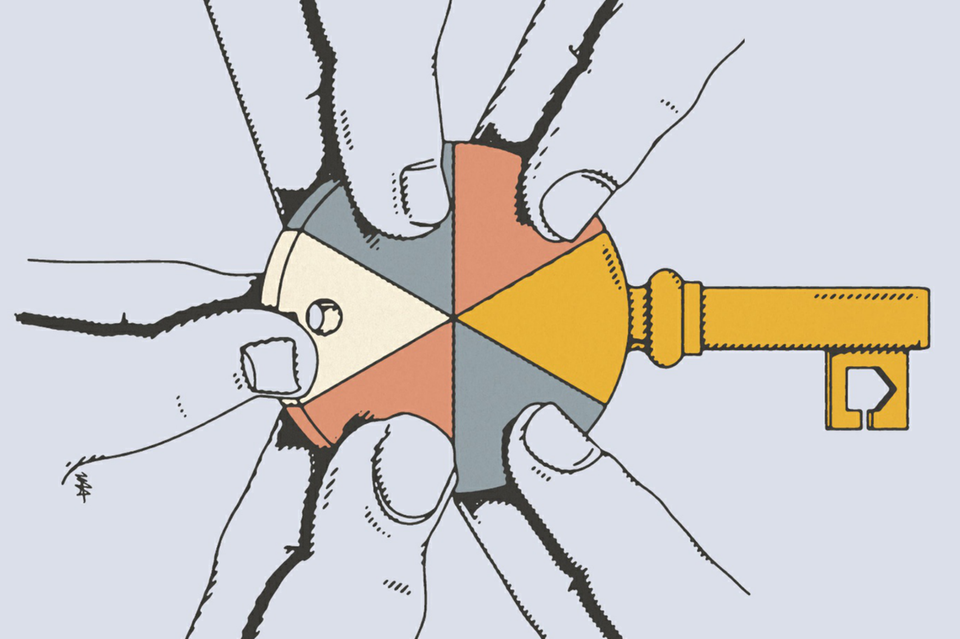Andreas Rettig ist seit 2015 kaufmännischer Geschäftsleiter des Zweitligisten FC St. Pauli. Von 2013 bis 2015 war er Co-Geschäftsführer der DFL. Zuvor arbeitete Rettig, der zu den vehementesten Kritikern von branchenfremden Investoren im Fußball zählt, als Manager des SC Freiburg, des 1. FC Köln und des FC Augsburg
Capital: In den nächsten Wochen will die DFL entscheiden, ob es für den Unternehmer Martin Kind eine Ausnahme von der 50+1-Regel gibt und er Hannover 96 komplett übernehmen darf. Was erwarten Sie von der Entscheidung?
Rettig: Bei allen Entscheidungen zur 50+1-Regel geht es um richtungweisende Fragen, die massiven Einfluss auf den Sport haben. Im Fall von Herrn Kind wird das Ligapräsidium die Frage klären müssen, ob er mehr als 20 Jahre den Fußballsport des Muttervereins ununterbrochen und erheblich gefördert hat – so wie es die Satzung der DFL als Voraussetzung für eine Ausnahmeregelung verlangt. Bei der Beurteilung der erheblichen Förderung scheint es unterschiedliche Ansichten zu geben.
Nach Ihrer Ansicht ist die Zukunft der 50+1-Regel keine juristische oder europarechtliche Frage, sondern eine rein sportpolitische, über die alleine die Vereine und die DFL zu entscheiden haben. Warum?
Zunächst bleibt festzuhalten, dass sich die Clubs wiederholt klar für diese Regel ausgesprochen haben. Die Grundproblematik besteht darin, dass Rechtsvorschriften nicht eins zu eins auf den Profifußball übertragen werden können. Nehmen Sie stellvertretend das Arbeitsrecht. Danach dürfte eine kalendermäßige Befristung des Arbeitsvertrages eines Angestellten maximal zwei Jahre umfassen. Außerdem benötigt auch der FC Bayern München 17 Spielgegner, um den Wettbewerb absolvieren zu können. In der freien Wirtschaft kämpfen Unternehmen dagegen eher darum, eine Monopolstellung zu erreichen.
Was wäre das Problem für die Vereine, wenn 50+1 fällt?
Dann würde die Jagd nach dem wirtschaftlich potentesten Investor losgehen. Ein Rattenrennen beginnt. Da das Budget zu großen Teilen den sportlichen Erfolg beeinflusst, käme es nicht mehr so sehr auf sportliche Konzepte, Managementqualitäten und die Unterstützung der Fans an. Stattdessen würde der Erfolg nur noch erkauft und die Romantik, dass der Kleine den Großen schlagen kann, auf der Strecke bleiben. Die Bundesligatabelle würde zur Forbes-Tabelle mutieren. Auch wäre eine ungehemmte Kapitalzufuhr aus womöglich nicht immer nachvollziehbaren Quellen ein Angriff auf die Integrität des Wettbewerbs. Und alle Wachstumspotenziale würden Investoren zufließen und möglicherweise den Klubs verloren gehen.
Welche Folgen erwarten Sie für die Fans?
Zunächst würde die Identifikation erheblich leiden. Mitgliedsbeiträge und Eintrittsgelder würden weniger bedeutsam, es ist nicht mehr „mein“ Verein, da Mitbestimmung und Teilhabe auf der Strecke bleiben. Darunter würde auch die Stimmung leiden. Ticketpreise würden steigen, wie wir es in England bereits sehen. Der Volkssport Fußball und das Stadion als Begegnungsstätte, in dem es noch zu einer Durchmischung aller Einkommensklassen kommt, würden an Bedeutung verlieren. Der Investorenfußball zieht eine emotionale Entfremdung nach sich.
Ihre Befürchtungen werden ja nur dann eintreten, wenn sich bei einem Ende von 50+1 jede Menge branchenfremde Geldgeber im deutschen Fußball breit machen würden. Glauben Sie, dass das tatsächlich passieren würde? Das Interesse potenzieller Investoren ist doch eher gering...
Das sehe ich anders. Es ist so viel Geld im Markt, das nach Anlagemöglichkeiten sucht.
Wir stehen vor der Frage, ob der – vermeintlichen – Erhöhung der Wettbewerbsfähigkeit Vorrang vor der gesellschaftspolitischen Bedeutung des Fußballs eingeräumt werden soll.
Andreas Rettig
Die 50+1-Kritiker argumentieren, dass die Bundesliga ohne Geld von Investoren im internationalen Wettbewerb zurückfällt – etwa im Vergleich mit den englischen Clubs und in den europäischen Vereinswettbewerben. Überzeugt Sie das nicht?
Nein. Der Spieler Neymar, der kürzlich für 222 Mio. Euro von Barcelona nach Paris gewechselt ist, wäre auch bei einem Angebot von 250 Mio. Euro nicht in die Bundesliga gewechselt. Dann hätte ein Staatsfonds oder Oligarch eben 300 Mio. Euro investiert, um ihn zu bekommen. Wettbewerber, die nicht wirtschaftlich agieren müssen, sind so nicht zu schlagen. Wir stehen vor der Frage, ob der – vermeintlichen – Erhöhung der Wettbewerbsfähigkeit Vorrang vor der gesellschaftspolitischen Bedeutung des Fußballs eingeräumt werden soll.
Noch mal England: Dort ist die Meisterschaft ja ziemlich spannend, in den vergangenen Jahren gab es verschiedene Meister – auch weil Investoren Geld in verschiedene Clubs stecken. Könnte ein Ende von 50+1 nicht dazu führen, dass der FC Bayern München potentere Herausforderer bekommt und damit auch die Bundesliga attraktiver wird?
Auch hier folge ich Ihnen nicht. Manchester City ist mit dem exorbitanten Mitteleinsatz von rund 250 Mio. Euro der Konkurrenz wirtschaftlich und sportlich bereits enteilt. Sollten in Deutschland die Schleusen für Investoren geöffnet werden, würde zudem der FC Bayern immer mehr Gelder generieren als alle anderen Wettbewerber. Es würde sich alles um die Investorengelder nach oben verschieben. Das Delta zur Konkurrenz würde bleiben.
Statt einer Abschaffung der 50+1-Regel wäre auch eine Reform denkbar, bei der es strikte Auflagen für Investoren gibt – etwa Mindesthaltefristen, damit Anteile an Clubs nicht ständig wechseln. Ist das ein möglicher Kompromiss?
Über eine Modifizierung nachzudenken, ohne 50+1 infrage zu stellen, kann ein Weg sein. Mir fehlt hier jedoch der Glaube, dass wir einen Weg finden, der allen Seiten gerecht wird.
Was würde der FC St. Pauli machen, wenn die 50+1-Regel abgeschafft würde?
Wir gehen auch weiterhin den St.-Pauli-Weg der Mitbestimmung und Teilhabe unserer Mitglieder. Dann müssten wir halt kreativ sein und zur Not kleinere Brötchen backen. Aber auch die können schmecken.