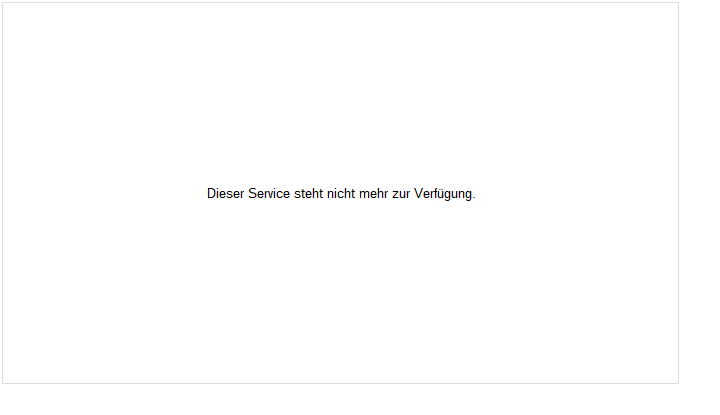Seit zwei Jahren taucht das Gerücht im Frankfurter Finanzviertel mit der schönen Regelmäßigkeit der S-Bahn-Linie S1 auf: Deutsche Bank und Commerzbank wollen angeblich fusionieren. Mal stammt die Nachricht aus den Hochhäusern der Kreditinstitute selbst, mal streut es die liebe Konkurrenz. In den vergangenen Wochen aber tröpfelte es vor allem aus dem Bundesfinanzministerium in der Berliner Wilhelmstraße und einigen angrenzenden Gemächern im Regierungsbezirk Mitte.
Spricht man den Aufsichtsratschef der Deutschen Bank, Paul Achleitner, auf diese politischen Signale an, reagiert der Österreicher im branchentypischen Denglisch mitunter leicht gereizt: „Jaja, Berlin ist supportive, ich weiß.“ Soll heißen: Seit Neuestem unterstützt die Politik das, was sie lange Zeit abgelehnt hat: die Fusion der beiden größten Kreditinstitute der Republik.
Wobei „unterstützen“ das falsche Wort ist. Es sind die pure Angst und Sorge, die in Berlin umgehen. Das Horrorszenario sieht so aus: Im laufenden Jahr rutscht die Weltwirtschaft in eine tiefe Rezession, und die Exportnation Deutschland leidet. Die „fetten Jahre“ (Bundesfinanzminister Olaf Scholz, SPD) sind erst einmal vorbei – und die Banken müssen wieder einen größeren Teil ihrer Kredite abschreiben. Gleichzeitig brechen ihre Einnahmen, vor allem im volatilen Investmentbanking, erheblich ein. Ihre Hoffnung auf eine Zinswende verfliegt. Für die Deutsche Bank hieße das: Sie bekommt so heftigen Gegenwind an den Finanzmärkten, dass aus ihrer erhofften Stabilisierung wieder nichts wird. Helfen könnte in diesem Szenario nur eine Notfusion mit der Commerzbank, um wenigstens in Deutschland selbst später wieder durchzustarten.
Doch für die Bank braut sich schon kurzfristig Ungemach zusammen. Am 1. Februar legte das Kreditinstitut seine Zahlen für das vierte Quartal und damit das Gesamtjahr 2018 vor. Zwar hat die Bank 2018 mehr als 340 Mio. Euro Jahresgewinn erzielt – der erste Überschuss seit 2014. Doch die Aussichten sind mau: die Konjunktur schwächelt und die herbeigesehnte Zinswende lässt weiter auf sich warten. Zudem trüben sich bei allen Großbanken die Geschäfte gerade im Investmentbanking derzeit dramatisch ein, der Wertpapierhandel sowie das Geschäft mit Aktien und Anleiheplatzierungen gingen im vierten Quartal um 20 Prozent zurück. Und Besserung ist auch für das laufende Quartal nicht in Sicht.
Die Deutsche Bank trifft dies mit ihrer niedrigen Profitabilität härter als Wettbewerber – weshalb sich ihr Aktienkurs 2018 schlechter entwickelt hat als die Kurse der Konkurrenz. Nicht von ungefähr sind ihre Nachranganleihen, ein wichtiger Indikator für die Kapitalstärke von Banken, seit Monaten im freien Fall. Was die Politik auch deshalb ventiliert, könnte man unter die Überschrift setzen: „Zurück zur alten Rolle der Deutschen Bank in Deutschland“. Aus der deutschen Industrie ertönen ähnliche Stimmen, in der Spitze des BDI war die Zukunft der Deutschen Bank vor der Jahreswende mal wieder Thema.
Was Kritiker einer möglichen Fusion oft vergessen: Die Re-Germanisierung des Instituts, die viele fordern, schreitet bereits rasch voran. Ein Zusammenschluss mit der Commerzbank würde diesen Prozess nur beschleunigen:
- Die Deutsche Bank gehört wieder mehrheitlich deutschen Aktionären, vor fünf Jahren war das ganz anders. Der chinesische Großaktionär HNA Group zieht sich zurück, der Streubesitz steigt. Das Scheichtum Katar stockt seine Beteiligung vorerst wohl doch nicht auf, wie spekuliert wurde. Und der größte Einzeleigentümer – der US-Fondsriese Blackrock – mischt sich als passiver Investor nur in Ausnahmen ein. Da der Bund noch gut 15 Prozent der Commerzbank hält, würde die Deutsche Bank nach einer Fusion wieder deutsch bis in die Knochen.
- Deutsche Manager dominieren den Vorstand wie in früheren Zeiten. Nur drei Ausländer sitzen dort noch, ihr Einfluss gilt als gering. Bank-Chef Christian Sewing und sein Vize Karl von Rohr bilden „enge Bande“ mit Aufsichtsratschef Achleitner, wie es in Frankfurt heißt. Dahinter rangiert in der internen Hackordnung der neue Finanzchef James von Moltke. Der zweite Vize der Bank und Leiter des weltweiten Investmentbank-Geschäfts, der Südafrikaner Garth Ritchie, spielt bei strategischen Diskussionen nach Meinung von Insidern keine entscheidende Rolle.
Spielernaturen wie die früheren Top-Manager Anshu Jain, Michele Faissola oder Colin Fan findet man nicht mehr in der Führungsetage. In den vergangenen zehn Jahren haben 36 Manager aus den beiden obersten Führungsebenen das Institut verlassen. Im heutigen Vorstand sitzt nur noch ein Banker, der schon vor fünf Jahren Mitglied des Gremiums war: Risikovorstand Stuart Lewis. - Vorbei die Zeiten, als die Deutsche Bank mit zwei Stimmen sprach – aus London und aus Frankfurt. Unter Kommunikationschef Jörg Eigendorf ist es gelungen, das Außenbild der Bank wieder zentral aus den Doppeltürmen an der Taunusanlage zu steuern. Die angelsächsischen Investmentbanker, die früher ihre eigenen Kanäle zur Presse pflegten, tauchen immer weniger mit ihren Interpretationen in der Öffentlichkeit auf. Die internen Kämpfe, die es immer noch gibt, dringen deshalb nicht mehr nach außen wie in früheren Jahren.
- Die knappe Hälfte der Mitarbeiter der Bank (42.000 von weltweit 97.000) arbeiten in Deutschland. Zwei Drittel aller Filialen und Niederlassungen (1452 von insgesamt 2242) betreibt das Institut bei uns. Der Brexit treibt in den nächsten Monaten weitere Mitarbeiter von London nach Frankfurt. Das dichte Filialnetz in Europa (und zum Teil in Asien) hat die Bank in den vergangenen Jahren bereits erheblich ausgedünnt. Dieser Prozess geht weiter und stärkt das relative Gewicht Deutschlands im Konzern.
- Das Geschäftsvolumen in den USA und in Großbritannien hat sich seit 2016 fast um ein Drittel reduziert – von 14,4 auf 10,1 Mrd. Euro. In Deutschland gingen die Erträge vor Risikovorsorge dagegen nur um eine gute halbe Milliarde zurück. Die Deutsche Bank macht also verhältnismäßig mehr Geschäft in Deutschland (und von Deutschland aus). Dahinter verbirgt sich vor allem, aber nicht nur, die schwache Entwicklung des Investmentbankings.
Nun lautet die entscheidende Frage: „Stimmt die Strategie? Oder verfolgt die Bank immer noch Ziele, die kaum miteinander zu vereinbaren sind?“ So fasst ein ehemaliger Top-Manager des Instituts die Kernfrage für die Bank zusammen. Sein Argument: Die Deutsche Bank sei in vielen Bereichen immer noch zu groß (und damit zu teuer), um profitabel zu sein; und gleichzeitig mit ihrer Konzentration auf den relativ kleinen, margenarmen deutschen Markt zu schwach, um jemals wieder an frühere Erfolge im Investmentbanking anzuknüpfen.
Wenn man diese Entwicklung, die in vielen Bereichen sehr ähnlich für die Commerzbank gilt, konsequent zu Ende denkt, landet man fast zwangsläufig bei der Idee einer Fusion: Für mehr als eine Großbank ist in Deutschland in Zeiten von Nullzinsen womöglich kein Platz mehr. Für die Mitarbeiter wäre das eine bittere Nachricht – auf die fast 150.000 Beschäftigten der beiden Institute (knapp 50.000 bei der Commerzbank) käme ein massiver Stellenabbau zu.
Dieser müsste sogar umso härter ausfallen, wenn man auf der anderen Seite die Risiken einer Fusion in Rechnung stellt: Kreditausfälle, die im Abschwung deutlich ansteigen dürften, und ein riesiger Liquiditätsüberhang, mit dem sich keine vernünftigen Zinserlöse erzielen lassen. „Es ist kaum möglich, diese Fusion Investoren als vorteilhaft zu verkaufen“, argumentiert ein Frankfurter Fondsmanager. „Ob die Summe aus zwei Teilen mehr wert wäre, ist fraglich; dass die Summe riskanter werden wird, ist indes sicher.“
Aber bei einer Fusion geht es ja auch nicht um ein Wünsch-dir-was, sondern um eine Notoperation. Umso verstörender wirken auf Beobachter in Frankfurt und Berlin mitunter die öffentlichen Auftritte der Deutsche-Bank-Spitze. CEO Sewing neige dazu, die Lage schönzureden, sagt ein früherer Top-Manager der Bank. Sewings Spruch zum Amtsantritt, die Bank brauche wieder mehr „Jägermentalität“, sei komplett verfehlt gewesen: „Viele träumen davon, endlich wieder weltweit in die Offensive zu kommen. Doch die Bedingungen dafür sind nicht da.“
Die zweifelhaften globalen Ambitionen hängen womöglich auch am Aufsichtsrat. Auf der Kapitalseite sind nur zwei von zehn Mitgliedern Deutsche: der Steuerberater und Jurist Stefan Simon und der frühere PwC-Chef Norbert Winkeljohann. Die meisten Vertreter der Aktionäre kommen aus der angelsächsischen Großfinanz – von der langjährigen Morgan-Stanley-Bankerin Mayree Carroll Clark bis zum ehemaligen Merrill-Lynch-Chef John Thain.
Verärgerung in Berlin
Ähnlich wie Achleitner selbst, der bei Goldman Sachs groß wurde, denken die Aufsichtsräte im Zweifel in den Kategorien des globalen Geschäfts. Weder die deutschen Regulatoren noch die Bundesregierung können mit den Angelsachsen viel anfangen. Es gibt so gut wie keinen Austausch mit ihnen. Für Achleitner folgt daraus der schöne Nebeneffekt, dass ihn auch viele seiner ärgsten Kritiker für „gegenwärtig unersetzbar“ halten. Niemand könnte seine Aufgabe im Aufsichtsrat aus dem Stand übernehmen.
Das ändert nichts daran, dass man sich in Berlin zunehmend ungläubig die Augen reibt. Der Österreicher habe „den Bezug zur Realität verloren“, sagt einer, der nah an den Kalkülen der Spitze im Bundesfinanzministerium dran ist. Achleitner verweigere sich jedem ernsten Dialog über die Lage. Sorgen macht man sich nicht allein wegen der fehlenden Aussicht auf Gewinne, sondern auch wegen der Geldwäschevorwürfe gegen die Bank.
Als „komplett verfehlt“ sieht man den jüngsten Schachzug Achleitners an. Der Aufsichtsratschef hatte sich zwischen den Jahren in einem Interview in der „Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung“ („FAS“) präsentiert, das nur eine einzige harte Aussage enthielt: Er werde auf keinen Fall zurücktreten, sondern bis 2022 im Amt bleiben. Bloß, dass niemand bis dato (anders als früher) offen seinen Rücktritt verlangt hatte.
Zwischen Mitte Mai und Anfang Dezember tauschten sich Vertreter des Ministeriums mit Managern der Bank insgesamt 23-mal aus. Zu den Gesprächspartnern zählte auch der Verdi-Vertreter im Aufsichtsrat. Das wirkt schon wie Intensivbetreuung. Man äußere sich generell nicht zu einzelnen Kredit-instituten, teilte das Ministerium auf eine parlamentarische Anfrage mit. Gleichwohl stehe man „wirtschaftlich sinnvollen Optionen offen gegenüber“, heißt es in der Antwort. Klarer kann man seine Vorstellung nicht kommunizieren.
Den richtigen Fachmann für eine so komplexe Operation, an deren Ende Deutsche und Commerzbank doch fusionieren würden, hat sich Scholz schon mal als Staatssekretär ins Haus geholt: den früheren Deutschland-Chef der Investmentbank Goldman Sachs Jörg Kukies. Mit Fusionen und großen Deals kennt sich der Mann aus.