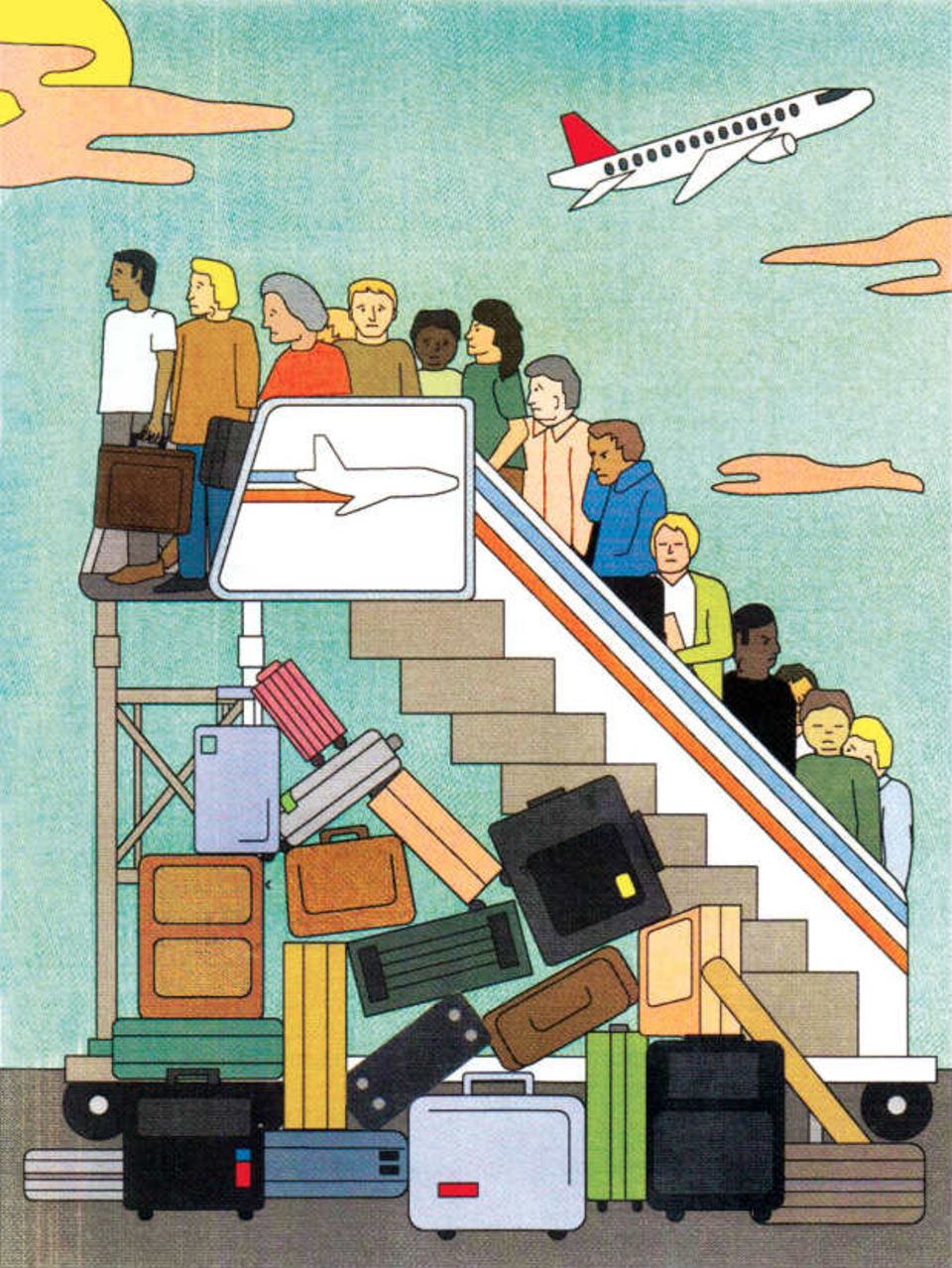Massive Panne im europäischen Flugverkehr: Bis zu 30000 Flüge sollen am Dienstag vom Systemausfall bei Eurocontrol betroffen sein - mitten im Reiseverkehr nach Ostern. Das Ausmaß ist ungewöhnlich, doch grundsätzlich sind Verzögerungen und Wartezeiten längst die Normalität an deutschen Flughäfen - Capital hat erst kürzlich in diesem Beitrag (aus der Ausgabe 02/2018) das Chaos an deutschen Flughäfen aufgezeigt:
Die Maschine nach Spanien sollte vor einer Dreiviertelstunde abfliegen. Aber noch immer steht sie am Terminal des Hamburger Helmut-Schmidt-Flughafens, weil die letzten Passagiere noch nicht an Bord sind. Als sie dann endlich abdockt, meldet sich der Pilot. „Liebe Gäste, wir bitten Sie um Entschuldigung, aber wir können nichts dafür – das geht hier seit Monaten so, Verspätungen und Chaos sind chronisch am Hamburger Flughafen.“
Drinnen im Terminalgebäude drängen sich Menschenmassen vor den Sicherheitskontrollen. Bis in die Abfertigungshallen hinein reichen die Schlangen. Bei mehr als einer Stunde Wartezeit werden manche Passagiere ihren Flug wohl nicht mehr erreichen. Der Flughafen schiebt das Chaos auf einen einzigen kaputten Scanner. Es wirkt wenig glaubwürdig, denn nur sechs Tage später stauen sich die Passagiere erneut vor der Sicherheitskontrolle.
Wer in Hamburg abfliegt, braucht starke Nerven und jede Menge Geduld. Wer hier landet, erst recht, denn am Gepäckband kann es vorkommen, dass man länger auf den Koffer warten muss, als der Flug gedauert hat. Am 5. August etwa vergingen satte drei Stunden, ehe Reisende aus dem italienischen Bergamo ihr Gepäck in der Hand hielten. Am selben Tag bekamen auch die Passagiere eines Vueling-Flugs vom Vortag ihre Koffer, die der gestresste Pilot kurzerhand wieder mit in die Luft genommen hatte, weil die Gepäckabfertiger die Maschine nicht rechtzeitig entladen hatten.
Dass es hier und da mal hakt, kommt vor in der Luftfahrt. Aber was sich seit Monaten auf einigen deutschen Flughäfen abspielt, ist absurd. Immer wieder müssen Passagiere stundenlang vor Gepäckbändern oder Sicherheitsschleusen ausharren, viele verpassen deswegen ihre Flüge oder Anschlusszüge. Vor den Ankunftshallen stapeln sich die Kofferberge. Besonders chaotisch ging es zuletzt in Hamburg, Düsseldorf und Berlin-Tegel zu, aber auch in Bremen, Stuttgart oder Köln/Bonn häufen sich Probleme.
Flüche am Telefon
Was ist nur los auf Deutschlands Flughäfen? Das fragen sich Millionen genervte Passagiere. Einer von ihnen ist Michael Müller. Fast eine Stunde lang wartete der Berliner Bürgermeister kürzlich in Tegel auf sein Gepäck, dann zückte er sein Handy – und rief Flughafenchef Engelbert Lütke Daldrup an. Der soll mit einem derben Schimpfwort reagiert haben.
Klaus Leßlauer kann erklären, woran es hapert: „Wir haben chronischen Personalmangel bei den Bodenverkehrsdiensten.“ Der 54-jährige Berliner, graues Haar, grauer Schnurrbart, gebaut wie Arnold Schwarzenegger, ist seit 27 Jahren Gepäckabfertiger in Tegel. „Ich würde heute niemandem mehr raten, diesen Beruf zu ergreifen“, sagt Leßlauer. Dabei hat er selbst lange Zeit seine Arbeit geliebt. Gerade weil sie so hart ist.
Angefangen hat Leßlauer im sogenannten Keller: der Sortieranlage von Tegel. Ein Förderband transportiert die Koffer vom Check-in hierher. Die Arbeiter müssen sie herunterhieven, den Gepäckzettel ablesen und die Koffer in die für die jeweiligen Flüge vorgesehenen Anhänger wuchten. Der Prozess läuft weitgehend manuell ab, eine automatische Sortieranlage gibt es nicht. Weil Tegel nach der Fertigstellung des neuen Flughafens BER geschlossen werden soll, wurde hier schon lange nicht mehr in die Gepäckabfertigung investiert.
Mit Anhängerzügen voller Koffer fahren die Verlader – ausschließlich Männer, denn Frauen verbietet die Berufsgenossenschaft diese Arbeit – zum Flugzeug. „Und dort“, sagt Leßlauer, „muss dann einer von uns ins Loch.“ Dieses Loch ist die Ladeluke im Bauch des Flugzeugs. Nur 1,40 Meter hoch ist sie bei der Boeing 737. Leßlauer muss knien, während er 20 oder auch mal 30 Kilo schwere Koffer von der Rampe nimmt und sie in den Frachtraum stapelt. Dabei hockt er sich tief hin und streckt das Rückgrat kerzengerade durch. „Sonst geht man ganz schnell kaputt.“
Wenn das Flugzeug im Winter aus großer Höhe kommt, hat es im Loch schon mal 20 Grad unter null. Im Sommer, wenn die Maschine länger auf dem Rollfeld steht, kann es plus 50 Grad heiß werden.
Es gäbe eine Alternative zur Plackerei im Loch: Container, die schon im Keller mit Koffern bepackt und dann über Rampen in den Flugzeugbauch befördert werden. Aber viele Airlines sparen sich die Container aus Kostengründen.
„Ich brauche kein Fitnessstudio“, sagt Leßlauer lächelnd. Er mag seine Arbeit. Doch in letzter Zeit wird sie ihm zu viel. Als er anfing, bestanden die Crews meist aus vier Männern, die einander bei den härtesten Jobs abwechselten. Heute sind sie nur noch zu zweit, allenfalls zu dritt. Zugleich müssen sie schneller fertig werden mit dem Turnaround, dem Ent- und Beladen der Maschine, denn viele Fluggesellschaften kürzen ihre Standzeiten am Terminal, um die Flugzeuge besser auszulasten. Und während die Crews früher zwischen zwei Turn-arounds oft eine Viertelstunde Pause hatten, kommen jetzt ständig neue Aufträge rein, klagt Leßlauer: „Mittlerweile muss man an einem durchschnittlichen Tag acht bis zwölf Tonnen heben.“
Preiskampf in der Luft
Für diese Arbeitsverdichtung gibt es einen Grund: den Preisdruck bei den Flugtickets. Von Jahr zu Jahr vermelden Deutschlands Flughäfen neue Passagierrekorde: In Tegel etwa ist die Zahl der Reisenden seit 2005 um 85 Prozent gestiegen. Um immer mehr Kunden mit immer billigeren Tickets anlocken zu können, haben viele Airlines die Margen der Gepäckabfertiger drastisch gedrückt.
Zugute kommt ihnen die Liberalisierung der Bodenverkehrsdienstleistungen. Jahrzehntelang war die Abfertigung am Airport eine staatliche Aufgabe. Menschen wie Leßlauer wurden nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst bezahlt. Erst 1996 beschloss die EU eine Verordnung, die nach und nach immer mehr Anbieter zuließ. Heute schließen die Fluggesellschaften für die Abfertigung ihrer Maschinen Verträge mit diesen Dienstleistern ab. Die versuchen, ihre Konkurrenten zu unterbieten, um den Zuschlag zu kriegen.
Ausbaden müssen das zunächst die Verlader. Laut der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi sind ihre Löhne in den vergangenen Jahren um etwa 20 Prozent gefallen, in Berlin sogar um 30 Prozent. Viele kämen nur noch auf 1500 Euro brutto im Monat, sagt Tarifsekretärin Katharina Wesenick. „Für das Geld sind die meisten Leute nicht mehr bereit, unter diesen Bedingungen zu arbeiten.“ Erst recht nicht im boomenden deutschen Arbeitsmarkt.
Inzwischen trifft der Wettlauf nach unten auch die Passagiere, etwa am Gepäckband in Tegel. Dort wechselte Air Berlin im Frühjahr den Bodenabfertiger: von Leßlauers Arbeitgeber Wisag zum billigeren Konkurrenten Aeroground. Der aber hatte in Tegel kaum Erfahrung. Das Ergebnis: monatelanges Kofferchaos.
Neun Euro Stundenlohn
In Hamburg zahlte der Bodendienstleister HAM Ground, der mit der Wisag konkurriert, bis vor Kurzem Einstiegslöhne von neun Euro pro Stunde. Die Folge war eine Personalnot, die so weit eskalierte, dass HAM-Ground-Mitarbeiter im Sommer mehr als 100 Gefährdungsanzeigen stellten. Sie warnten, wegen andauernder Überlastung könne es zu Gesundheitsproblemen oder Qualitätseinbußen kommen. Als es dann Krankmeldungen hagelte, war der Gepäckstau unvermeidlich.
Wie der Hamburger FDP-Politiker Michael Kruse mit einer Anfrage beim Senat herausfand, vergingen im Januar 2017 im Schnitt 21 Minuten, bis alle Gepäckstücke einer Maschine auf dem Band waren. Im Juli waren es bereits 32 Minuten. Kruse ist überzeugter Liberaler. „Aber wenn die Vergütung für diese anstrengenden Tätigkeiten nur knapp über dem Mindestlohn liegt, dann reicht das nicht, um in Zeiten von Fachkräftemangel den notwendigen Personalbedarf sicherzustellen.“
Flughafenchef Michael Eggenschwiler (dessen Gehalt 2016 von 367.448 auf 409.135 Euro stieg) wies jede Verantwortung für die Überlastungsanzeigen von sich – obwohl die HAM Ground eine Tochter des Flughafens ist. Der hat 2016 immerhin 53 Mio. Euro Profit gemacht, bei knapp 300 Mio. Euro Umsatz.
„Die Flughäfen investieren Millionen in Einkaufswelten, Restaurants und Parkplätze – dorthin, wo sie viel Geld verdienen“, sagt der Luftfahrtexperte Gerald Wissel, Chef des Hamburger Beratungshauses Airborne Consulting. „Aber bei den Pflichtleistungen wie Gepäck oder Bodenabfertigung geht es vor allem ums Auslagern und Kostensparen.“
Immerhin hat HAM Ground die Löhne zuletzt stufenweise erhöht. Dennoch ist die Personalsuche mühsam. Und weil die vorgeschriebene Sicherheitsüberprüfung im Schnitt länger als einen Monat dauert, springen in der Zwischenzeit viele Bewerber wieder ab.
150 Gefährdungsanzeigen stellten im August Mitarbeiter des Personencheck-Dienstleisters am Flughafen Düsseldorf. Für eine „fehlerfreie Kontrolle und absolute Luftsicherheit“ könnten sie wegen der „hohen psychischen Belastung“ nicht mehr garantieren, warnten die Beschäftigten der Firma Kötter. Im Sommer fehlten dem Flughafen zeitweise 70 bis 100 von 400 Kontrolleuren. Vom Rest meldeten sich bis zu 20 Prozent krank. Vor dem Security-Check stauten sich Menschenmassen. Teils kam es zu tumultartigen Szenen, als Passagiere ihre Flüge verpassten.
Wie kann es sein, dass jeder fünfte Security-Beschäftigte krank ist? „Gesunde Betriebe haben selten mehr als fünf Prozent Krankenstand“, sagt der zuständige Gewerkschaftssekretär Özay Tarim. „Aber bei der Firma Kötter war die Belastung so hoch, dass die Leute nicht mehr konnten. Wir haben die Bundespolizei und Kötter Monate vorher gewarnt, dass das Personal nicht reichen wird.“
Fluggäste zu kontrollieren ist Aufgabe des Staates. Doch die Bundespolizei überträgt sie gern an private Sicherheitsdienstleister wie Kötter oder Securitas, um Kosten zu sparen. Der Preis ist bei der Vergabe oft entscheidend. Entsprechend knapp kalkulieren die Auftragnehmer den Personaleinsatz. Als in Düsseldorf dann Passagierzahlen und Krankmeldungen höher ausfielen als erwartet, bekam Kötter die Lage nicht mehr in den Griff.
Die Bundespolizei hat nun weitere Sicherheitsfirmen für den Rhein-Ruhr-Airport angeheuert, bei Bedarf setzt sie auch eigene Leute ein. Die Lage hat sich entspannt. Aber vielleicht liegt das auch nur daran, dass im Winter weniger Menschen fliegen.
Capital hat die Geschäftsführer von Berlin-Tegel, Hamburg und Düsseldorf um Stellungnahme zu den Zuständen auf ihren Flughäfen gebeten. Alle drei Airport-Chefs lehnten ein Gespräch ab – und verwiesen auf den Flughafenverband ADV. Dessen Hauptgeschäftsführer Ralph Beisel wiegelt erst einmal ab. Laut Umfragen sei die Zufriedenheit der Passagiere deutscher Flughäfen „weiter auf hohem Niveau“: 80 Prozent der Reisenden hätten sich zufrieden oder sehr zufrieden geäußert. Viele Gepäckprobleme seien „Einzelereignisse“ oder bloß Resultat von Umbaumaßnahmen auf den Flughäfen.
Allerdings räumt selbst der Lobbyist Beisel ein: „Die Passagier- und Handgepäckkontrollen sind manchmal ein großes Ärgernis.“ Es dürfe nicht passieren, „dass ein Dienstleister nicht in der Lage ist, in Spitzenzeiten ausreichend Personal hinzustellen, sodass das System kollabiert“. Die Flughäfen seien dafür nicht verantwortlich. Aber: „Wir bieten der Bundespolizei an, diese Tätigkeit in die Verantwortlichkeit der Flughäfen zu überführen. Wir haben vielleicht ein besseres Händchen bei der Steuerung privater Dienstleister.“
Schwierige Personalsuche
Doch das stimmt nur bedingt. In Bremen etwa gab es bis Anfang 2017 kaum Ärger mit dem Gepäck. Dann lagerte der Flughafen die Abfertigung in eine neue Tochtergesellschaft mit niedrigeren Löhnen aus. 40 von 140 Mitarbeitern gingen in dieser Zeit oder wurden gekündigt. Das Ergebnis: Dauerchaos zur Hauptreisezeit. Mehrmals mussten Passagiere stundenlang am Band warten. Einmal hob eine Maschine sogar ohne das Gros der Koffer ab, weil sie niemand rechtzeitig einräumte. Vorübergehend war die Personalnot so groß, dass sich Feuerwehrleute und Verwaltungsmitarbeiter an die Gepäckbänder stellen mussten. Wie die Gewerbeaufsicht herausfand, erhielten einige Aushilfen nicht einmal die vorgeschriebene Sicherheitseinweisung fürs Rollfeld.
Dass sich die Lage bessert, ist kaum zu erwarten. Experten sagen weiter steigende Passagierzahlen voraus, und viele Gepäckdienstleister finden kaum noch Personal. Wie der Luftfahrtexperte Heinrich Großbongardt erzählt, versuchen auf mehreren Flughäfen derzeit sogar Gepäckabfertiger, zur Security zu wechseln, denn da gibt es mehr Geld, und es ist warm und trocken.
Klaus Leßlauer hat eine Idee. „Der Staat müsste Standards für Bodenverkehrsdienste festlegen“, sagt der Abfertiger. „Jede Airline muss pro Turnaround einen vernünftigen Mindestbetrag bezahlen und bekommt dafür eine vernünftige Leistung.“ Die Dienstleister könnten dann mehr Personal bezahlen, die Airlines bekämen ihre Frachträume schneller leer, die Passagiere müssten nicht so lange am Gepäckband warten. Hat nur einen Haken: Die Flugtickets würden teurer.
Die Geschichte erschien erstmals in Capital Ausgabe 02/2018