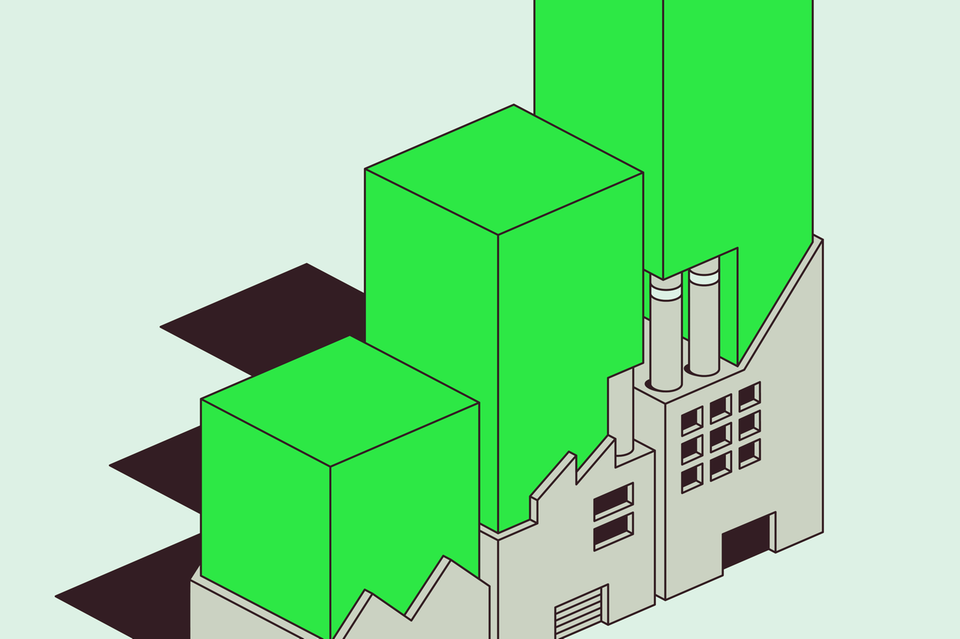Herr Brende, der IWF hat „sehr schmerzhafte“ Aussichten für die Weltwirtschaft prognostiziert und warnt, dass die „dunkelsten Stunden“ noch kommen. Stimmen Sie dem zu?
Wir stehen sehr wahrscheinlich vor einer globalen Rezession. Die letzte große Volkswirtschaft, die in eine Rezession gerät, werden vermutlich die Vereinigten Staaten sein. Wir haben eine Herausforderung: Die Erholung nach der Pandemie wurde unterbrochen – und schon diese Erholung war ja nicht einfach. Es hat die Staaten in aller Welt 15 Billionen US-Dollar gekostet, die Wirtschaft zu stimulieren, um eine Depression zu vermeiden. Die Hilfspakete haben in vielen Ländern die fiskalischen Muskeln geschwächt, um die kommende Rezession zu bekämpfen. Und bei einer rekordhohen Inflation ist es auch nicht einfach, die Wirtschaft zu stimulieren und die Nachfrage zu stützen.
Im Mai sagten Sie: „Es geht uns schlechter als letztes Jahr, aber besser als nächstes Jahr“ – halten Sie immer noch an diesem Satz fest?
Ja – das nächste Jahr wird für die Weltwirtschaft schwieriger werden als 2022.
Viele fürchten eine Stagflation. Für wie wahrscheinlich halten sie das Szenario?
Eine Stagflation ist möglich, wenn wir nicht die richtigen Maßnahmen ergreifen. Hohe Inflation, geringes Wachstum und hohe Arbeitslosigkeit sind ein giftiger Cocktail. Wir sollten die 70er-Jahre nicht wiederholen.
Tun die Regierungen genug?
Es ist verständlich, dass die Regierungen Menschen und Unternehmen in diesen schwierigen Zeiten unterstützen, aber es ist auch wichtig, die strukturellen Probleme anzugehen. In der Vergangenheit haben viele Regierungen die falschen Dinge getan. Wir haben uns zu lange auf den Energiepreis konzentriert. Natürlich ist der Preis wichtig, aber wir werden auch für die Sicherheit der Energieversorgung einen Aufpreis zahlen müssen. Ich glaube nicht, dass wir diesen Fehler noch einmal begehen werden. Wir haben ein Dreieck: Zugang zu Energie, Energiesicherheit und die Entkopplung von Energie und CO2-Emissionen.
Die CO2-Emissionen stehen derzeit in vielen Ländern leider nicht im Mittelpunkt.
Die Regierungen sollten diese Krise nutzen und den Umbau der Energieversorgung beschleunigen. Eine Krise ist auch eine Chance! Wenn man sich die Ölkrise in den frühen 1970er-Jahren anschaut, wurden als Reaktion die meisten Atomkraftwerke gebaut. Die Verbrennungsmotoren wurden deutlich sparsamer. Diese Art der Transformation kann Europa jetzt anpacken. Wir können eine Vorreiterrolle einnehmen.
Lassen Sie uns von der grünen Zukunft in die trübe Gegenwart zurückkehren. Welche Risiken sehen Sie neben der Energiesicherheit?
Die Entwicklungs- und Schwellenländer zahlen schon jetzt einen hohen Preis – wegen des starken Dollars, der steigenden Lebensmittel- und Energiepreise. Wir erleben zum ersten Mal seit Jahrzehnten einen Anstieg der Armut. Außerdem gibt es zu viele protektionistische Maßnahmen, die einen Teil des potenziellen künftigen Wachstums abschwächen könnten. Ich glaube nicht, dass es einen Aufschwung geben wird, ohne dass der Welthandel und Investitionen sich erholen. Diese waren drei Jahrzehnte lang der Motor für ein hohes Wachstum. Der Welthandel ist seit einiger Zeit schon im Wandel, das Schlagwort lautet „Near Shoring“ – und manches davon ist auch sinnvoll. Aber wenn man zu weit geht, den Freihandel aufgibt und seinen Nachbarn eher schaden will als ihn zu fördern, werden wir einen hohen Preis zahlen müssen.
Was können wir tun, um die Situation zu verbessern?
Ich denke, mit Russland werden wir kurzfristig keine Lösung finden. Wenn man sich die USA und China anschaut, ist die Entscheidung noch offen. Nach dem Parteitag in Peking und den Zwischenwahlen in den USA werden sich Joe Biden und Xi Jinping wahrscheinlich auf dem G-20-Gipfel in Bali treffen. Zwischen den beiden Supermächten wird es einen erbitterten Wettbewerb geben, vor allem bei neuen Technologien: Künstliche Intelligenz, Big Data und andere Durchbrüche. Aber trotz dieser intensiven Rivalität wird es Bereiche geben, in denen sie zusammenarbeiten. Sie haben ein Interesse daran, dass das Handelssystem stabil bleibt. Beide Länder stehen für fast die Hälfte der Weltwirtschaft, sie haben also gemeinsame Interessen.
Glauben Sie, dass China immer noch einen gewissen Einfluss auf Russland ausübt und sich einmischen könnte, wenn Moskau den Krieg in der Ukraine eskalieren lässt?
Das sind zwei Fragen: Sind sie besorgt? Und: Werden sie sich einmischen? Ich denke, wir alle – auch die Chinesen – sind besorgt über eine mögliche Eskalation in der Ukraine, insbesondere über nukleare Bedrohungen und den Einsatz von Massenvernichtungswaffen. China ist zudem besorgt über die Weltwirtschaft: Zum ersten Mal schrumpft die Zahl der Erwerbstätigen. Sie wollen unbedingt ihre Produktivität steigern. Protektionismus ist da schädlich, deshalb hoffe ich, dass die USA und China zusammenkommen werden. Ehrlich gesagt weiß ich nicht, wie viel Einfluss China auf Putin hat und ob es diesen Einfluss überhaupt nutzen würde.
Der Krieg in der Ukraine wurde als „Comeback der Geopolitik“ oder als „das Ende des Endes der Geschichte“ bezeichnet. Was halten Sie von diesen Begriffen?
Die Welt befindet sich derzeit zwischen zwei Ordnungen. Wir haben die alte Ordnung verloren und sind dabei, eine neue zu schaffen, aber wir wissen nicht genau, wie diese aussehen wird. Manche haben es den „Zweiten Kalten Krieg“ genannt. Das Hauptproblem ist aus meiner Sicht, dass das „Win-Win“-Denken in Frage gestellt wurde. Jahrzehntelang wurden die meisten Länder von einer einfachen Philosophie geleitet: Was für den anderen gut ist, ist auch gut für mich und umgekehrt. Und das hat unglaublich gut funktioniert: Von 1990 bis zur Pandemie im Jahr 2020 hat sich das globale BIP verdoppelt, der Welthandel stieg um das Drei- bis Vierfache. Die extreme Armut in der Welt ging von 40 auf 10 Prozent zurück. Die Globalisierung führte zu weniger Ungleichheit auf der Welt. Aber sie erhöhte gleichzeitig die Ungleichheit in einigen entwickelten Ländern. Nicht jedem Land ist es gelungen, den Wohlstand innerhalb seines Landes umzuverteilen. Natürlich bin ich voreingenommen, aber ich denke, die nordischen Länder sind gute Beispiele, wie das gelingen kann.
Aber wenn „Win-Win“ aus der Mode gekommen ist, heißt es doch nicht, dass dieses Prinzip nicht mehr funktioniert. Warum wird es in so vielen Ländern in Frage gestellt?
Der gesunde Menschenverstand ist nicht überall so gesund – also so weit verbreitet, fürchte ich. Deshalb tauchen die Muster der Vergangenheit wieder auf und manche Länder meinen, sie müssten ihr Territorium vergrößern.
Was bedeutet das für das Weltwirtschaftsforum? Ihre Organisation wurde auf dem Grundsatz der Zusammenarbeit aufgebaut, dass die Welt besser dran ist, wenn wir zusammenarbeiten.
Wir müssen dieses Prinzip noch stärker in den Vordergrund stellen! Das heißt nicht, dass das System nicht reformiert werden muss. Aber selbst in einer polarisierten und fragmentierten Welt gibt es Bereiche, in denen wir zusammenarbeiten können. Auf dem nächsten Treffen in Davos im Januar werden wir versuchen, die Bereiche zu identifizieren, in denen eine Zusammenarbeit zwischen Unternehmen und Regierungen sinnvoll ist. Und ich werde meine Stimme dafür erheben!
Welche Bereiche zum Beispiel?
Zunächst einmal der Klimawandel. China und die USA werden Wege finden müssen, um Mechanismen zur Kontrolle der Treibhausgasemissionen zu schaffen. Wenn die USA und China einige Standards setzen, wird auch der Rest der Welt diesem Beispiel folgen. In einer zersplitterten Welt denken die Menschen nur kurzfristig. Deshalb nimmt etwa die Zahl der kohlebefeuerten Kraftwerke zu.
Wird die russische Delegation nach Davos eingeladen werden?
Das hängt von den Russen ab, nicht von uns. Wenn Russland anfängt, sich wieder an das Völkerrecht, die UN-Charta und humanitäre Grundsätze zu halten, dann gibt es einen Weg zurück. Russland wird wieder dabei sein, wenn es sich an seine internationalen Verpflichtungen hält.
Das Weltwirtschaftsforum war oft eine Bühne für Frieden – nehmen wir das Treffen zwischen Nelson Mandela und William de Clerk im Jahr 1992, Israelis und Palästinenser haben sich in Davos getroffen. Könnten Sie sich eine Art von Gesprächen zwischen Russland und der Ukraine vorstellen?
Dafür könnte es später einen Weg geben, aber zunächst müssen die russischen Bombardierungen und Angriffe in der Ukraine aufhören. Auf dieser Grundlage könnte es einen Weg zum Frieden geben.
Europa hat gerade in Prag ein neues Format gestartet, die Europäische Politische Gemeinschaft. Europa präsentierte sich als geeint und stark. Auf der anderen Seite scheint Europa sehr verwundbar zu sein – wie sehen Sie die Rolle Europas?
Europa hat es in der Vergangenheit immer wieder geschafft, große Herausforderungen zu meistern, auch wenn die Aussichten nicht rosig waren. Nehmen Sie die europäische Schuldenkrise 2012, als die Eurozone um das Überleben des Euro kämpfte. Europa ist in vielerlei Hinsicht gestärkt aus dieser Krise hervorgegangen. Der Euro bleibt nach dem US-Dollar die stärkste Währung der Welt. Europa ist nach wie vor der größte Binnenmarkt der Welt mit 450 Millionen Menschen. Es ist einer der besten Orte zum Leben in der Welt. Außerdem zieht Europa immer noch Talente an; Europa ist und bleibt eine große Wirtschaftsmacht. Der Krieg in der Ukraine wird für Europa in den nächsten Jahren eine große Herausforderung darstellen, da wir besonders unter der Energiekrise leiden. Das birgt politische Risiken: Werden die Demokratien Europas in der Lage sein, mit dieser Krise umzugehen und verantwortungsvolle politische Antworten zu geben? Ich denke, bekommen wir hin. Europa wird gestärkt aus dieser Krise hervorgehen.