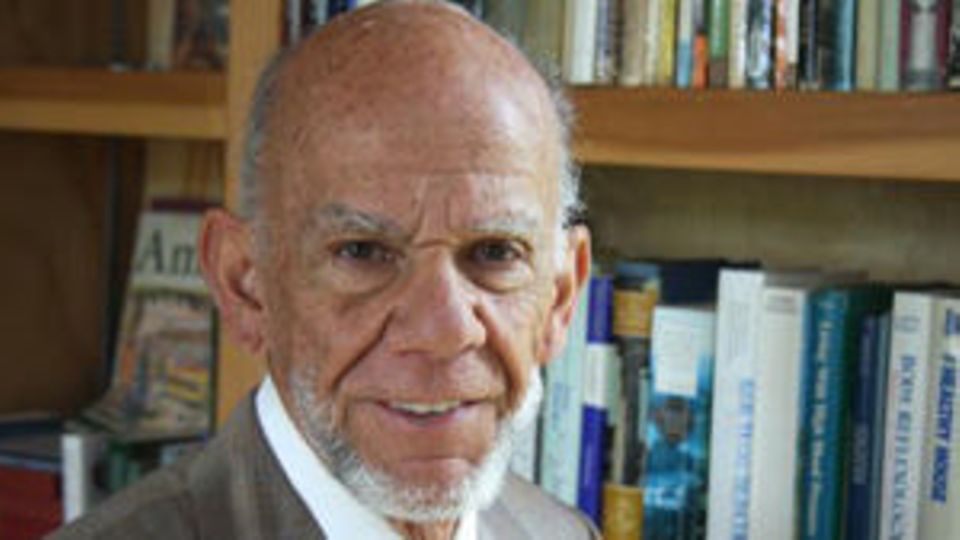Warum ist der Euro eigentlich so stark? Die Wirtschaft der Eurozone ist doch gerade erst aus der Rezession gekommen. Über dieser Frage brüten Experten, sie macht Europas politische und wirtschaftliche Entscheider nervös. Sie sollte übrigens auch die USA beschäftigen, denn ein Rückfall in die Rezession eines solch wichtigen Exportmarktes wie Europa würde auch die vorsichtige Erholung in den Vereinigten Staaten angreifen.
Obwohl die US-Wirtschaft seit September deutlich schneller gewachsen ist als die europäische, hat der Euro gegenüber dem Dollar um mehr als vier Prozent zugelegt. Während der Schuldenkrise hat der Euro seinen Wert ziemlich - manche würden sagen zu - gut gehalten, weil das Vertrauen in die deutschen Exporte die Gemeinschaftswährung zu einem sicheren Hafen gemacht hat. Doch die jüngsten Wertzuwächse sind schwerer zu erklären. Aus meiner Sicht liegen der gefährlichen Divergenz zwischen der Stärke des Euro und der Schwäche der europäischen Wirtschaft zwei Faktoren zu Grunde: Beide haben mit dysfunktionalen Institutionen zu tun.
Die erste ist die Bundesbank, deren ideologisch geprägte Geldpolitik die wirtschaftliche Erholung Europas immer wieder stört. Die Eurozone leidet aktuell an einer Disinflation und scheint von einer richtigen Deflation nur einen externen Schock weit entfernt zu sein. Dennoch sind die Märkte überzeugt davon, dass nach der Zinssenkung im November auf 0,25 Prozent die Bundesbank und ihre Verbündeten im EZB-Rat die Europäische Zentralbank an einer weiteren geldpolitischen Lockerung hindern werden. Die Vermutung, dass die EZB ihre anderen geldpolitischen Instrumente nicht einsetzen und auch keine neuen institutionalisieren wird, trägt zum weiteren Anstieg des Euro bei.
Ironischer Nebeneffekt
Die Bemühungen von Bundesbankpräsident Jens Weidmann und seiner Unterstützer im EZB-Rat, die Zinssenkung im November zu verhindern, haben den Euro weiter beflügelt – quasi als ironischer Nebeneffekt. So wurde schon der Boden für weitere geldpolitische Erleichterungen in der Zukunft bereitet - wenn der Widerstand der deutschen Industrie und der Bundesbank erlahmt sind.
Berücksichtigt werden muss ebenfalls, dass der Euro nicht nur gegenüber dem Dollar gewonnen hat, sondern auch gegenüber dem japanischen Yen in den letzten drei Monaten allein zehn Prozent zugelegt hat. Die japanische Zentralbank hat enorme Summen ins Geldsystem gepumpt - was in Europa wegen der EZB-Regeln und Deutschlands Widerstand gegen jedwede Regelanpassungen nicht möglich ist.
Der Euro-Anstieg beeinträchtigt europäische Exportindustrien wie etwa Autos, Stahl und Schiffe, die gegen japanische Hersteller antreten müssen. Im Oktober sank die Industrieproduktion im Vergleich zum September um 1,1 Prozent; im Vergleich zum Vorjahr blieb nur ein winziger Anstieg um 0,2 Prozent. Es muss etwas geschehen, um diesen Aderlass zu stoppen. Die Bundesbank scheint nicht zu verstehen, dass es deutlich besser für die EZB wäre, geldpolitische Erleichterung auf den Weg zu bringen, bevor ein richtiger Schaden eintritt als hinterher. Weidmann Telefon müsste doch unablässig klingeln, weil irritierte und besorgte Industriekapitäne bei ihm anrufen!
Prinzipienreiterei schadet dem Euro
Auch eine Art von Heuchelei trägt dazu bei, europäische Solidarität zu untergraben. Die Bundesbank wird nicht müde, Länder wie Italien und Spanien zu belehren, wie wichtig Kostensenkungen seien, um im globalem Wettbewerb besser zu bestehen und endlich durch Exporte wieder zu wachsen. Zur gleichen Zeit aber erschweren die deutschen Zentralbanker genau diese Aufgabenstellung, indem sie dem Euro-Anstieg Vorschub leisten. Im Vergleich zu den Wehwehchen, die das der deutschen Industrie zufügt, sind die Schmerzen in Europas ärmeren Ländern natürlich viel größer.
Die Bundesbank braucht dringend einen neuen und pragmatischeren Ansatz. Weidmann denkt zu stark in Regeln und nicht genug darüber nach, ob Europa die Konsequenzen dieser Regeln auch tragen kann. Klar, er hat in den großen geldpolitischen Entscheidungen wie der Zinssenkung im November und dem Anleihenkaufprogramm letztes Jahr den kürzeren ziehen müssen. Doch seine Weigerung hat unnötige Kosten und Mühen für Europa zur Folge gehabt.
Der zweite Grund für die künstliche Stärke des Euros ist die dysfunktionale US-Regierung. Wegen der monatelangen Haushaltsblockade im Kongress fiel die Fiskalpolitik als Stimulusgeber für die immer noch schwächelnde US-Wirtschaft quasi aus. Und so musste die Geldpolitik allein übernehmen. Eine Folge davon ist, dass die US-Zinsen noch niedriger sind als dass der Fall gewesen wäre, wenn der Kongress und die Obama-Administration sich auf mehr als nur den kleinsten gemeinsamen Nenner geeinigt hätten. Auf den Euro hatte dies einen ähnlichen Effekt wie Wachstumshormone. Ich bezweifele auch, dass - wie manche argumentieren - die Fed-Entscheidung ihre Wertpapierkäufe herunterzufahren am Ende den Euro schwächen. Zumindest in der Anfangsphase wird der Effekt zu klein sein, um einen Unterschied zu machen. Die Märkte sollten sich noch für einige Zeit auf einen starken Euro einstellen.
Merkel kann Umdenken anstoßen
Natürlich war es keine listige protektionistische Intrige des Kongress, die Regierung lahmzulegen, doch der Effekt bleibt der gleiche. Die politische Blockade in Washington hat negative ökonomische Konsequenzen in Europa. Leider haben Europas Politiker abgesehen von Beschwerden über wenig nachbarschaftliches Verhalten wenig in der Hand, um das Problem zu beheben.
Aber zumindest etwas gäbe es, was die deutsche Bundeskanzlerin tun könnte. Der Rückzug des deutschen EZB-Direktors Jörg Asmussen, der oft gemeinsam mit der Bundesbank im EZB-Rat abgestimmt hat, gibt der Kanzlerin eine Chance, einen deutschen Nachfolger vorzuschlagen, der keine institutionellen Ballast für seine Ansichten mit sich herumträgt. Das würde Weidmanns Isolation im EZB-Rat verstärken - er würde zum Außenseiter und verlöre den Status einer echten Alternative. Irgendwann würde er sein Verhalten anpassen oder das Risiko eingehen müssen, die Glaubwürdigkeit der Bundesbank in Deutschland oder Europa zu untergraben. Die deutsche Kanzlerin kann natürlich nicht den Bundesbankchef feuern, aber das müsste sie auch nicht, um trotzdem ein dringend notwendiges Umdenken bei der deutschen Notenbank einzuleiten.