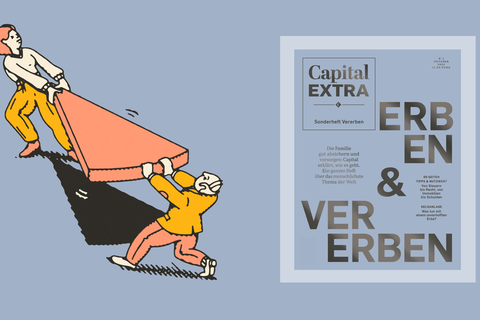Leuchtendes Grün in Reih und Glied, dazwischen Trockensteinmauern. Eine Eidechse huscht über den Weg. Bietigheim-Bissingen liegt im Stuttgarter Speckgürtel, Porsche hat hier einen Standort, der ehemalige Chef Wendelin Wiedeking seinen Wohnsitz. Die Stadt rühmt sich ihrer malerischen Weinberge. Viele Menschen gehen hier gern spazieren, genießen den Ausblick auf den Fluss, der sich durchs Tal schlängelt.
Die Weinberge sind das, was das Wort „Naherholungsgebiet“ bezeichnet und doch nicht zu fassen vermag: Ein Ort, der die Sorte Ruhe spendet, die auf dem Heimweg nicht schon wieder verflogen ist. Für manche Menschen ist der Weinberg aber auch Arbeitsplatz. Diese Menschen braucht der Weinberg zum Überleben. Denn ohne sie bröckelt er Stein für Stein dahin.
Einer dieser Menschen ist Sophie Roth. Es ist Mittwochmorgen, sieben Uhr, die Sonne hat es noch nicht über den Bietigheimer Brachberg geschafft, da strampelt Roth schon auf ihrem Fahrrad einen Schotterweg hinauf, der sie zu ihren Reben bringt. Sie hat ihren Freund dabei, ausreichend Wasser, ein paar Snacks und eine Motorsense.
Ein Sechstel weniger Anbaufläche bis 2030?
Roth ist 24 Jahre alt, hat Agrarwissenschaften studiert. Gerade macht sie eine Ausbildung zur Köchin und bewirtschaftet nebenbei einen Weinberg. Normalerweise rührt sie bis spät in die Nacht Soßen in einem Stuttgarter Sternerestaurant, heute hat sie frei und „entblättert“ Weinreben: Die Trauben müssen Licht bekommen, um süß zu werden – deshalb soll das Blätterwerk weg, das sie umgibt. „Aber nicht alles“, mahnt Roth, „sonst bekommen die Trauben Sonnenbrand.“
Roth ist jung, eine Frau, hat Lust, Wein anzubauen in der Steillage und damit eine Besonderheit in der Branche. Heinrich Morast vom Weinbauverband Württemberg beschreibt deren Situation im Gespräch mit ntv.de so: „Aufgrund des Strukturwandels steigen viele Winzer aus, und wenige rücken nach“. Man rechne damit, bis zum Jahr 2030 allein in Württemberg rund 20 Quadratkilometer an Weinbaufläche zu verlieren. Das wäre mehr als ein Sechstel dessen, was aktuell bewirtschaftet wird.
In Deutschland wuchs die Weinanbaufläche in den vergangenen Jahren laut Statistischem Bundesamt wieder leicht an. In Württemberg aber schrumpft sie, das zeigen Daten der Staatlichen Lehr- und Versuchsanstalt für Wein- und Obstbau (LVWO). Besonders in den Steillagen würden immer mehr Flächen brachgelegt, sagt der Weinbauverbandler Morast.
Die Topografie – das, was den Weinberg besonders macht – wird ihm zum Verhängnis. Weil sie die Probleme, die der Weinbau ohnehin hat, noch verschärft: den demografischen Wandel und den wirtschaftlichen Druck. Für viele ältere Winzer ist die Arbeit auf den abschüssigen Hängen irgendwann schlicht zu anstrengend und zu gefährlich. Zudem benötigen diese Flächen mehr Pflege, sind für Maschinen kaum zugänglich, was für die Betriebe bei gleichem Ertrag mehr Kosten bedeutet.
„Aus Jux einfach mal probieren“
Dabei sind die steilen Weinberge ein früher wirtschaftlicher Triumph des Menschen über die Natur: Schroffe Hänge zogen sich durch Flusstäler, Sonne ohne Ende, von der der Mensch aber nur wenig hatte. Er zähmte den Berg, indem er Steine aufeinanderstapelte, ihm nutzbare Fläche abtrotzte. Wie bei Flüssen, die der Mensch mit Wehren aufstaut, um sie schiffbar zu machen. Nur eben in einer höheren Frequenz: Manche Weinberge in Bietigheim-Bissingen kommen auf bis zu 20 Mauern. Jede Mauer ein neuer Absatz mit nutzbarer Fläche, meist nur ein bis drei Meter lang. Dann kommt schon die nächste Mauer, der nächste Absatz.
Die Treppen, die durch den Weinberg führen, die verschiedenen Absätze miteinander verbinden, sind meist nicht mehr als eine Reihe mehr oder weniger lockerer Steine. Als Sophie Roth bei ihren Reben ankommt, zieht sie deshalb ihre abgewetzten Nike Air aus und Arbeitsschuhe an. Sie wird stundenlang auf unebenem Boden stehen, ihre Füße werden schmerzen. Am Abend wird sie Muskelkater haben vom ganzen Auf und Ab.
Sie wollte das mit dem Weinberg „aus Jux einfach mal probieren“, sagt Roth im Gespräch mit ntv.de. Anwenden, was sie im Studium gelernt hat. „Und eigenen Wein haben, ist ja auch ganz geil“, schiebt sie hinterher. Über Kontakte fand sie einen Winzer, der ihr die Fläche verpachtete. Sie könne sich schon vorstellen, nach ihrer Ausbildung ein bisschen mehr Fläche zu bewirtschaften, sagt Roth. So als Nebenerwerb.
Nur: Viel zu erwerben gibt es da nicht, wenn man Philipp Ritz von der LVWO glaubt. Weinbau in der Steillage sei meist Liebhaberei, Familientradition oder Idealismus, sagt er ntv.de. Morast bestätigt: zu hoch die Produktionskosten für den Wein, zu hoch der Preisdruck. Es seien nicht genügend Menschen bereit, mehr für Wein aus Steillagen zu zahlen. Deshalb verwilderten immer mehr Weinberge.
Subventionen stützen die Mauern im Weinberg
Wenn ein Weinberg verfällt und verwildert, wenn niemand mehr mäht, Reben stutzt und Mauern repariert, schadet das anderen Winzer und Winzerinnen. Schädlinge und Pilzkrankheiten können sich besser ausbreiten und auf die umliegenden Flächen überspringen. Auch für Tiere wie die Eidechse schrumpft so der Lebensraum. Es stellt den Weinberg vor ein ernsthaftes Problem. Er ist Kulturlandschaft, die sich wirtschaftlich nicht mehr lohnt.
Deshalb zahlt das Land Baden-Württemberg Zuschüsse für Weinbau in Handarbeit – 3000 Euro pro Hektar und Jahr. Die Stadt Bietigheim-Bissingen stellt Geld bereit für Menschen, die in den Weinbergen Mauern reparieren oder verwilderte Flächen – nach eigener Aussage rund 50.000 Euro jährlich.
Roth findet das richtig. Der Weinbauverband wünscht sich eine Ausnahme vom Mindestlohn, hätte lieber, dass die Menschen an der Ladenkasse angemessene Preise zahlen für Wein aus deutschen Steillagen. Ritz sagt, wie in der gesamten Landwirtschaft verschleppten die Subventionen den Strukturwandel nur. Der stünde auch bei den vorhandenen Reben an: In Steillagen sei besonders viel Trollinger angepflanzt, die Sorte aber finde immer weniger Absatz, so Ritz: „Da hat man nie richtig reagiert.“
Quo vadis, Weinberg?
Was bleibt dem Weinberg? Womöglich verwandelt er sich stellenweise in eine Streuobstwiese, verstärkt in geschützte Rückzugsgebiete für Tiere und Pflanzen. Wenn die Sommer unerbittlicher werden und die Winter sanfter, mausert er sich vielleicht sogar zu einem Olivenhain. In Baden-Württemberg taucht hier und da die Idee auf, brachliegende Hänge mit Solarmodulen zu bestücken. Das aber ist aufwendig, obendrein sind Weinberge oft als Landschaftsschutzgebiet ausgewiesen.
Es ist 13 Uhr, auf dem Bietigheimer Brachberg knallt die Sonne mittlerweile erbarmungslos auf den Weinberg von Sophie Roth, auf die entblätterten Reben und die freigelegten Trauben. Der steile Hang ist gemäht – wildes Möhrenkraut, Schafgarbe und Weinberglauch liegen flach zwischen den Reben. Die Lavendelbüsche an den Seiten sind verschont geblieben. Überall auf Roths giftgrünen Socken sitzen kleine schwarze Kletten, auf ihrem verschwitzten Gesicht sitzt ein zufriedenes Lächeln.
Auf dem Rückweg halten Roth und ihr Freund plötzlich an. Am Wegesrand steht ein laminiertes Schild. „Weinberg zu verkaufen“ steht da. Preis: Verhandlungsbasis. Die beiden schauen sich an und fahren erst einmal weiter. Sollte Roth wirklich irgendwann mehr Wein produzieren wollen, an der verfügbaren Fläche wird es nicht scheitern.
Der Beitrag ist zuerst bei ntv.de erschienen. Das Nachrichtenportal gehört wie Capital zu RTL Deutschland.