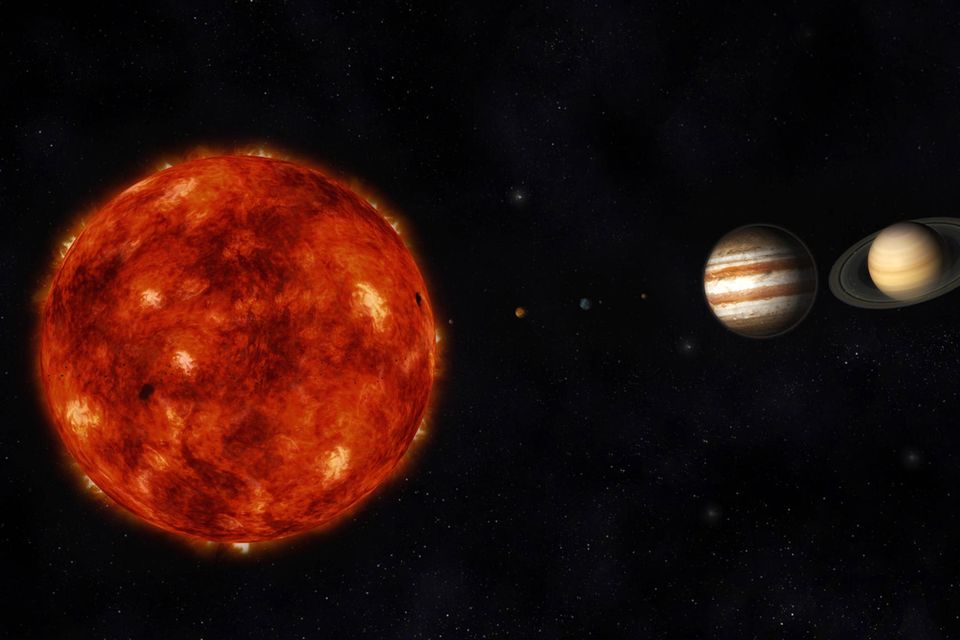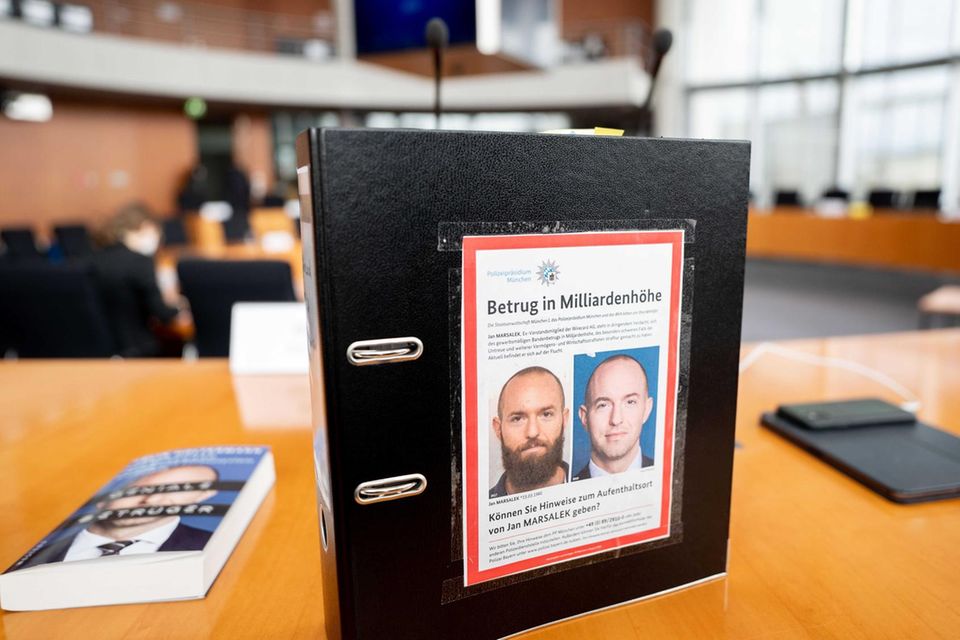5 Fakten über das Schaltjahr
2024 ist ein Jahr mit 366 Tagen. Das passiert alle vier Jahre, dann wird dem Kalender der 29. Februar hinzugefügt. Damit werden kleine Ungenauigkeiten des Kalenders gegenüber der Umlaufbahn der Erde um die Sonne ausgeglichen. Ausgenommen sind jedoch sogenannte Säkularjahre, also Jahre, die ein Jahrhundert abschließen – es sei denn, sie lassen sich durch 400 teilen. Deshalb gab es 2000 einen 29. Februar, 2100 wird hingegen kein Schaltjahr sein.
2020 konnten viele Berufstätige den zusätzlichen Tag an einem freien Samstag genießen. Der 29. Februar 2024 fällt hingegen auf einen Donnerstag und ist damit ein regulärer Arbeitstag. Wer im Schaltjahr auf einen „Überarbeitstag“ hofft, muss allerdings genau hinschauen. „Überstunden fallen nur an, wenn die vertraglich vereinbarte Wochen- oder Monatsarbeitszeit überschritten wird“, heißt es beim DGB Rechtsschutz.
Ob Feiertage auf einen Wochentag fallen oder nicht, hat durchaus Folgen für die Volkswirtschaft. Trotz des 29. Februar gibt es 2024 weniger Arbeitstage als im Vorjahr: 248,8 versus 249,4, wie das Statistische Bundesamt (Destatis) errechnet hat. Grund sind die für Arbeitnehmer günstigen Feiertage. So fällt Weihnachten mitten in die Woche. „Aber auch die Wochenenden liegen anders als 2023“, informierte die Statistikbehörde. „Im ersten Quartal 2024 gibt es trotz des Schaltjahres im bundesweiten Durchschnitt sogar 1,6 Arbeitstage weniger als im Vorjahresquartal, und zwar wegen der frühen Osterfeiertage.“ Dies dämpft laut Destatis die Entwicklung des Bruttoinlandsprodukts (BIP) im ersten Quartal. Denn es gelte die Faustregel: „Ein zusätzlicher Arbeitstag bedeutet im Schnitt einen Anstieg des BIP um etwa 0,1 Prozentpunkte.“
Bei Abonnements kommen Verbraucher im Februar in den Genuss eines zusätzlichen Tages, inklusive des Deutschlandtickets. Das ist nur fair, da der Monat ja ohnehin kürzer ist als alle anderen. Überall dort, wo bei Berechnungen ein Kalenderjahr zugrunde gelegt wird, gilt das 2024 für 366 Tage. „Sind Steuern tageweise zu entrichten, erfolgt die Berechnung nach Bruchteilen des Jahressatzes. In einem Schaltjahr sind es Dreihundertsechsundsechzigstel der Jahressteuer“, teilt der DGB Rechtsschutz mit. Der zusätzliche Tag kann demnach auch entscheidend sein, wenn es um die Berechnung von Fristen geht, etwa bei Kündigungen, Klagen oder auch Verjährung.
Unternehmen und Beschäftigte sollten bei Kündigungen oder befristeten Verträgen im Schaltjahr aufpassen. „Ist das zeitliche Ende eines Vertrages auf den 28. Februar festgelegt und wird der Arbeitnehmer am 29. Februar noch beschäftigt, tritt als gesetzliche Folge die Entfristung ein. Davon ist auszugehen, auch wenn sich Rechtsprechung dazu nicht finden lässt“, hieß es im Ratgeber der DGB Rechtsschutz zum Schaltjahr 2020. Auf Nachfrage teilte die DGB-Juristin mit, an der Rechtslage habe sich seitdem nichts geändert. Eine Kündigung zum 28. Februar sei wegen des falschen Beendigungsdatums hingegen nicht unwirksam. Dies würde vom Arbeitsgericht als reguläre Kündigung zum Monatsende interpretiert, also zum 29. Februar.