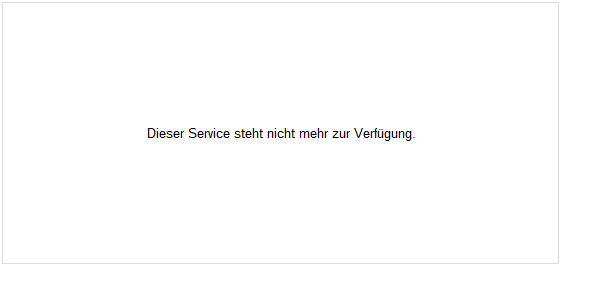Aufsichtsratsvergütung: erster Rückgang seit 2009
Die Vergütung für die Aufsichtsräte in den führenden börsennotierten Unternehmen ist erstmals seit dem Krisenjahr 2009 wieder zurückgegangen. Das geht aus einer Analyse der HKP Group hervor. Demnach sank die Vergütung der Chefkontrolleure im Jahr 2015 auf einen Durchschnittswert von 356.000 Euro. Das entspreche einem Rückgang von 8,7 Prozent gegenüber 2014.
Auf Platz eins der Liste steht Paul Achleitner mit knapp 810.000 Euro. Im internationalen Vergleich rangiere er damit auf Platz 16. Den bisherigen Rekord in Deutschland hielt der damaligen VW-Chefaufseher Ferdinand Piëch 2014 mit 1,48 Mio. Euro. Da der Autobauer die Veröffentlichung seiner Bilanz auf Ende April verschoben hat, konnte er für die Analyse nicht berücksichtigt werden.
HKP-Group-Experte Joachim Kayser hält die Entwicklung für problematisch. Die in den zurückliegenden Jahren erfolgte zaghafte Annäherung von Aufsichtsrats- und Vorstandsvergütung sei gestoppt, sagte er. „Dies ist aus unserer Sicht problematisch, denn professionelle Aufsichtstätigkeit setzt eine entsprechende Vergütung voraus und diese schließt eben auch Bezüge ein, die der Aufgabe gerecht werden“, so Kayser. Davon seien die Kontrolleure in Deutschland in der Breite noch weit entfernt.
Als Grund für den Rückgang gilt der Trend zu einer reinen Festvergütung. 17 Dax-Unternehmen haben laut der Analyse für 2015 ausschließlich fixe Vergütungselemente für ihre Aufsichtsräte vorgesehen. Variable Vergütungselemente seien auf dem Rückzug. Damit werde die Schere zwischen Aufsichtsrats- und Vorstandsvergütung weiter auseinanderklaffen.
Ströer: Aktie bricht ein
Wer Muddy Waters bisher für einen verstorbenen amerikanischen Bluesmusiker hielt, lernt dieser Tage eine andere Muddy Waters kennen. Eine US-Researchfirma gleichen Namens sorgte in dieser Woche für einen Kurssturz bei der Aktie des deutschen Außenwerbers Ströer. Die Analysten des Unternehmens äußerten in einem Bericht massive Zweifel an den Geschäftszahlen des deutschen MDax-Unternehmens, worauf die Aktie in der Spitze um mehr als 30 Prozent einbrach.
Da nützte es zunächst wenig, dass sich Ströer zur Wehr setzte. „Der Bericht ist weit hergeholt, mindestens tendenziös und im Ergebnis vollkommen haltlos“, teilte das Kölner Unternehmen mit. Die Geschäftsaussichten seien ausgezeichnet, operativ habe Ströer „den besten Jahresstart in der Geschichte des Unternehmens“ erwischt.
Ströer ist offensichtlich Opfer einer Leerverkaufsattacke geworden. „Europäische Konzerne sind reif für Leerverkäufe aufgrund ihrer Verschuldung und einem Mangel an Kontrolle durch Investoren“, erklärte Muddy Waters Ende 2015 in einem Interview. Leerverkäufer leihen sich Aktien, verkaufen sie, um den Kurs zu drücken und kaufen sie später wieder zum niedrigen Preis.
Capital berichtet in seiner neuen Ausgabe, dass US-Hedgefonds verstärkt deutsche und europäische Firmen im Visier haben. Vor Ströer war der Münchner Finanzdienstleister Wirecard Opfer von Leerverkäufern geworden. Muddy Waters selbst hat bereits die französische Supermarktkette Casino und die Telefongesellschaft Teliasonera angegriffen.
VW: teure Grundsatzeinigung
Das Aufatmen der VW-Aktionäre ließ sich in dieser Woche am Kursverlauf der Vorzugsaktie ablesen. Am Mittwoch und Donnerstag ging es für das Papier steil bergauf, bevor es am Freitag wieder einen Dämpfer gab. Doch da ging es Volkswagen nicht anders als Konkurrenten wie Daimler und BMW.
Grund für die bessere Investorenstimmung gegenüber VW war die Einigung des Konzerns mit den US-Behörden auf eine Grundsatzvereinbarung zur Lösung der Diesel-Krise. Volkswagen wird die von den Abgasmanipulationen betroffenen Fahrzeuge entweder zurückkaufen oder den Besitzern angemessenen Schadenersatz zahlen. Insgesamt geht es in den USA um 580.000 Dieselautos, die mit einer Manipulationssoftware ausgestattet waren. Die jetzt erzielte Einigung umfasst 480.000 Fahrzeuge.
Der Kompromiss wird auf jeden Fall teuer für den Wolfsburger Autohersteller. Nach Informationen der Nachrichtenagentur dpa wird VW 16,4 Mrd. Euro wegen des Dieselskandals zurückstellen. Bis jetzt waren lediglich 6,7 Mrd. Euro vorgesehen. Doch der Konzern wird für den Skandal noch tiefer in die Tasche greifen müssen: Die anstehenden Klagen sind in der Rechnung noch nicht enthalten.
Der Konzern ist wegen des Skandals in die roten Zahlen gerutscht. Für 2015 betrug der Betriebsverlust 4,1 Mrd. Euro. Darin enthalten seien negative Sondereinflüsse in Höhe von insgesamt 16,9 Mrd. Euro. 16,2 Mrd. Euro davon entfielen auf Rückstellungen für die „Abgasthematik“, wie VW den Dieselaffäre bezeichnet. „Ohne die erheblichen Vorsorgemaßnahmen, die wir für alle heute abschätzbaren Folgen der Abgasthematik getroffen haben, hätten wir einmal mehr von einem insgesamt erfolgreichen Jahr sprechen können“, sagte Konzernchef Matthias Müller.
Den Aktionären wird wegen der angespannten Lage die Dividende gekürzt. Je Vorzugsaktie gibt es nur noch 0,17 Euro nach 4,86 Euro im Vorjahr. Die Vorstände kommen vergleichsweise milde davon: Ihre Bonuszahlungen werden nur um 30 Prozent reduziert.
Argentinien: begehrte Anleihen
Argentinien ist erfolgreich an die Finanzmärkte zurückgekehrt. Nach 15-jähriger Abstinenz platzierte das Land einige Anleihen und die Investoren griffen beherzt zu. Insgesamt 16,5 Mrd. Dollar nahm Argentinien ein. Es hätten aber auch 68 Mrd. Dollar sein können, so begehrt waren die Papiere. Allerdings musste das Land den Investoren hohe Zinsen bieten: Laut Finanzminister Alfonso Prat-Gay liegt der durchschnittliche Zinssatz für die Bonds bei 7,2 Prozent.
Mit den Einnahmen sollen teilweise die Ansprüche von einigen US-Hedgefonds bezahlt werden. Die argentinische Regierung hatte sich im Januar mit ihnen auf einen Kompromiss geeinigt, um die Hindernisse für die Rückkehr auf die internationalen Finanzmärkte auszuräumen. Die Hedgefonds hatten nach der argentinischen Staatspleite 2001 Schuldscheine für wenig Geld erworben und später den Nennwert der Anleihen gefordert.
Ein jahrelanges Ringen mit der Regierung von Ex-Präsidentin Cristina Fernández de Kirchner war die Folge. Der neue konservative Staatschef Mauricio Macri wollte den Streit rasch beenden, um ausländische Investoren wieder nach Argentinien zu locken.