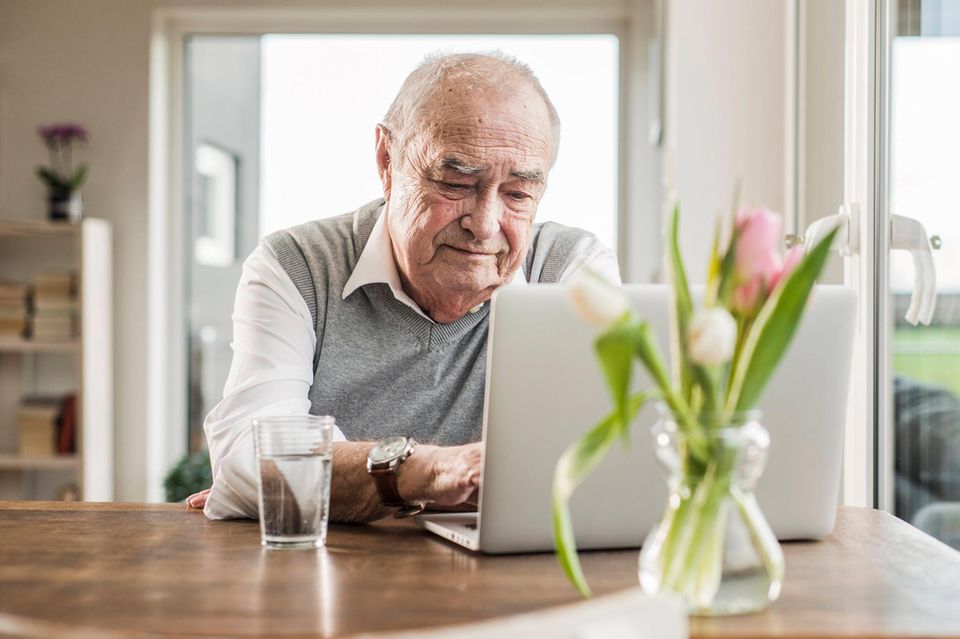Patrick Steller ist Innovationsberater und Coach bei der Beratungsagentur Dark Horse. Von ihr stammt das Buch „Digital Innovation Playbook — Das unverzichtbare Arbeitsbuch für Gründer, Macher und Manager“. Mehr unter www.digital-innovation-playbook.de
Ein neues Produkt oder einen neuen Service mit echtem langanhaltenden Mehrwert schaffen, davon träumt die ganze Wirtschaft. Ratgeber-Artikel, Bücher und Seminare versuchen die Kunst der Innovationsentwicklung in verständliche Prozesse und Korsetts zu pressen, um sie für jedermann beherrschbar zu machen. Auch wenn das ketzerisch klingen mag, wir (die Innovationsberatung Dark Horse aus Berlin) glauben, das ist der falsche Weg. Innovationen sind vielmehr „Abenteuer mit ungewissem Ausgang“. Deshalb müssen wir uns von dem Gedanken verabschieden, jeden Schritt einer Innovationsentwicklung planen zu können. Diese fünf Regeln helfen dennoch, die permanente Unsicherheit zu ertragen und am Ende sogar in positive Ergebnisse zu verwandeln.
Regel 1: Die Kultur steht über allem
Jedes Buch, das in den letzten Jahren über Design Thinking, Service Design, Lean Management und Co. veröffentlicht wurde, stellt ein eigenes Methodenset für das Gelingen von Innovationsprojekten in den Mittelpunkt. Doch eigentlich ist es egal, ob wir Methode A, B oder Z besonders gut anwenden können, wichtiger für den Erfolg des Projekts ist immer ein funktionierendes Team. Ohne eine kollaborative Kultur fehlt das Fundament für potentiell hilfreiche Methoden.
Kollaborationen sind auf zwei Ebenen wichtig: Einmal innerhalb des Teams, das sich um die Innovationsentwicklung kümmert (die „Macher“). Wenn die Mitglieder es schaffen, ihre spezifischen Stärken zu einem „Superteam“ zu formen, ist schon viel gewonnen. Besonders effektiv ist dieser Prozess in multidisziplinären Teams. Damit aber Vertriebler, Designer, Coder, Controller und die Leute aus dem Marketing zusammenarbeiten können, brauchen sie eine Kultur des Agierens auf Augenhöhe, in der vermeintlich dumme Fragen gestellt und verrückte Vorschläge gemacht werden können.
Aber Kollaborationen müssen auch zwischen „Möglich-Machern“ (oftmals die Managementebene oder Investoren) und den Machern funktionieren. Dabei können klare Übergabeformate helfen, die beiden Gruppen zu bestimmten Meilensteinen zusammenzubringen (diesem Punkt widmen wir in unserem neuen Buch „Digital Innovation Playbook“ viele Seiten). In der Zeit zwischen den Meilensteinen dürfen die Macher autonom agieren. Und die Möglich-Macher lassen das Mikromanagen sein und vertrauen den Machern.
Regel 2: Wir reden mit echten Menschen
Ein Innovationsprojekt kann nur erfolgreich sein, wenn es den Nutzer (und die Nutzerin) in den Mittelpunkt stellt. Finden wir heraus, was ihn antreibt und welche bisher ungelösten Probleme ihn beschäftigen, können wir innovative Lösungen mit echtem Mehrwert und langer Halbwertszeit erschaffen. Das bedeutet auch, dass wir schon im frühen Stadium unseres Projekts raus in die reale Welt gehen, um unsere Hypothesen zu überprüfen, die wir am Schreibtisch entwickelt haben.
Jeder Nutzer ist eingebettet in ein komplexes Netzwerk aus Bedingungen, Beteiligten und Bedürfnissen. Dieses System müssen wir richtig deuten lernen. Mit qualitativen Recherchemethoden untersuchen wir daher zuerst einzelne Nutzer und denken erst später an den globalen Roll-out unserer Innovation. Ist der Einzelne überzeugt, hilft er uns, die Massen zu begeistern.
Regel 3: Wir wechseln zwischen verschiedenen Denkmodi
Im Kern besteht jede Innovationsentwicklung aus drei Phasen: a) den Nutzer erforschen; b) möglichst viele Ideen in kurzer Zeit entwickeln; c) roughe Prototypen mit Nutzern testen und Feedback einholen. Als Macher-Team müssen wir diese Phasen durchlaufen — mehrmals! Und während wir das machen, nehmen wir verschiedene Denkmodi ein. Beim Kennenlernen der Nutzer agieren wir analytisch-empathisch wie Sherlock Holmes und Dr. Watson.
Während der Ideenentwicklung versuchen wir wie MacGyver bekannte Technologien zweckzuentfremden. Beim Testen sind wir die kritischen Geister, die gemeinsam mit dem Nutzer mit aller Kraft versuchen, die Idee kaputt zu machen. Nur, wenn unsere Idee dieses Prozedere überlebt, hat sie eine Chance auf Erfolg.
Regel 4: Wir stoppen nicht nach dem ersten Prototypen
Aus einer innovativen Idee wird erst dann eine innovative Lösung, wenn sie mithilfe von Prototypen fassbar und kommunizierbar wird. Wir haben bewusst die Mehrzahl verwendet, denn ein Prototyp stellt immer nur einen Aspekt unserer komplexen Idee heraus. Das Feedback, das wir beim Testen erhalten, lässt sich auf diese Weise leichter auswerten. Ein weiterer Vorteil: Prototypen, die zuerst nur einen Aspekt testbar machen, lassen sich schneller gestalten. Unser Ziel ist es ja immer, so schnell und so günstig wie möglich zu „scheitern“ (s. Regel 3), um unsere Ideen dann in kurzen Iterationszyklen zu verbessern — oder sie schnell zu vergessen, weil wir merken, dass sie keinen Nutzen für den Nutzer hat.
Erst wenn alle Aspekte einzeln getestet sind, können wir einen komplexen Prototypen als „Minimum Viable Product“ (MVP) auf den Markt bringen und mit einer größeren Anzahl Nutzer in den „Beta-Test“ gehen. Dieses Vorgehen eignet sich besonders gut bei Services und Produkten auf App-Basis.
Regel 5: Wir stellen uns aufs Scheitern ein (und freuen uns darüber)
Es ist traurig, aber wahr, nur äußerst selten beginnt die Erfolgsgeschichte erfolgreicher, innovativer Produkte und Services mit der ersten Idee. Innovationsentwicklung hat ja auch viel mit Bauchgefühl zu tun. Es hilft uns zu entscheiden, ob unsere Tests erschöpfend genug waren, ob wir genug über unsere Nutzer wissen, ob wir die richtige Idee prototypisiert haben. Und das sind nur drei Entscheidungen unter hunderten, die wir im Laufe eines Projekts treffen müssen.
Ein Bauchgefühl muss geschult werden, und meistens ist die beste Schule das erste, zweite, dritte, vierte Scheitern. Und die dabei gewonnene Erfahrung hilft beim nächsten Anlauf. Ganz sicher.