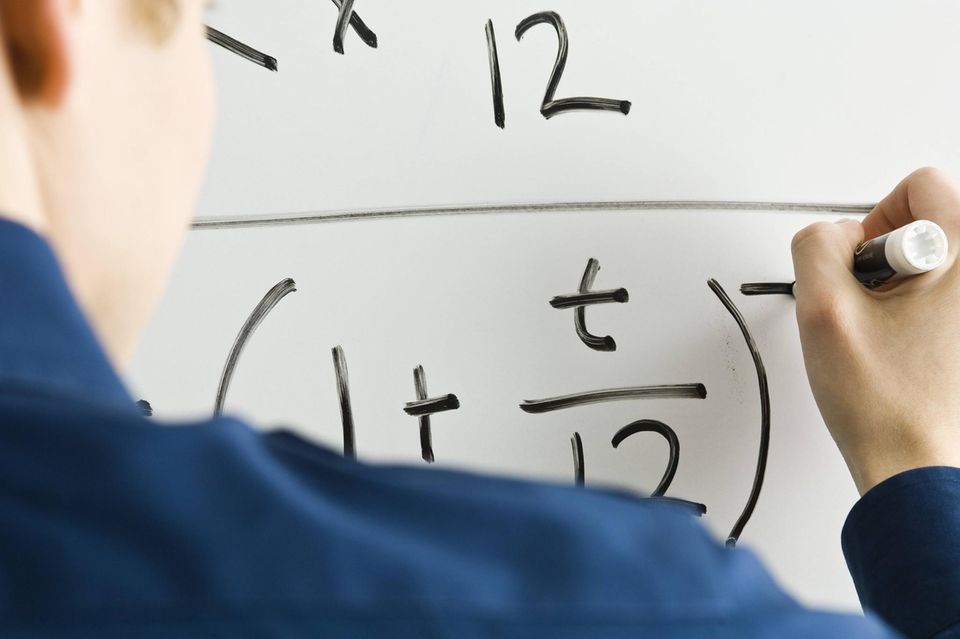Capital: Demut klingt erst einmal sehr hochtrabend. Was muss man denn darunter verstehen?
CHRISTOPH SECKLER: Das Wort Demut bringen wir in Deutschland oft mit religiösem Glauben sowie einer unterwürfigen Haltung in Verbindung. Von dieser Vorstellung müssen wir allerdings wegkommen, Demut umfasst viel mehr. In der wissenschaftlichen Debatte meinen wir mit dem Wort drei Verhaltensweisen. Erstens: Man ist bereit sich selbst richtig einzuschätzen. Zweitens: Man tritt anderen gegenüber wertschätzend auf. Und drittens: Man ist lernbereit. Diese drei Eigenschaften haben dann wiederum einen positiven Einfluss auf das Fehlermanagement.
Inwiefern? Also was machen demütige Manager besser als andere?
Demütige Manager wissen, dass sie fehlbar sind. Wenn sie Fehler machen, ist das also kein Schlag ins Gesicht, sondern ein normaler Teil des Lebens. Deswegen fällt es ihnen leichter, über Fehler zu reden, Fehler zu analysieren, aus ihnen zu lernen – und sie letztendlich auch zu beheben. Längerfristig haben demütige Manager deshalb eine bessere Performance als andere.
Ist das Bild vom demütigen Manager denn schon in deutschen Unternehmen angekommen? Oder überwiegt dann doch die Idee von der selbstbewussten und starken Führungskraft?
Ganz grundsätzlich schließen sich Selbstbewusstsein und Demut ja überhaupt nicht aus. Wenn man sich selbst ehrlich einschätzt und gleichzeitig auch offen für andere ist, stärkt das auch die Wahrnehmung der eigenen Kompetenz. Es ist richtig, dass man nach älterem Verständnis ein starkes Bild nach außen präsentieren musste, um im Konzern wahrgenommen zu werden. Allerdings gibt es in Deutschland auch jetzt schon viele tolle Beispiele von demütigen Managern, die eine tolle Performance haben, obwohl sie vielleicht nicht so stark im Vordergrund stehen. Und auch wer im Fokus steht, kann demütig agieren – SAP-Chef Christian Klein nehme ich beispielsweise aus der Ferne so wahr.
Können sich demütigen Manager denn dann trotzdem gegenüber anderen behaupten, wenn sie nicht so stark gesehen werden?
Da muss man auf der einen Seite zwischen der Außendarstellung und der anderen Seite mit der Selbsteinschätzung und wie man tatsächlich ist unterscheiden. Demut hat vor allem etwas mit Letzterem zu tun, auch wenn so nach außen der Eindruck von Bescheidenheit entstehen kann. Trotzdem darf man beides nicht miteinander verwechseln. Denn demütige Manager können sich nach außen hin sehr wohl positiv darstellen, gerade wenn es auf die Leistung ankommt.
Sie haben vorhin schon einmal die Rolle von Demut für eine gute Fehlerkultur erwähnt. Warum ist Demut dafür so wichtig?
Demütige Manager geben Fehler zu und akzeptieren sie als Teil ihres Handelns. Darüber hinaus gehen sie wertschätzend mit ihren Mitarbeitern um und geben ihnen ein positives Feedback. Das schafft Vertrauen in die eigene Arbeit und erleichtert es den Mitarbeitern, konstruktiv mit ihren eigenen Fehler umzugehen. Deshalb haben demütige Manager einen starken positiven Einfluss auf die Fehlerkultur.
Ist Demut denn eine Eigenschaft, die Manager noch lernen müssen oder hapert es bislang einfach nur an der Anwendung ?
Jeder kann ein demütigeres Verhalten an den Tag legen. Dazu muss man in deutschen Unternehmen allerdings eine positivere Einstellung gegenüber dieser Eigenschaft entwickeln. Denn wenn wir über Demut sprechen, schwingt oft die eingangs skizzierte Vorstellung von Unterwürfigkeit mit.
Das klingt so, als hätte Demut ein Imageproblem. Sollte man deshalb über ein anderes Wort nachdenken?
Mit dem Wort ist aber nichts verkehrt. Demut gilt in den meisten Weltreligionen als Meta-Tugend und Symbol für Charakterstärke. Allerdings ist etwas mit den Konnotationen verkehrt – zumindest in Deutschland. Wir müssen also einen Imagewandel schaffen.
Wen sehen Sie da in der Pflicht, das zu erreichen?
Das ist eher eine Frage, wie wir uns als Gesellschaft weiterentwickeln wollen und ob wir einen Mehrwert in Demut sehen. Aus der wissenschaftlichen Sicht gibt es durchaus einen großen Nutzen für ein gutes Fehlermanagement und für Handlungslernen. Mein Vorschlag ist daher, Demut aus dieser Unterwürfigkeitsecke rausholen und stärker herausstellen, dass es eine Stärke und eine Tugend ist.
Da Demut ja gerade für die Fehlerkultur so wichtig ist. Wie fortgeschritten ist das Thema Fehlerkultur in deutschen Unternehmen mittlerweile?
Die deutsche Fehlerkultur ist eher eine Fehlerpräventionskultur, also man ist sehr darauf bedacht, Fehler zu vermeiden. Das Fehlermanagement, also der konstruktive und proaktive Umgang mit Fehlern, läuft in Deutschland dagegen schlecht. In einer Studie wurde die Fehlertoleranz in 61 Ländern verglichen. Das Ergebnis: Beim Thema Fehlertoleranz liegt Deutschland auf Platz 60 von 61. Dieser vorletzte Platz ist nicht vorteilhaft, gerade in Bezug auf kreative Branchen.
Inwiefern?
Eine Nullfehlertoleranz ist gut, wenn man inkrementell etwas verbessern will. Wenn ich aber etwas ganz Neues bauen will, dann ist diese Angst, Fehler zu machen, schlecht. Denn diese Angst kann die eigene Innovationskraft hemmen. Deswegen sollten wir einiges tun, um eine bessere Fehlerkultur – konkret eine Fehler management kultur – zu etablieren.
Was braucht es denn dafür?
Eine Fehlerkultur entsteht innerhalb der einzelnen Teams. Sie kann nicht vom Vorstand vorgegeben werden, sondern passiert immer dann, wenn wir mit anderen Leuten umgehen. Darüber hinaus braucht es einen neuen Blick auf Fehler als Teil des Lebens mit manchmal positivem Nutzen. Jeder einzelne kann da ein Vorbild sein. Wer also selbst eigene Fehler zugibt, über sie spricht und aus ihnen lernt, kann auch anderen dabei helfen, das zu tun.
Wenn man sich eine Unternehmenshierarchie vorstellt, wo fangen da Demut und Fehlerkultur am besten an?
Am besten überall. Den größten Effekt hat es natürlich, wenn Chefs als gutes Vorbild vorangehen, damit sich gerade junge Mitarbeiter daran orientieren können. Letztendlich ist das aber ein kollektives Vorhaben.
Ist denn nur ein Umdenken nötig oder bedarf es da konkreten Schulungen?
Im ersten Schritt braucht es die Anerkennung, dass Demut und Fehlermanagement etwas Gutes sind. Wenn es dann an die Umsetzung geht, kann es helfen, sich Prinzipien festzulegen. Dabei verknüpft man bestimmte Situationen dann mit konkreten Handlungen. Wenn ich also wichtige Entscheidungen treffen muss, kann das Prinzip sein, dass ich vorher eine zweite Meinung bei den Kollegen einhole. So kann man erfolgreich Schritt für Schritt sein Verhalten im Arbeitsalltag ändern – auch wenn das natürlich sehr schwerfällt.
Was ist denn Ihre Erwartung: Wie schnell wird sich das in Deutschland etablieren gerade vor dem Hintergrund von Homeoffice und Pandemie?
Wie schnell sich das etablieren wird, lässt sich nur schwer beantworten. Allerdings sollten Unternehmen sich schnell in Richtung einer guten Fehlerkultur verändern. Die Arbeit im Homeoffice hat einen Kulturwandel für viele Organisationen mit Hürden versehen, da vielerorts zunächst einmal die digitale Kommunikation gelernt werden musste. Gleichzeitig hat die Pandemie aber auch alte Verhaltensmuster aufgebrochen und gezeigt, dass man relativ schnell etwas verändern kann, wenn man will – und muss. Eine Entwicklung in der Arbeitskultur ist natürlich langwieriger. Trotzdem lautet die gute Nachricht: Wenn man etwas verändern will, dann geht das auch.
Kennen Sie schon unseren Newsletter „Die Woche“? Jeden Freitag in ihrem Postfach – wenn Sie wollen. Hier können Sie sich anmelden