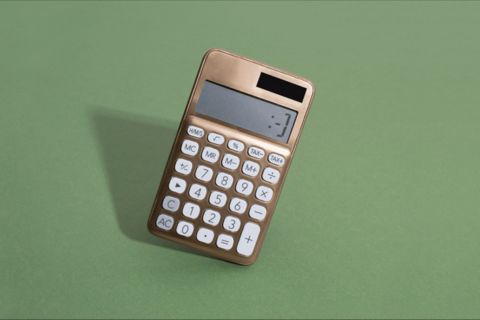Wenn die Regierung sich schon mal spendabel zeigt, dann sollte man sich eigentlich darüber freuen. Zum Beispiel darüber, dass es demnächst das Baukindergeld gibt – und zwar bereits rückwirkend zum 1. Januar 2018. Das heißt, dass alle Familien, die in diesem Jahr ein Haus oder eine Eigentumswohnung gekauft haben oder es ab sofort tun, vom Staat bezuschusst werden. Mit immerhin 12.000 Euro pro Kind. Das ist im Prinzip eine gute Nachricht. Denn klagen nicht Marktbeobachter besonders in Großstädten, wie stark die Immobilienpreise gestiegen sind und dass kaum noch ein Normalverdiener diese exorbitanten Wohnungspreise bezahlen könnte? Sie tun es zu Recht. Nun ist aber die Frage, ob das Baukindergeld daran so arg viel ändern wird. Oder ob es nicht die ganze Wohnungsmisere am Ende nur noch schlimmer macht. Wie gut oder wünschenswert ist dieser staatliche Zuschuss für Käufer also? Und was bedeutet er wirklich?
Das Baukindergeld wird zunächst einmal alle Paare mit Kind freuen und Alleinerziehende mit Kindern ebenso. Denn der Zuschuss gilt für jedes Kind unter 18 Jahren, das mit im Haushalt eines Hauskäufers lebt – und das auch in das erworbene Eigenheim mit einzieht. Zumindest, wenn es das erste Wohneigentum ist, dass sich die Familie leistet. Wer bereits ein Haus hat und neu baut oder in ein größeres Heim umzieht, für den gilt das Baukindergeld nämlich nicht. Es will ausdrücklich Erstimmobilienkäufer fördern. Nicht jene, die sich nur noch verändern wollen, weil ihnen eventuell der Platz nicht mehr reicht. Und es will insgesamt die Quote der Eigenheimbesitzer in Deutschland anheben. Hierzulande nämlich leben lediglich 45 Prozent der Bundesbürger in den eigenen vier Wänden. Nirgendwo in Europa sind es so wenige wie hier, außer in der Schweiz und Schweden. Der Hausbesitz aber soll gefördert werden, findet die Bundesregierung und fängt nun bei den Familien an.
Baukindergeld - üppiges Geldgeschenk vom Staat
Grundsätzlich besagen die Baukindergeld-Fördervorschriften: Ein Drei-Personen-Haushalt bekommt 12.000 Euro vom Staat geschenkt, ein Vier-Personen-Haushalt 24.000 Euro. Mit drei Kindern kann man 36.000 Euro einsacken. Vorausgesetzt die Familie kommt auf ein Haushaltsnettoeinkommen von unter 90.000 Euro – denn die Einkommensgrenze, bis zu der ein Zuschuss gezahlt wird, liegt bei 75.000 Euro plus 15.000 Euro Freibetrag je Kind. Eine vierköpfige Familie darf also maximal 105.000 Euro verdienen, um das Extrageld einzusacken. Was zugegebenermaßen auch nur sehr selten der Fall ist. Ökonomen des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung haben ermittelt, dass 90 Prozent aller Haushalte mit Kindern weniger verdienen als diese Obergrenzen und damit als förderberechtigt gelten.
Soweit klingt das ganz gut, außer dass man bereits hier fragen könnte, wieso der Staat nun eine so breite Masse mit so üppigen Geldgeschenken fördern will. Insgesamt sollen die Ausgaben für das Baukindergeld immerhin rund 4,4 Mrd. Euro langfristig betragen, haben Wirtschaftsforschungsinstitute errechnet. Könnte man also das Geld nicht lieber etwas zielgerichteter jenen zukommen lassen, die es vielleicht nötiger hätten als Haushalte, die ohnehin schon über 90.000 oder 100.000 Euro verfügen? Und haben Letztere das Extrageld für den Hauskauf wirklich nötig? Doch das sind politische Verteilungsfragen.
Die praktische Verteilungsfrage beim Kinderzuschuss lautet eher: Wie kommt das Geld nun bei den Familien an? Die Summe wird nämlich nicht auf einen Schlag ausbezahlt und zwar zu Anfang des Finanzierungsprozesses. Was aber wiederum günstig wäre, um die Familien von den hohen Kosten und Nebenkosten beim Hauskauf zu entlasten. Denn wer eine Immobilie finanziert, der muss schließlich nicht nur den Hauspreis bezahlen und dafür einen Kredit aufnehmen. Sondern er muss auch die Kosten für Notar, Grundbucheintrag und Grunderwerbsteuer aufbringen, häufig auch noch die Maklercourtage, was in Summe rund 10 Prozent und maximal bis zu 15 Prozent Nebenkosten ausmacht, je nach Bundesland und Steuersätzen. Geld, das die Banken nicht in die Kreditsumme einrechnen. Das sind also rund 30.000 bis 40.000 Euro zusätzlich bei einem Hauspreis von 350.000 Euro. Und maximal 67.000 Euro bei einem Haus für 450.000 Euro, die schon kurz nach dem Kauf beglichen werden müssen. Ließen sich diese Ausgaben durch das Baukindergeld drücken, wäre das für Familien eine enorme Erleichterung.
Der staatliche Zuschuss aber wird zunächst „bloß“ als Eigenkapitalersatz angerechnet. Das heißt, er vergrößert theoretisch das zur Verfügung stehende Eigenkapital und senkt dadurch den Beleihungswert der Immobilie. Das macht bei der Kreditvergabe dann auch den gezahlten Kreditzins um ein paar Zehntelprozentpunkte günstiger. Die Hypothekenzinsen, die fortan gezahlt werden müssen, fallen dadurch um rund 0,25 Prozent niedriger aus, haben Ökonomen ermittelt. Ausgezahlt wird das Geld dann in Häppchen durch die staatliche Förderbank KfW über zehn Jahre. Es gibt also 1200 Euro jährlich pro Kind. Die kann man dann entweder in die Sondertilgung stecken oder damit monatlich die zu zahlende Kreditrate ein klein wenig senken.
Wie stark macht sich nun diese Förderung bemerkbar? Das haben Experten des Pestel Instituts durchgerechnet: Wer eine Immobilie für 300.000 Euro kauft, was inzwischen ungefähr dem bundesdeutschen Durchschnittshauspreis entspricht – abseits der Ballungsräume zumindest – und dafür einen Kredit über 270.000 Euro aufnimmt (also rund 60.000 Euro Eigenkapital mitbringt, was für junge Familien schon viel sein dürfte), der müsste laut ihrer Rechnung bei 20 Jahren Laufzeit eine Rate von rund 1400 Euro ohne jegliche Zuschüsse für den Kredit aufbringen, wenn der Kredit innerhalb der Laufzeit voll getilgt sein soll. Mit Baukindergeld für ein Kind wären es „nur noch“ 1337 Euro und bei zwei Kindern 1265 Euro. Das dürfte für viele Familien dennoch eine stattliche Summe sein.
Bleibt also nur eines: Die Laufzeit des Kredites verlängern. Das erhöht zum einen natürlich wieder die Kreditzinsen – denn je länger die Laufzeit, desto teurer der Kredit – senkt aber dadurch die Monatsraten. Bei 30 Jahren Abzahlphase wären es jetzt 1104 Euro, die ein Ungeförderter zahlen würde. Und die Familien müssten 1050 Euro mit einem Kind und 990 Euro mit zwei Kindern zahlen. Das entspricht insgesamt einer um fünf Prozent niedrigeren Monatsrate (ein Kind) beziehungsweise zehn Prozent weniger (zwei Kinder). Diese Quoten gelten übrigens laut Pestel Institut unabhängig davon ob über 20 oder 30 Jahre finanziert wird.
Es gibt allerdings auch Familien, die sich über eine Förderung von 26 Prozent freuen können. Es sind jene, die besonders günstige Häuser kaufen, im Rechenbeispiel waren es Eigenheime für 100.000 Euro. Auf dem Land findet man so etwas noch in familientauglicher Größe. Überproportional gewinnen werden also Landbewohner, die sich ohnehin oft wundern, wenn Städter von Preisexplosionen bei Häusern und Mieten reden, weil bei ihnen eher die Immobilienpreise verfallen. Deshalb schätzen Ökonomen von Wirtschaftsforschungsinstituten auch, dass das Baukindergeld dazu führen wird, dass mehr Familien in dünnbesiedelten Räumen Eigenheime erwerben. Während es in den Metropolen eher noch teurer wird, weil der Staatszuschuss dazu führt, dass jene Familien, die es sich hier überhaupt noch leisten können, in die eigenen vier Wände zu ziehen, bald noch ein größeres Budget zur Verfügung haben – weshalb Verkäufer und Bauträger vermutlich noch ein paar Euro auf die Preise aufschlagen werden.
Die Wohnkosten werden steigen
„Reichenheimgeld“ nennen Spötter den neuen Zuschuss daher. Insgesamt jedenfalls wird er die Wohneigentumsquote nur um 0,1 bis 0,2 Prozentpunkte anheben, schätzen sie. Denn es geht bei dem gesamten Paket bloß um rund 300.000 Familien, die davon profitieren. Das ist eine recht übersichtliche Zahl angesichts von 82 Millionen Bundesbürgern und rund 40 Millionen Haushalten. Zumal in den Großstädten rund 80 Prozent der Wohnungen von Ein- und Zweipersonenhaushalten bewohnt werden. Erst recht, wenn man sich folgendes vergegenwärtigt: Immer mehr Bundesbürger haben später – ob sie nun im Familienverbund leben oder nicht – eine sehr kleine Rente zu erwarten Die Prognosen besagen, dass von jenen, die 2030 in Rente gehen etwa 40 Prozent nicht mehr staatliche Rente bekommen werden als 800 Euro im Monat. Eher weniger. Nach 40 Jahren Vollzeiterwerbsfähigkeit wohlgemerkt. Das klingt nicht nur wenig, das ist es auch, zumal die Wohnkosten bis dahin weiter steigen. Deshalb wird auch der Anteil des Alterseinkommens, der für Wohnausgaben draufgeht, im Rentenalter noch einmal kräftig steigen. Im Erwerbsleben macht er im Bundesschnitt rund 25 bis 30 Prozent aus. In manchen Metropolen und gerade bei Wenigverdienern sind es eher 40 Prozent.
Zusätzliche Alterseinkünfte neben der gesetzlichen Rente aber haben sehr viele dieser Nicht-Topverdiener nicht zu erwarten, besagen Statistiken. Demnach hat etwa die Hälfte derer, deren Einkommen heute unter 1500 Euro liegt, keine weiteren Altersbezüge zu erwarten. Von denen, die heute 1500 bis 2500 Euro zur Verfügung haben, sehen auch nur 40 Prozent einer zusätzlichen Altersversorgung aus privaten Sparverträgen, Versorgungswerken oder anderen Quellen entgegen. Das könnte bei den Wenigverdienern dazu führen, dass die Wohnkosten im Rentenalter rund 70 Prozent ihrer Renteneinkünfte verschlingen. Jedenfalls wenn sie Mieter bleiben.
Haben sie aber zu Rentenbeginn eine abbezahlte Immobilie, in der sie wohnen können, so ist die Gefahr, dass sie in die Altersarmut rutschen sehr viel geringer. Weil dann auch eine kleinere Rente sehr viel weiter reicht. Genau das ist der Grund, warum eine höhere Eigenheimbesitzerquote hierzulande wirklich wünschenswert ist. Allerdings weniger in den ländlichen Regionen, wo die Kaufkraft ohnehin schon höher ist, sondern gerade in den Städten. Und vor allem bei jenen, die später wirklich eine hohe Gefährdungsquote haben, arm zu werden. Und das sind jene Haushalte, die gerade keine 100.000 Euro verdienen und in denen es auch nicht gleich mehrere Personen gibt, die etwas zum Haushaltseinkommen beitragen könnten. Ein Viertel aller Deutschen lebt in Großstädten, das sind 20 Millionen Menschen, und nicht nur 300.000.