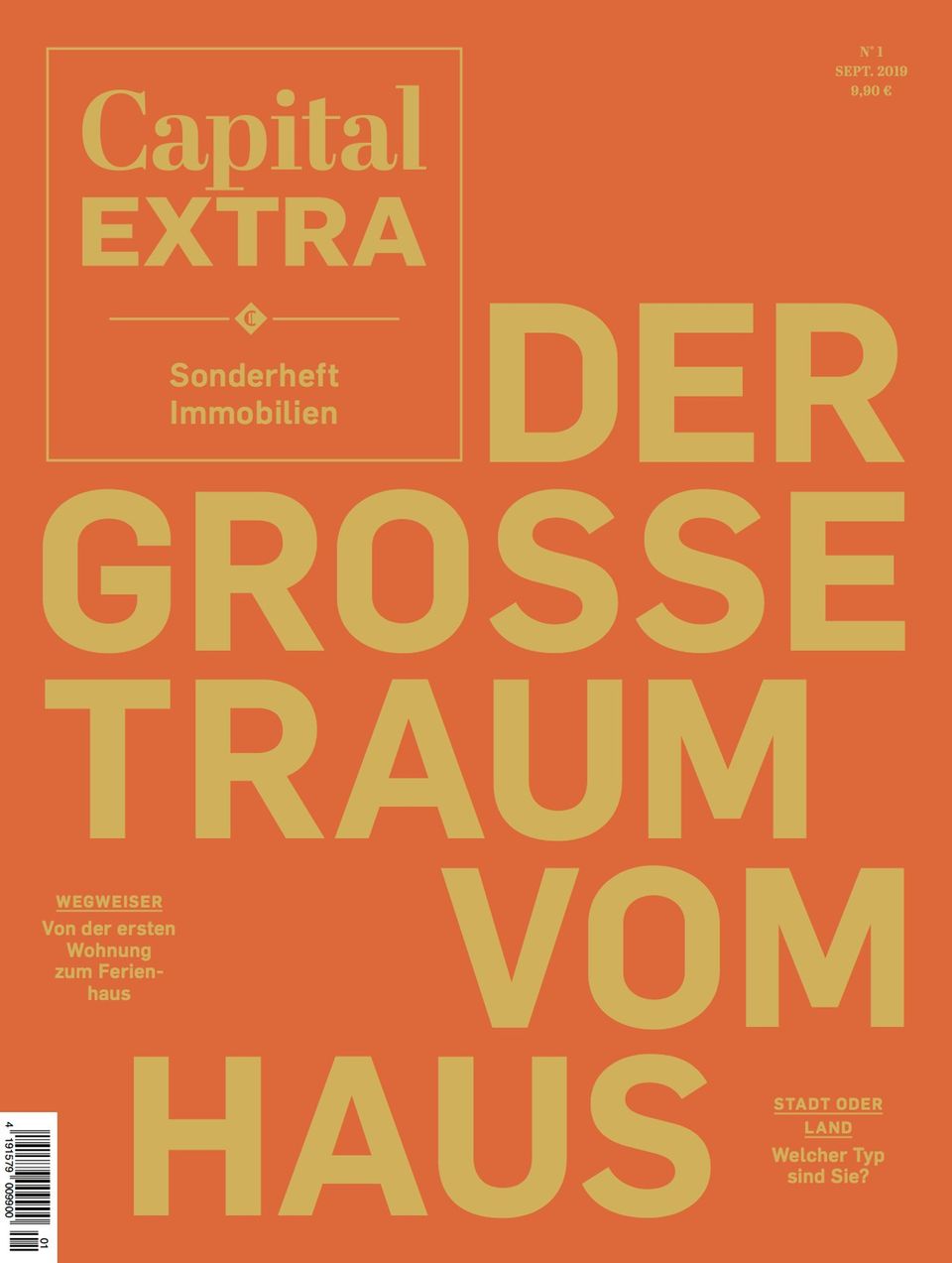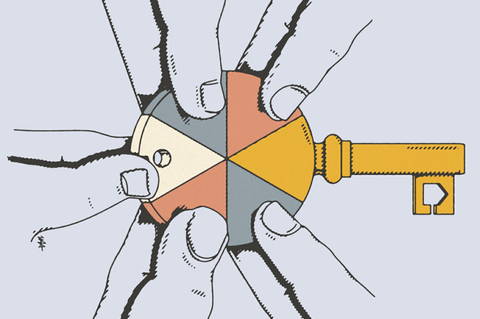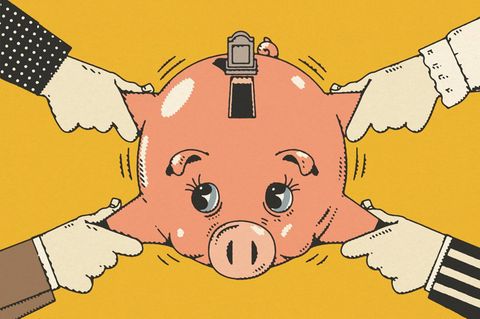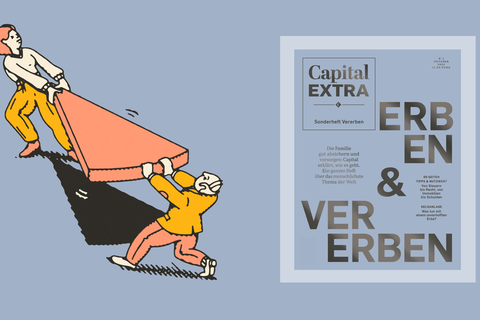Wenn Jessie Wagenaar die Balkontür ihrer Altbauwohnung öffnet, wundert man sich. Der Innenhof ist nicht viel größer als eine Schrebergartenparzelle, aber er wirkt unglaublich grün. Die Balkone ringsum sind ähnlich geschmackvoll möbliert wie Jessies eigener, und man ahnt, dass es hier sehr gemütlich werden kann, wenn die Nachbarn eines ihrer Hoffeste feiern. Heute aber ist es ruhig auf dem Balkon – so ruhig, dass man kaum glauben kann, sich in einem der ältesten Viertel Amsterdams zu befinden.
Der Balkon ist eine stille Oase inmitten der quirligsten Stadt der Niederlande. Auch der Rest der Wohnung mit ihrem Erker, dem Parkett und der stilvollen Wohnküche sieht aus, als habe sie jemand für das Fotoshooting eines Einrichtungsmagazins hergerichtet. Je länger man sich umsieht, desto weniger begreift man, dass jemand eine solche Wohnung freiwillig verkaufen und wegziehen will.
Genau das aber hat Jessie Wagenaar vor. Schuld daran ist ihre Tochter, die bald ein bisschen zu groß für das Kinderzimmer der 67-Quadratmeter-Wohnung sein wird. Deshalb will die Familie umziehen. Jessie und ihr Mann haben eine neue Wohnung gekauft, nur ein paar Straßen weiter, mit 104 Quadratmetern. Sie liegt wieder in einem alten Backsteinhaus, das von außen fast genauso aussieht wie das alte. Guckt man dort aus dem Fenster, blickt man auf eine Gracht. Schwäne und Enten ziehen ihre Bahnen, dazwischen tuckern jene Kleinboote vorbei, auf denen Amsterdamer zur Arbeit schippern, Paare zusammen picknicken oder sich Rentnertrupps zum Frühschoppen treffen.
Wer hierherzieht, verliert nichts, sondern gewinnt Quadratmeter und Lebensqualität. Aber kann man sich solche Wohnungen in dieser Stadt überhaupt noch leisten? Amsterdam ist zwar nicht München oder Frankfurt, doch zwischen 6000 und 9000 Euro kostet der Quadratmeter trotzdem in der teuersten Stadt der Niederlande.
Fliegender Wechsel
Man kann, wenn man es macht wie Jessie Wagenaar. Die ist kaum Mitte 30 und kauft bereits ihre vierte Immobilie. Und zwar nicht, weil sie zufällig als Vertriebsfrau in der Immobilienbranche arbeitet, sondern weil sie es so macht, wie es auch andere Niederländer gern tun. Die kaufen nämlich oft schon mit 25 oder 30 Jahren ihr erstes Apartment, sagen die Statistiken des nationalen Wohnungsreports.
Für die allermeisten wird es nicht die letzte Wohnung sein, die sie sich im Lauf des Lebens zulegen. Im Schnitt passen sie alle zehn bis 15 Jahre ihr Wohneigentum an ihre Lebensumstände an – ab 45 Jahren dann etwas seltener. Vor wenigen Jahren waren Niederländer, die zum ersten Mal eine Wohnung kaufen, im Schnitt 32 Jahre alt. Inzwischen sind zwar vor allem Erstkäufer in Großstädten etwas älter, was den gestiegenen Immobilienpreisen geschuldet ist, dennoch liegt das Durchschnittsalter der Käufer unter 40. In Friesland etwa, wo die Maklerin Zwany van Brussel seit über 20 Jahren ihr Geschäft hat, gilt schon als alt, wer mit 30 ein Haus kauft. „Hier kauften die jungen Leute früher mit Anfang 20“, sagt sie. Deutsche Käufer dagegen gehen mit ihren durchschnittlich 48 Jahren schon fast auf die Rente zu.
Wer wissen will, warum das Immobiliengeschäft in den Niederlanden so anders läuft als hierzulande, muss sich zunächst den dortigen Mietmarkt ansehen. Der gilt als einer der reguliertesten in ganz Europa. Im Gros besteht er aus Sozialwohnungen mit überschaubaren Mieten, deren Höhe ans Einkommen gekoppelt ist. Das heißt: Bis zu einem Bruttoverdienst von 36.000 Euro im Jahr zahlt jeder prozentual dasselbe. „Und die Wartelisten sind lang“, sagt Han Joosten, Leiter der Marktforschung beim Immobilienentwickler BPD. „Auf eine solche bezahlbare Mietwohnung in Amsterdam wartet man zwölf Jahre, in Utrecht vier Jahre.“ Nur zehn Prozent aller Wohnungen werden frei vermietet an jene, die mehr verdienen. Weil es nur so wenige sind, sind sie entsprechend teuer.
Riesiger Kaufmarkt
Unterschiede gibt es auch beim Kaufmarkt, der im Vergleich riesig ist: Es gibt vier Millionen Eigenheime für nicht einmal acht Millionen Haushalte mit 18 Millionen Bewohnern. Davon stehen jedes Jahr circa fünf Prozent zum Verkauf, zudem werden jährlich Zehntausende neue Immobilien gebaut. In Deutschland dagegen gibt es gerade einmal 15 Millionen Eigentumsimmobilien für 80 Millionen Bundesbürger, und zum Verkauf stehen weniger als zwei Prozent.
Der Markt in den Niederlanden ist also viel stärker in Bewegung – da geht immer irgendwo noch was. Selbst in der friesischen 50.000-Einwohner-Stadt Heerenveen meldet die Maklerin Zwany van Brussel aktuell rund 20 Verkaufsobjekte, und auf jedes kommen 20 bis 30 Kaufwillige.
Zurück zu Jessie Wagenaar, deren „Wohnkarriere“, wie es ihre Landsleute nennen, typisch niederländisch ist. Ursprünglich kommt sie aus Amsterdam. „Ich hatte das Glück, dass ich mit 24 Jahren beruflich nach Eindhoven ziehen durfte“, sagt sie. Zwar fehlte ihr dort der Trubel ihrer Heimatstadt, und auch eine bezahlbare Mietwohnung war schwer zu finden. Rund 900 bis 1000 Euro hätte Wagenaar für die monatliche Miete ausgeben müssen. „Dafür“, dachte sie sich, „kann ich auch etwas kaufen.“
Die Bank gab ihr recht – und gewährte ihr einen Kredit von 170.000 Euro für ihre erste Eigentumswohnung, 90 Quadratmeter groß. „In Amsterdam hätte ich für das Geld nie und nimmer so viel Raum bekommen“, sagt Wagenaar. Dabei war die Monatsrate für den Kredit mit 600 Euro überschaubar. Solche Zahlenvergleiche sind es, die in den Niederlanden eine Redewendung geprägt haben: „Wohnungen zu mieten heißt, sein Geld wegzuwerfen.“
Zinsen jetzt, tilgen später
Lange war es in den Niederlanden zudem durchaus üblich, dass Käufer bei Immobilienkrediten nur die anfallenden Zinsen zahlten, ohne den Kredit zu tilgen. Dabei verringerte sich ihre Schuldenlast zwar nicht, aber das machte nichts, weil sie beim Wiederverkauf der Wohnungen mit dem Erlös die Kredite zurückzahlen konnten. Das funktionierte auch deshalb so gut, weil die typische Wohnkarriere gewissen Regeln folgt: Anfangs werden die gekauften Wohnungen immer größer, bis sie mit dem Auszug der Kinder und dem Renteneintritt wieder schrumpfen – dann ziehen die Eigentümer zurück in kleinere und preiswertere Stadtapartments.
In der Regel wollen Niederländer ihre Immobilien auch nicht behalten, um sie an nachfolgende Generationen zu vererben. Einer der Gründe ist das Steuerrecht, erklärt Joosten: „Große Vermögen steuerfrei zu vererben, das geht bei uns nicht.“
Gleichzeitig ist die Sorge der Niederländer gering, beim Wiederverkauf ihrer Immobilien Verluste zu machen. Auf längere Sicht warf der Wohnungsmarkt stets Wertsteigerungen ab, mit denen Käufer moderate Gewinne erzielten und sich die sukzessiven Wohnungsvergrößerungen leisten konnten.
Der Kater nach der Krise
Ein wenig haben sich die Gepflogenheiten seit der Finanzkrise geändert, als die einbrechenden Hauspreise auch den niederländischen Wohnungsmarkt an seine Grenzen brachten. Viele Eigentümer galten als technisch überschuldet, weil ihre Kredite plötzlich den Wert der Immobilien überstiegen. Aber nur die allerwenigsten kamen wirklich in Schwierigkeiten.
Wie das kommt? Die meisten saßen die Krise einfach aus. Ein paar Jahre lang ging das Tempo der Verkäufe zurück, sagt Han Joosten: „Das sorgte für einen Stau auf dem Markt, dadurch kam die Kette der üblichen Umzüge zum Erliegen.“ Doch seitdem die Preise wieder auf Vorkrisenniveau gestiegen sind, läuft der Markt wie gehabt. Mit einem kleinen Unterschied: Seit 2012 müssen Kreditnehmer wenigstens ein bisschen tilgen.
Ansonsten läuft das System wie gewohnt weiter. „Früh ins Eigentum einstiegen und sich hocharbeiten, so bleibt das bei uns“, sagt Joosten. Bei Jessie Wagenaar hat es gut funktioniert. Nach fünf Jahren verkaufte sie ihre erste Wohnung und erstand mit ihrem Freund ein Reihenhaus in Eindhoven: 134 Quadratmeter für 350.000 Euro. „Das war nicht gerade ein Schnäppchen, aber im Vergleich zu den Neubauwohnungen günstig“, sagt Wagenaar. Die Bank gestand dem jungen Doppelverdienerpaar den Kredit problemlos zu.
Fast 70 Prozent der niederländischen Haushalte leben laut EU-Statistiken in Wohneigentum. In Deutschland stagniert die Zahl bei 45 Prozent. Dass Käufer im Nachbarland nicht nur früher, sondern häufiger ins Eigentum einsteigen, liegt auch an den Banken. Die finanzierten Käufe bis zur Finanzkrise oft zu 100 bis 110 Prozent: Sie vergaben Kredite nicht nur völlig ohne Eigenkapital, sondern legten Käufern auch noch das Geld für die Nebenkosten aus.
Inzwischen seien sie etwas zurückhaltender, sagt Joosten. „Wenn ein 25-Jähriger für 260.000 Euro ein Haus kaufen will, dann zucken sie schon mal.“ Auch die Nebenkosten finanzieren sie nicht mehr. Die aber fallen in den Niederlanden ohnehin geringer aus. Höchstens drei Prozent der Kaufsumme müssen für Grunderwerbsteuer, Makler- und Notargebühren einkalkuliert werden, also 9000 Euro bei einem 300.000-Euro-Haus. Dafür bekommt man hierzulande gerade mal den Notar. Insgesamt wären in Deutschland je nach Bundesland 30.000 bis 45.000 Euro an Nebenkosten zu zahlen, hinzu kämen bei einem Eigenkapitalanteil von 20 Prozent noch einmal 60.000 Euro.
Es verwundert nicht, dass deutsche Käufer im Schnitt deutlich länger brauchen, um das Startkapital für eine Immobilie anzusammeln. Junge Niederländer dagegen sparen nach eigener Auskunft gewohnheitsgemäß kaum. Zudem starten viele mit üppigen Schulden aus Studienkrediten in den Beruf. Dennoch haben sie das Startkapital schnell beisammen.
Flexibel reagieren
Da ist es – zumindest finanziell – auch nicht so schlimm, wenn mal etwas nicht läuft wie geplant. Während deutsche Hauskäufer an den Rand des Ruins geraten können, wenn sie nach einer Scheidung oder Kündigung das „Haus fürs Leben“ wieder verkaufen müssen, machen Niederländer dabei oft nicht einmal Verlust. Als Wagenaar und ihr Freund sich trennten, verkauften sie ihr Reihenhaus ungefähr zum Kaufpreis. Wagenaar zog zurück nach Amsterdam, wo sie mit ihrem inzwischen gestiegenen Gehalt den Sprung in ihre jetzige Wohnung wagte – für 390.000 Euro. In die 67 Quadratmeter zog später ihr neuer Freund und heutiger Mann mit ein.
Nun freut sich Wagenaar auf den Umzug ins neue Familienheim. Auch wenn sie es mit ihrem Mann zusammen noch gründlich renovieren muss. Sonst hätten sie sich keine 100 Quadratmeter in der teuersten Stadt der Niederlande leisten können.
Eines würde Wagenaar gern von den Deutschen wissen. „Es passiert so viel im Leben“, sagt sie. „Neuer Job, neuer Mann, eigene Familie… Wie soll es eine einzige Immobilie geben, die zu all dem passt? Könnt ihr mir das erklären?“