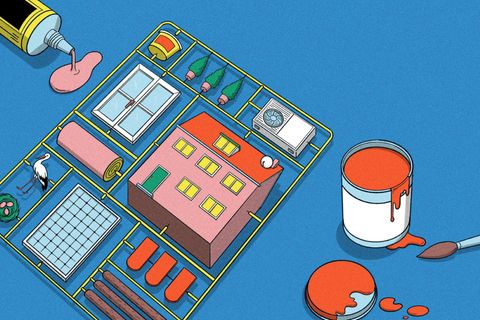Anders als Ölheizungen gelten Gasheizungen in Deutschland immer noch als relativ sauber. Der Wechsel zu Gas wird aktuell sogar staatlich subventioniert, sofern die Heizung mit erneuerbaren Energiequellen kombiniert wird. Reine Gasheizungen sind hingegen laut Koalitionsvertrag ab Anfang 2025 quasi verboten.
Dass der Staat den Einbau von Gasheizungen oder auch klimaschädlicher Holzheizungen in der ein oder anderen Form dennoch fördert, hält Gerald Neubauer, Energieexperte bei Greenpeace, für ökologisch kontraproduktiv: „Die Förderung sollte sich auf Wärmepumpen, Solarthermie und den Ausbau erneuerbarer Wärmenetze konzentrieren“, sagt er. Denn auch Gas als fossiler Energieträger setzt bei seiner Verbrennung CO2 frei.
Ginge es nach Greenpeace, dann gehörten fossile Heizungen gänzlich verboten. Denn jede Tonne CO2 ist eine zu viel – sowohl fürs Klima als auch fürs Portemonnaie. Aktuell liegt der Preis pro Tonne CO2-Emission bei 30 Euro. Das macht bei Erdgas einen Aufpreis in Höhe von netto 0,546 Cent pro Kilowattstunde. Bis 2025 soll der CO2-Preis kontinuierlich auf 55 Euro ansteigen. Heizen mit Gas wird also immer teurer.
Wärmepumpen als Alternative
Die Regierung will Deutschlands Stromversorgung bis 2035 vollständig auf erneuerbare Energien umstellen. Ein realistisches Ziel, heißt es von Greenpeace. Möglich machen das zahlreiche Alternativen, die schon längst auf dem Markt etabliert sind: sei es die Wärmepumpe, Biomasse-Anlage, Solarthermie, Gas-Hybridheizung, Erneuerbare-Energien-Hybridheizung oder die Fernwärme. Für Neubauer ist die Verbrennung von Biomasse keine sinnvolle Alternative zu fossilen Energieträgern. Holzheizungen stoßen große Mengen Feinstaub aus und schaden dem Klima. Zudem sind Wälder wichtige Klimaschützer. „Die Zukunft gehört Heiztechniken, die ganz ohne Verbrennungsprozesse auskommen“, prognostiziert der Energieexperte.
Wärmepumpen gewinnen Wärme aus der Außenluft, dem Grundwasser oder dem Erdreich. Seit einigen Jahren werden sie verstärkt nachgefragt. Da sie sich insbesondere für Häuser mit guter Dämmung und einer Flächenheizung eignen, kommen sie vorrangig für Neubauten infrage. Noch im Jahr 2010 lag der Anteil von Wärmepumpen im Neubau bei rund 29 Prozent. 2020 waren schon in 46 Prozent aller neu fertiggestellten Häuser Wärmepumpen installiert.
Aber auch Altbauten lassen sich mit Wärmepumpen beheizen. Ist die Fassade gedämmt und sind Fenster und Heizkörper auf neuestem Stand, steht einer Installation grundsätzlich nichts mehr im Wege. Handelt es sich um Wärmepumpen, die das Grundwasser oder Erdreich als Wärmequelle nutzen, muss sie die zuständige Untere Wasserbehörde vorab genehmigen. „Die Installation einer Wärmepumpe ist zwar in der Anschaffung teurer“, sagt Neubauer. „Doch bei steigenden Preisen für Öl und Gas sparen Wärmepumpen im Betrieb viel Geld.“
Umwelt- und kostenschonend heizen lässt sich auch mit Solarthermie. Die Schwester der Photovoltaik-Anlage nutzt Sonnenstrahlen, um Wärme zu erzeugen. Diese Solarwärme wird in einen Pufferspeicher geführt, der dann sowohl das Heizungssystem als auch die Wassererwärmung mit Wärme versorgt. Die Verbraucherzentrale empfiehlt, die Kollektorflächen der Anlage vor Einbau individuell anzupassen. Es sollte nicht mehr Sonnenwärme produziert werden, als der Haushalt tatsächlich verbraucht. Denn liefern die Solarkollektoren mehr Energie als der Pufferspeicher aufnehmen kann, führt dies im schlimmsten Fall zu einer Überhitzung. Schäden an der Anlage sind die Folge.
Fernwärme ist nicht immer umweltschonend
Das richtige Verhältnis zwischen Anlagefläche und Verbrauch ist also enorm wichtig – auch in puncto Wirtschaftlichkeit. Denn ob die Kosten, die bei Anschaffung, Montage und Wartung anfallen, mit der Zeit durch geringere Heizkosten ausgeglichen werden können, hängt neben dem Ertrag der Anlage auch von der Intensität der Nutzung ab. So rät die Verbraucherzentrale kleineren Haushalten mit bis zu zwei Personen von einem Einbau aktuell eher ab.
Wer mit Fernwärme heizen möchte, benötigt keine eigene Heizanlage. Kosten für Heizkessel, Brennstoffe, Reparaturen oder Schornsteinfeger fallen also weg. Die Wärme wird von Kraft- und Heizwerken erzeugt und durch Rohrsysteme nach Hause geliefert. Der Hausanschluss an ein Fernwärmenetz kann dagegen relativ teuer werden: Eigentümer müssen mit Beträgen zwischen etwa 8.000 und 15.000 Euro rechnen. Zudem ist ein Anschluss oftmals nur in urbanen Gebieten möglich. Wie umweltschonend Fernwärme ist, hängt vom Energieträger ab, mit der sie erzeugt wurde. Derzeit ist Gas mit einem Anteil von 40 Prozent an der deutschlandweiten Fernwärme der wichtigste Energieträger. Aber auch Stein- und Braunkohle, Müll oder Mineralöl kommen zum Einsatz.
Klimafreundlicher wird es dagegen, wenn die Fernwärme über Kraft-Wärme-Kopplung, also einer Kombination aus Strom und Heizwärme, erzeugt wird. Machen sich Kraftwerke die bei der Stromproduktion anfallende Wärme zunutze, kommen sie auf eine sehr hohe Energieausbeute von 80 Prozent. Nutzen sie die Wärme hingegen nicht, beträgt die Ausbeute lediglich die Hälfte.