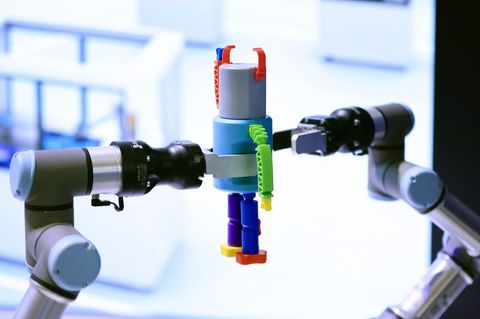Bis zum Jahr 2045 soll die Energieversorgung in Deutschland flächendeckend klimaneutral sein. Ein Großteil der Haushalte benötigt demnach früher oder später eine neue Form des Heizens – denn 70 Prozent der Heizungen laufen hierzulande noch über fossile Energieträger, also Öl oder Erdgas. Eine immer beliebter werdende klimafreundliche Alternative ist das Heizen über Geothermie, also die in der Erdkruste gespeicherte Wärme. Sie lässt sich nämlich mithilfe von Wärmepumpen für das Heizen und die Warmwasseraufbereitung in Gebäuden nutzen.
Wer ein Eigenheim baut oder seine alte Heizungsanlage ohnehin bald austauschen muss, wird Erdwärme womöglich in Erwägung ziehen. Allerdings stehen Eigenheimbesitzer dann erst mal vor vielen Fragen: Ist meine Immobilie überhaupt dafür geeignet? Und was kostet der Umstieg?
Zunächst einmal ist es wichtig zu verstehen, wie Heizen mit Erdwärme überhaupt funktioniert. Vereinfacht gesagt funktioniert eine erdwärmebetriebene Heizung wie ein Kühlschrank, nur umgekehrt. Sie entzieht dem Boden Wärme und gibt sie an das Gebäude ab. Unabhängig von der Jahreszeit hat die Erde nämlich ab einer bestimmten Bohrungstiefe immer eine Temperatur von zehn bis zwölf Grad Celsius. Bei einer Erdwärmeheizung zirkuliert in einem Rohrsystem im Boden eine Wärmeträgerflüssigkeit, zum Beispiel Wasser, die die Wärme des Bodens annimmt. Mithilfe einer strombetriebenen Wärmepumpe wird diese Flüssigkeit weiter erhitzt und als Wärmeträger in die Wohnung geschickt.
Der Vorteil: Das System ist besonders energieeffizient. Kommt der benötigte Strom zum Antrieb der Wärmepumpe aus erneuerbaren Quellen, ist diese Form des Heizens und Warmwasseraufbereitens sogar klimaneutral, Nutzer verbrauchen also keinerlei CO2.
Ausreichend Platz im Garten
Damit das Heizen mit Erdwärme sinnvoll möglich ist, müssen allerdings eine Reihe an Bedingungen erfüllt sein. „Das Haus sollte vor allem gut gedämmt sein, damit der Energieaufwand nicht verpufft“, sagt Ingenieur Raymond Krieger, Diplom-Ingenieur und Honorarmitarbeiter in der Energieberatung für die Verbraucherzentrale Bremen. In einem effizienten Haushalt könnte man beispielsweise mit einer Kilowattstunde elektrischer Energie, die zum Antrieb der Wärmepumpe benötigt wird, vier bis fünf Kilowattstunden an Energie zum Heizen gewinnen. Ist ein Haus aber schlecht oder gar nicht gedämmt, ist unter Umständen so viel elektrische Energie nötig, um eine angenehme Raumtemperatur zu erzeugen, dass sich das Heizen mit Erdwärme wiederum nicht lohnt. Auch die Heizkörper spielen eine Rolle: „Ideal sind Fußboden- oder Wandheizungen“, sagt Krieger. Diese benötigen eine geringere Vorlauftemperatur als klassische Konvektionsheizkörper – das Wasser muss also vorab auf eine geringere Temperatur erwärmt werden, um die gleiche Raumtemperatur zu erzeugen wie herkömmliche Heizkörper.
Außerdem benötigt eine Erdwärmeheizung vor allem Platz im Garten. Wieviel genau hängt vom Heizungstyp ab. „Bei einem System mit Flächenkollektor benötigen Eigentümer für die Rohre etwa das Doppelte ihrer Wohnfläche“, sagt Krieger. Ein großer Garten ist also bei einem Erdwärmekollektor ein Muss. Die Rohre werden bei dieser Methode nur in einem bis zwei Metern Tiefe verlegt.
Wer weniger Quadratmeter an Fläche zu Verfügung hat, muss Erdwärmesonden in die Tiefe schicken: Dabei werden Rohre in 80 bis 150 Metern Tiefe gebohrt. Die benötigte Tiefe hängt von der Zusammensetzung der Erdschichten ab und wird mithilfe eines geologischen Gutachtens ermittelt. In diesem Fall reichen in der Breite 20 Quadratmeter Fläche und Platz für einen Lkw. Eine weitere Besonderheit der Erdwärmesonden: Sie dürfen nicht im Wasserschutzgebiet installiert werden. Vorab sollten sich Immobilienbesitzer also unbedingt die Genehmigung ihrer Kommune einholen.
Wann amortisiert sich eine Wärmepumpe?
Steht einmal fest, dass der Einbau einer Erdwärmeheizung möglich ist, bleibt für Eigentümer noch die Kostenfrage. Wie hoch diese für die Installation der Heizanlage ausfallen, hängt sehr stark von der Immobilie und den Dienstleistern ab. Im Schnitt können sich Hausbesitzer, die sich für die Variante mit der Erdwärmesonde entscheiden, auf Kosten ab rund 35.000 Euro einstellen, sagt der Energieexperte. Darunter fallen Bohrung und Erdwärmesonden für rund 10.000 Euro, die Wärmepumpe für rund 20.000 Euro und zusätzliche Kosten, sofern die Eigentümer ihre Heizkörper umrüsten müssen.
Wie viele Jahre es dauert, bis sich die Installation durch die eingesparten Heizkosten amortisiert, lässt sich schwer beantworten, denn das hängt von der Entwicklung der Energiepreise ab, sagt der Experte. Bei den bisherigen Energiepreisen zahlte sich die Installation laut dem Energieberater nach zirka 30 Jahren aus. Allerdings sollten Eigentümer in die Kalkulation mit einbeziehen, dass sie ihre Heizungsanlage ohnehin alle 30 Jahre austauschen müssen – und der Einbau einer neuen Erdgas- oder Öl-Heizungsanlage würde sie ebenfalls Geld kosten. Derzeit können Eigentümer außerdem von der Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG) des Bundesamts für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) profitieren. Wer von einem Heizkessel auf eine Wärmepumpe umsteigt, bekommt zum Beispiel einen Zuschuss von 45 Prozent. Wer dabei einen Energieberater zurate zieht – was ohnehin empfehlenswert ist – bekommt sogar 50 Prozent der Kosten für die Wärmepumpe vom Staat.