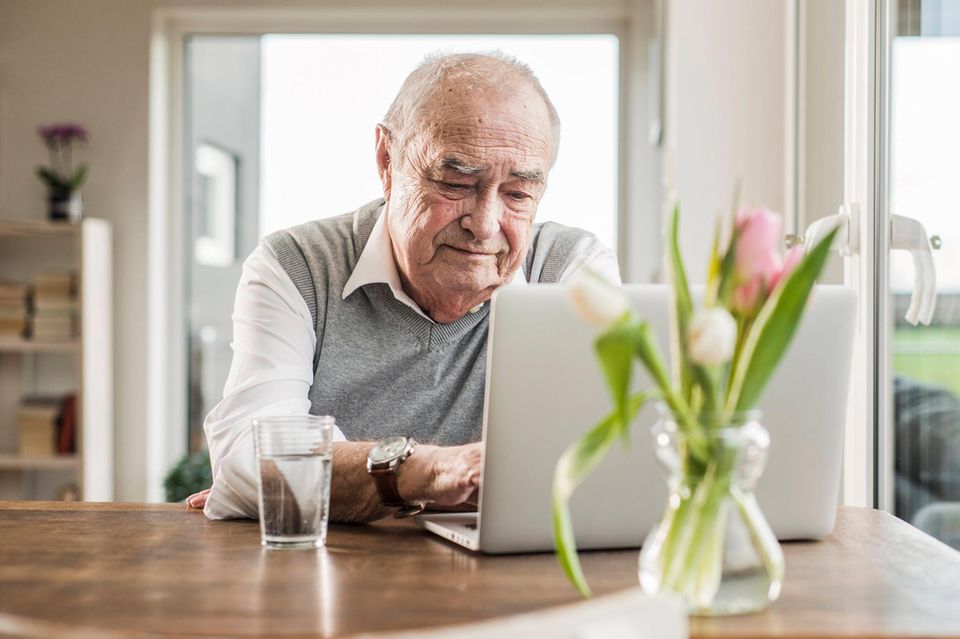Nadine Oberhuber ist Wirtschafts- und Finanzjournalistin. Sie schreibt auf Capital.de über Geldanlagethemen
Viel hilft viel, so denken manche Menschen und langen noch einmal richtig zu. Egal ob beim Sport, beim Lernen, beim Schenken, bei der Aufnahme von Vitaminen oder Informationen – besser man bekommt vom Guten ein bisschen mehr, als auch nur ansatzweise zu wenig. So dachte es sich auch der Gesetzgeber, als er das Kleinanlegerschutzgesetz auf den Weg brachte. Es soll noch im Frühling in Kraft treten und Privatleuten künftig das Geldanlegen erleichtern. Es will nämlich für eine bessere Information der Kleinanleger bei bestimmten Kapitalanlagen sorgen. Die Idee an sich ist gut, aber das Gesetz höchst umstritten. Denn weniger wäre in diesem Falle mehr gewesen.
Natürlich würden sich viele Beteiligte mehr Information wünschen. Gerade bei komplizierten Beteiligungsmodellen, also auf dem weitgehend unregulierten Grauen Kapitalmarkt. Der vernichtet regelmäßig große Summen, weil Anleger allzu oft in Papiere investieren, deren Konstruktion sie kaum verstehen und deren Risiko sie unterschätzen. Weil sie Firmen glauben, die mit Ertragsprognosen am Markt auftreten, die sie später leider nicht einhalten können. Nun ist die gesamte Finanzbranche zuletzt nicht gerade dadurch aufgefallen, dass sie Produkte für Kunden verständlich konstruierte. Von daher wären genauere Erklärungen durchaus wünschenswert. Doch wie müssten sie aussehen?
„Aktionsplan“ samt „Maßnahmepaket“
Klar ist für viele Beteiligte: Dieses Land braucht mehr Anlegerschutz. Das sagt die Bundesregierung und das bekräftigen auch Verbraucherschützer. Zuletzt zeigte die Großpleite der Windkraftfirma Prokon das wieder einmal eindrucksvoll. Gut 75.000 Anleger können dadurch rund 1,4 Mrd. Euro in den Wind schreiben. Die Prokon-Insolvenz war auch Auslöser für das neue Gesetz, das nun so schnell wie möglich kommen soll.
Sie war aber längst nicht der einzige Fall, bei dem Privatleute viel Geld am unregulierten Kapitalmarkt verloren haben: Rund 450 Schifffonds soffen in den vergangenen Jahren ab, Film-, Medien- und Immobilienfonds bescherten hohe Verluste, Wohnungen entpuppten sich als Schrottimmobilien und Biogasanlagen als Hochrisikoprojekte. Jahr für Jahr, so schätzte eine Studie im Auftrag des Justizministeriums, versenken Anleger rund 20 bis 30 Mrd. Euro, weil sie wegen mangelhafter Information und Beratung die falschen Vermögensanlagen kaufen und diese oft vorzeitig mit Verlust wieder abstoßen. Das ist Grund genug, einen „Aktionsplan“ samt „Maßnahmepaket“ aufzusetzen, um Totalausfälle künftig zu verhindern, meint die Politik.
Die spannende Frage ist nur: Wie lassen sich Anleger besser schützen? Mit mehr Information, glaubt das Gesetz. Künftig müssen alle Anbieter von Beteiligungen, Genussscheinen, Nachrangdarlehen und Crowdfunding einen Verkaufsprospekt vorlegen, egal ob es um die Investition in Teakholzplantagen, Frachtcontainer, Dorfläden oder erneuerbare Energieanlagen geht. Im Prospekt müssen sich Angaben zur Firma, den Finanzdaten und Risiken finden, die mit der Investition verbunden sind.
Dicke Prospekte liest kein Mensch
Allerdings gibt es schon viele solcher Prospekte. Auch der Windkraftbetreiber Prokon reichte sie an seine Anleger aus – und machte trotzdem dicht. Mit Informationen geizen die Firmen nie, viele Prospekte sind über 100 Seiten dick. Das alles liest aber kein Mensch. Weil es schon jetzt viel zu viel ist. Privatleute legen solche Prospekte lediglich ins Regal. Und das ist auch in Ordnung so, entschied der Bundesgerichtshof.
Wer sich doch hindurchkämpft, versteht oft kein Wort: „Die gesamte Vermögenseinlage der Genussrechtsinhaber haftet jedoch nachrangig nach dem sonstigen Eigenkapital, insbesondere nach dem Kommanditkapital, für Verbindlichkeiten der Emittentin. Das Genussrechtskapital wird also im Falle eines Insolvenzverfahrens oder der Liquidation der Emittentin vor dem Kommanditkapital, aber nach Befriedigung aller nicht nachrangigen Ansprüche der Gläubiger zurückgezahlt.“ Zurückzahlen klingt gut, denken dann fast alle. Dass hier in Wahrheit steht, dass der Anleger im Pleitefall wahrscheinlich keinen Cent bekommt, erfasst so gut wie niemand.
Genauso wenig verstehen die meisten Anleger andere Informationen, die sie von Banken und Finanzberatern bekommen. Wissenschaftler haben die sprachliche Qualität von Produktinformationsblättern und Beratungsprotokollen untersucht, die seit ein paar Jahren ebenfalls pflichtgemäß ausgereicht werden müssen und entlarvten: Die Texte der Banken enthalten Bandwurmsätze und Schachtelkonstruktionen mit bis zu 119 Wörtern, sind voll von Anglizismen und komplizierten Verweisen auf allerlei Paragraphen. Man müsse schon studiert haben, um die zu verstehen. Am besten Betriebswirtschaft, Jura und Hermeneutik.
Die Prospektsprache versteht kein Mensch
Es geht also nicht um noch mehr Informationen, es geht um bessere. Das erkannte die US-Aufsichtsbehörde SEC schon vor geraumer Zeit. Sie rief 1996 eine Verständlichkeitsinitiative ins Leben, um Wertpapierprospekte leichter lesbar zu machen. Verständliche Wortwahl, einfache Satzstruktur, möglichst aktive Verben und keine Fachwörter, das war die Vorgabe. Und siehe da, Untersuchungen fanden heraus: Je einfacher die Prospekte geschrieben sind, desto mehr Menschen lesen sie auch. Und verstehen sie sogar. Die bloße Prospektpflicht dagegen laufe völlig ins Leere, solange wesentliche Inhalte so unverständlich ausgedrückt werden, dass sich die Anleger überfordert fühlen. Sie führe sogar geradezu vermehrt zu Fehlinvestments, weil sich die Investoren unter dem Finanzprodukt etwas völlig anderes vorstellten.
Hierzulande diskutiert man allenfalls mal vor Gericht, wie kompliziert ein Prospekt formuliert sein darf, also nur wenn Investments bereits schiefgegangen sind. Müssen nur berufsmäßige Investoren solche Broschüren verstehen oder auch Durchschnittsanleger? Wie sieht der Durchschnittsanleger überhaupt aus? Richter reden gern vom „verständigen und sorgfältigen Anleger“, von dem man schon erwarten könne, dass er eine Bilanz, also auch einen Prospekt lesen kann. Mit dem Normalanleger hat das wenig zu tun, sagen viele Juristen. Von denen kenne sich kaum einer mit Bilanzierungsregeln aus, zumal mit ausländischen.
Hinzu kommt, dass in den Prospekten ohnehin viel zu viel steht. Denn, so warnt auch die Aufsichtsbehörde BaFin immer wieder: „Eine inhaltliche Prüfung der Prospektangaben findet nicht statt. (...) Die BaFin billigt den Prospekt, nicht jedoch das Produkt als solches. Sie trifft auch keine Aussage über die Seriosität oder die Bonität des Emittenten.“ Ob die Zahlen darin also seriösen Kalkulationen entstammen oder reine Luftnummern sind, weiß außer dem Anbieter niemand.
Künftig kann die BaFin zwar die Rechnungslegung von Anbietern überprüfen lassen, wenn sie den Verdacht hat, dass etwas nicht stimmt. Und sie kann den Vertrieb bestimmter Produkte beschränken oder sogar verbieten, auch das steht im geplanten Gesetz. Doch schon jetzt ächzt die Behörde unter der Arbeitsbelastung. Und sie betont, dass die Anbieter solcher Finanzanlagen – anders als Banken und Finanzdienstleistungsinstitute – auch weiterhin nicht von ihr beaufsichtigt und kontrolliert werden. Von daher darf man gespannt sein, ob und wann es überhaupt zu solchen Verboten kommt.
Im Grunde kann man all diese Informationen in drei Sätzen zusammenfassen: Natürlich kann man in Unternehmensbeteiligungen, geschlossene Fonds oder Crowdfunding sein Geld stecken – wenn man notfalls einen Totalverlust verschmerzen kann. Mehr als zehn Prozent des liquiden Kapitals oder zwei Monatsgehälter sollten es aber keinesfalls sein. Nur viel Vorsicht hilft also viel, denn wer nicht zu viel riskiert, kann auch nicht zu viel verlieren. Schon Paracelsus wusste: Alles ist Gift und nichts ist ohne Gift - nur auf die Dosis kommt es an.