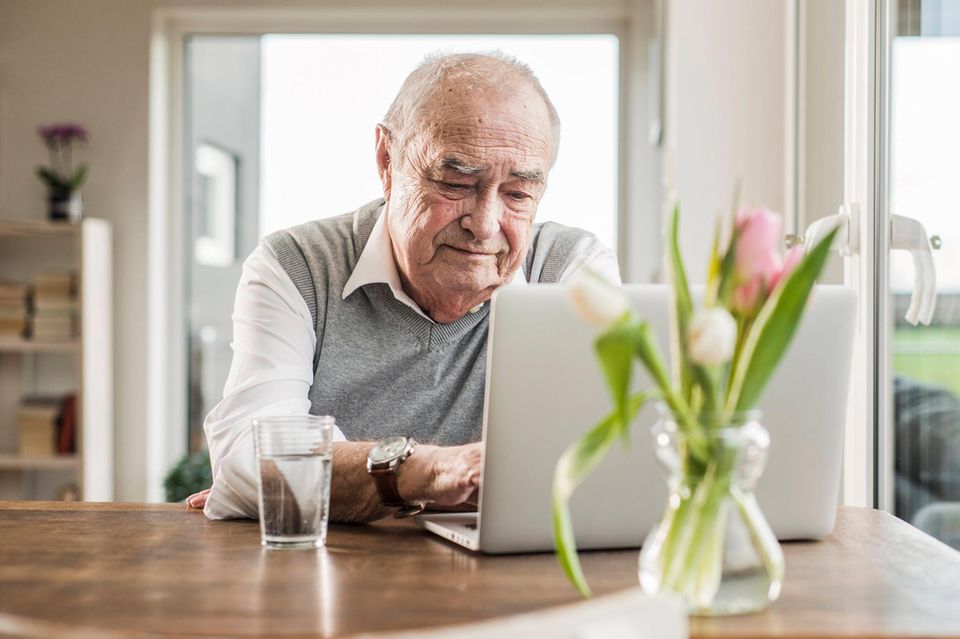Noch existiert die Rezession nur anekdotisch. Hier und da berichten Firmen von Entlassungen, wirtschaftlichen Problemen oder verschärftem Wettbewerb. In der Realität aber sind die Zahlen dann meist doch besser als befürchtet. Die Frage ist, ob das so bleibt. Ökonomen warnen seit Monaten vor einem Abschwung – und lagen damit bislang immer falsch.
Allerdings gibt es einen Datenpunkt, der die These der Warner tatsächlich historisch stützt: die inverse Zinskurve. Sie war stets einer der zuverlässigsten Indikatoren für eine Rezession. Und glaubt man der Kurve, dann steht der konjunkturelle Einbruch schon bald bevor.
Die inverse Zinskurve bezieht sich dabei auf die Anleihenmärkte. Sind die Renditen für kurzlaufende Anleihen, üblicherweise solche mit Laufzeiten von zwei Jahren, höher als die Renditen für zehnjährige – also langlaufende – Anleihen, wird sie als „invers“ bezeichnet. Die dahinterliegende Idee ist einfach: Da Investoren mit einer Rezession rechnen, erwarten sie langfristig sinkende Leitzinsen der Zentralbanken, um dem wirtschaftlichen Abschwung zu begegnen. Und sinkende Leitzinsen gehen üblicherweise mit sinkenden Anleiherenditen einher – allerdings nicht zu verwechseln mit Anleihekursen, die sich umgekehrt zum Zins verhalten. Da Investoren aber erst langfristig damit rechnen, schlägt sich dies nicht in den kurzlaufenden Anleihen nieder, sondern erst in den langfristigen, zehnjährigen Bonds.
Der Normalfall ist umgekehrt: Investoren verlangen üblicherweise eine höhere Rendite, wenn sie ihr Vermögen längerfristig abgeben. Diese Logik – höhere Renditen für langlaufende Anleihen – greift aber schon seit Juni 2022 nicht mehr. Zuletzt bekamen Investoren für zweijährige US-Staatsanleihen beispielsweise 3,974 Prozent Rendite, während sie für das zehnjährige Pendant nur 3,422 Prozent erhielten. Der Renditeabstand ist in den vergangenen Monaten sogar noch gestiegen. Der Höhepunkt lag kurz vor Ausbruch des Bankenbebens Mitte März bei 1,1 Prozentpunkten. Höher lag die Differenz zuletzt Anfang der 1980er-Jahre.
Fed erwartet „milde Rezession“
Zwar hat sich die Inversion seitdem leicht verringert, doch bei 0,56 Prozentpunkten liegt sie in den USA noch immer auf einem hohen Niveau. Auch in der EU ist die Situation ähnlich: Deutsche Bundesanleihen bringen über zwei Jahre mit 2,86 Prozent mehr Rendite als über zehn Jahre (2,38 Prozent). Investoren und Ökonomen werten dies als Signal für eine heraufziehende Rezession. „Die Inversion der Zinskurve war in der Vergangenheit ein wichtiges Signal dafür“, erklärt Risikomanagement-Berater André Horovitz gegenüber Capital.
Selbst die Fed geht mittlerweile von einer „milden Rezession“ im Laufe des Jahres aus. Das geht aus den Sitzungsprotokollen der Notenbanker hervor, die in der vergangenen Woche veröffentlicht wurden. Sie verweist auf die historischen Erfahrungen – und auf den Umstand, dass Probleme im Finanzsektor häufig zu länger anhaltenden Rezessionen führen. Gewissermaßen hat die Fed diese Probleme auch selbst induziert: Die US-Währungshüter haben die Zinsen innerhalb eines Jahres von nahe null auf fast fünf Prozent angehoben, um die Inflation zu bekämpfen.
Damit hat sie allerdings einige Banken überrumpelt, die die Einlagen ihrer Kunden in langlaufende Anleihen investiert hatten. Selbst wenn Anleihen zehn Jahre laufen, können diese täglich gehandelt werden. Durch Zinssteigerungen verlieren sie allerdings an Wert. Das ist normalerweise kein Problem, solange Banken die Anleihen bis zum Ende der Fälligkeit halten – also über die kompletten zehn Jahre. Dann erhalten sie den Nennwert der Anleihe zurück. Doch als Kunden anfingen, ihre Einlagen aufzuzehren, mussten Banken die langlaufenden Anleihen veräußern, und die Verluste realisieren. Zuerst fiel dadurch die Silicon Valley Bank, später folgten Institute wie die Silverbank oder Credit Suisse – auch wenn die Probleme nicht immer gleich waren.
Die Probleme im Finanzsektor könnten die Rezession nun beschleunigen, meinen die Notenbanker. Besondere Aufmerksamkeit schenken sie dabei dem Arbeitsmarkt. Bislang hat dieser die Zinsschritte gut verkraftet und die Hoffnungen auf eine weiche Landung geschürt – dass also die Inflation ohne große Wohlstandsverluste sinkt. Inzwischen haben sich die Vorzeichen aber etwas umgekehrt. In den USA wurden zuletzt den dritten Monat in Folge weniger Stellen geschaffen. Und auch in Deutschland gab es im März 232.000 Arbeitslose mehr als im Vorjahr. „Die Frühjahrsbelebung setzt nur verhalten ein“, sagte Andrea Nahles, Vorstand der Agentur für Arbeit.
Fokus auf den Jobmarkt
Und dennoch zeigte sich der Jobmarkt in Summe stabil. Auf Dauer könnte das zum Problem werden. Ökonom Michael Bauer warnt gegenüber dem „Handelsblatt“: „Solange der Arbeitsmarkt robust ist, wird es Lohnwachstum geben, und die Inflation bleibt auf einem sehr hohen Niveau. Die Fed wird dann mit weiteren Zinserhöhungen gegensteuern.“ Das würde wiederum die Stabilität des Finanzsystems gefährden und Unternehmen müssten mehr für Kredite zahlen – wenn sie überhaupt noch frisches Geld bekommen. Mittlerweile deutet sich nämlich an, dass Banken vorsichtiger bei der Kreditvergabe werden. Eine Kreditklemme induziert in aller Regel ebenfalls eine Rezession. Auch Bauer hält es deshalb für unwahrscheinlich, dass der Arbeitsmarkt stabil bleibt und die Inflation trotzdem fällt.
Immer mehr Analysten kommen zu diesem Schluss – und sind der Ansicht, dass die Inflation nicht ohne Rezession gebrochen werden kann. Und das wird wiederum auf lange Sicht zu sinkenden Zinsen führen, um die Konjunktur zu beleben. Genau das zeigt sich auch in der inversen Zinskurve.