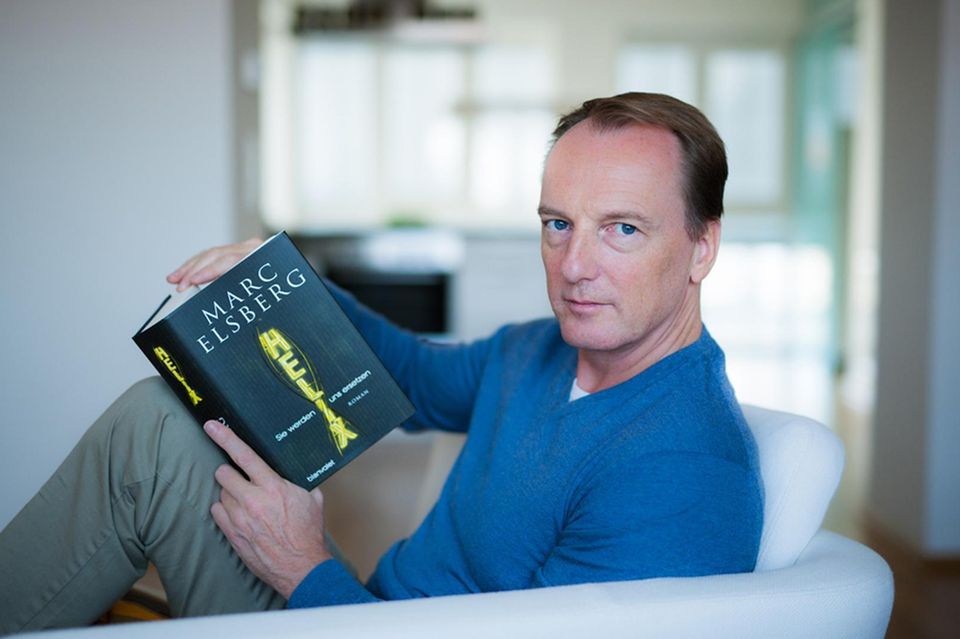Christian Kirchner ist Frankfurt-Korrespondent von Capital. Er schreibt an dieser Stelle regelmäßig über Geldanlagethemen. Hier können Sie ihm auf Twitter folgen
Viele selbsternannte Finanzexperten haben eine einfache Erfolgsstrategie: Sie lassen fortlaufend Prognosen vom Stapel, von denen schon aus purem Zufall rund die Hälfte eintritt. Ein Jahr später kramen sie dann natürlich nur die richtigen Prognosen hervor und können sich meist darauf verlassen, dass die Zuhörer und Leser die andere Hälfte längst vergessen hat. Wenn man dieses Prinzip auf die Spitze treiben will, macht man es wie eines der bekanntesten Börsengesichter Deutschlands, der stets rät: „Aktien ja – aber mit Absicherung!“, was zu einer unschlagbaren Trefferquote von 100 Prozent in jedem Szenario führt: Er hat recht sowohl bei steigenden (ich habe doch gesagt: Aktien kaufen!) als auch bei fallenden Kursen (ich habe Ihnen doch gesagt: absichern!).
Schauen wir auf eine Prognose, bei der ich persönlich komplett daneben lag. Denn ich schrieb hier vor gut einem Jahr, dass man mit Blick auf 2015 der großen Konsenswette des starken Dollars misstrauen sollte. Das war eine persönliche Meinung von mir, keine „Hausmeinung“ von Capital. Aber eben auch eine, die Mist war.
Was mich damals irritierte: Fast alle Banken und Fondsgesellschaften sagten für 2015 einen schwachen Euro zum US-Dollar voraus – und solche „großen“ Konsenswetten sind in der Regel Zeichen dafür, dass es bald ganz anders läuft, zumal auch Spekulanten stark auf einen Verfall des Euro wetteten und der baldige Beginn von Staatsanleihenaufkäufen ausgemachte Sache war.
Was aber passierte? Der Euro verlor zum US-Dollar tatsächlich rund acht Prozent im bisherigen Jahresverlauf, sehr zur Freude der EZB, die das implizite Ziel hat, über einen schwachen Euro die Wirtschaft zu stützen und eine Deflation zu verhindern. Und sehr zur Freude von Anlegern globaler Aktien- und Anleihenfonds. Denn so sorgte wenigstens der schwache Euro für ein schmales Kursplus bei per saldo stagnierenden globalen sowie nordamerikanischen Aktien- und Anleihenmärkten.
Nicht den Helden spielen
Der Fall zeigt: Wenn sich (fast) alle über etwas einig sind, kann es eben auch mal genau so kommen in einer Welt, in der immer mehr Akteure stumpf prozyklisch investieren und Trends folgen, ganz egal wie die Fundamentaldaten aussehen.
Womit sich der Kreis schließt zu den Prognosen für 2016: Die größte „Konsenswette“ mit Blick auf 2016 scheint mir nach Besuch vieler Ausblicke und der Lektüre vieler Studien das Ende des Bullenmarkts von Eurozonen-Staatsanleihen im Allgemeinen und Bundesanleihen im Besonderen zu sein. Man findet schlicht kaum Strategen, die bei einer Rendite von 0,5 Prozent für zehnjährige Bundesanleihen noch zum Kauf raten, aber sehr viele, die von (temporären) Verlusten in zweistelliger Höhe über die nächsten Jahre warnen. Selbst der größte Optimist glaubt, dass die Renditen zehnjähriger Bundesanleihen per Ende 2016 unverändert sein werden, der Durchschnitt glaubt an einen Sprung auf 1,1 Prozent.
Ein echter Antizykliker müsste also eigentlich konsequent darauf wetten, dass die Zinsen – entgegen der Erwartungen der Masse – tatsächlich noch weiter fallen können. Und ist es nicht seit Jahren so, dass Auguren die Zinswende vorhersagen, die Zinsen aber am Ende doch noch ein Stückchen weiter fallen?
Anleger tun gut daran, hier derzeit nicht den Helden spielen zu wollen. Denn es spricht viel dafür, dass das Gros der Strategen – ähnlich wie mit der Dollarprognose für 2015 – mit der Konsenswette 2016 richtig liegt: Dass die Zinsen von Bundesanleihen wieder klettern. Dazu ist nicht einmal eine Kehrtwende der Geldpolitik der EZB erforderlich, die wohl noch lange lax bleiben wird. Folgt man der einfachen Faustformel, dass die Renditen der Anleihen sich grob aus der Summe des Wirtschaftswachstums und der Inflation zusammensetzen, sollten Bundesanleihen eigentlich schon bald wenigstens wieder eine „Eins“ vor dem Komma haben. Schließlich wollen Anleihegläubiger mindestens für die Teuerung entschädigt werden. Dass dies noch nicht der Fall ist, liegt vor allem am laufenden Aufkaufprogramm der EZB und den durch die niedrigen Energiepreise noch gedrückten Inflationsraten – beides Effekte, die schon im Laufe des Jahres 2016 auslaufen können. Und die Zinsen werden bestimmt nicht erst zu klettern beginnen, wenn die EZB mit dem Kaufen aufhört, sondern schon deutlich vorher – wenn am Anleihenmarkt das nahende Ende aufgrund der Wirtschafts- und Inflationsdaten antizipiert wird.
Selbst Tagesgeld wirft höhere Zinsen ab
Zudem entwickeln die derzeit höheren US-Zinsen eine Gravitationskraft auch auf europäische Anleihen, denn wird die Zinsdifferenz zu groß, liquidieren Großinvestoren irgendwann ihre Euro-Staatsanleihenbestände und legen es in den USA an, wo selbst kurzlaufende Anleihen wieder Nominalrenditen von einem Prozent bringen.
Überhaupt, die Großinvestoren: Staatsfonds und Notenbanken waren viele Jahre lang verlässliche Käufer von Staatsanleihen guter Bonität sowohl in den USA als auch Europa, um Reserven aufzubauen. Bereits Ende 2014 ist dieser Trend gekippt, sie verkaufen netto mehr Reserven, als sie aufbauen, werden also von Nettokäufern zu Nettoverkäufern von Staatsanleihen – ein Trend, der von einem immer tiefer sinkenden Ölpreis und immer geringeren Überschüssen der reichen Ölstaaten und immer schwierigeren Haushaltslagen in Schwellenländern noch beschleunigt werden dürfte.
Mit Blick auf die mageren oder gar negativen Renditen von Bundesanleihen müssen sich Anleger zudem die Frage stellen, welches absurde Chance-Risiko-Verhältnis die Papiere noch bieten. Zu gewinnen gibt es wenig, selbst Tagesgeld wirft, wenn man es klug anstellt, höhere Zinsen ab.
kräftiger Zinsanstieg nicht ausgeschlossen
Zu verlieren hingegen eine Menge. Bei den minimalen Restrenditen genügt schon ein kleiner Sprung der Renditen nach oben, um die Kurse wegsacken zu lassen. Alleine die unmittelbare Reaktion auf die Verlängerung des Aufkaufprogramms für Staatsanleihen durch die EZB vergangene Woche – der Markt hatte mehr erwartet – ließ die Kurse zehnjähriger Bundesanleihen um rund eineinhalb Prozent einbrechen. Nicht viel, ja, aber damit waren die Zinseinnahmen von drei Jahren zunächst futsch, es sei denn, die Kurse erholen sich wieder oder man hat ohnehin zehn Jahre Zeit.
Zudem lohnt sich die Frage, welches „Tail Risk“ sichere Staatsanleihen derzeit womöglich bergen, also ein Risiko, welches sich in einer grafischen Darstellung künftiger Renditen am äußersten Rand befindet. Schließlich gilt ebenfalls als Konsensmeinung, dass ein drastischer Zinsanstieg quasi ausgeschlossen sei. Diese Nachricht hat sich sogar bis hinunter zu den Privatanlegern herumgesprochen: Nachdem ihnen nun jahrelang die Zinswende vorhergesagt wurde, glauben inzwischen laut einer Umfrage von Goldman Sachs Asset Management in Deutschland aus dem Oktober zwei Drittel der Anleger, dass das derzeitig historisch niedrige Zinsniveau in Europa weitere drei bis fünf Jahre oder sogar länger anhalten wird.
Auszuschließen ist ein sehr kräftiger Zinsanstieg jedenfalls nicht. Ein britischer Fondsmanager beschrieb die Situation am Rentenmarkt vor kurzem einmal „off the record“ so, dass man die Renditen, aber auch die Schwankungen der Anleihen einen langen Zeitraum unterdrücken könnte mit Aufkäufen, genauso, wie man auch einen luftgefüllten Ball lange und tief unter Wasser drücken könnte. Irgendwann tauche er aber wieder auf, egal, wie lange man damit herumspiele unter Wasser. Manchmal gelänge es, ihn sanft an die Oberfläche gleiten zu lassen. Die Wahrscheinlichkeit sei aber größer, dass er einem entgleite und raketengleich in die Luft schösse.