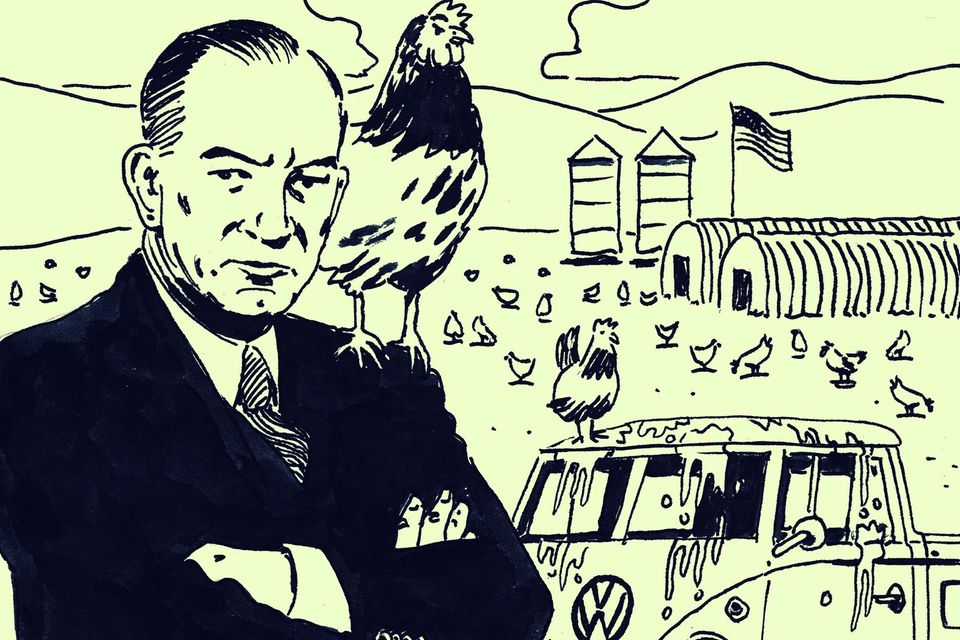Christian Kirchner ist Frankfurt-Korrespondent von Capital. Er schreibt an dieser Stelle regelmäßig über Geldanlagethemen. Hier können Sie ihm auf Twitter folgen
Die US-Notenbank hat am späten Donnerstag entschieden, die Leitzinsen unverändert auf einem Rekordtief zu belassen und damit die erste Leitzinserhöhung seit fast zehn Jahren vorerst aufgeschoben. Überraschender als diese Entscheidung an sich – ohnehin betrug die Wahrscheinlichkeit für einen Zinsschritt laut Umfragen lediglich rund 30 Prozent – war ihre Begründung: Obwohl die US-Arbeitslosenquote mit 5,1 Prozent eine Region erreicht hat, in der die US-Notenbank laut früheren Aussagen eigentlich mit der Normalisierung der Leitzinsen beginnen wollte und die US-Wirtschaft weiter wächst, sorgen sich die Notenbänker um Fed-Chefin Janet Yellen um die Lage in den Schwellenländern und China und die daraus resultierenden Risiken für Konjunktur und Inflation.
Schicken wir vorweg, dass es derzeit mit der Situation hunderttausender Flüchtlinge gesellschaftlich und politisch mit Sicherheit weit wichtigere Themen gibt, als die Implikationen eines Notenbankentscheids. Dennoch sind die unverändert rekordniedrigen Leitzinsen keine guten Nachrichten für Investoren und ebenso gefährlich wie eine rasche Kette von Zinsanhebungen, wie sie noch vor drei Monaten für wahrscheinlich erachtet wurde.
Die Schwierigkeit liegt dabei nicht einmal in dem schwachen Argument, die US-Notenbank müsse rasch die Zinsen anheben, um im Falle eines Abschwungs wieder Munition in Form von Zinssenkungen zu haben. Denn einerseits verpasst auch niemand einem anderen wie in dem alten Schulhofwitz ein blaues Auge, nur damit dieser sich über das schöne Gefühl des nachlassenden Schmerzes freut. Andererseits ist das Arsenal der Notenbanken auch ohne eine Leitzinsanhebung noch prall gefüllt mit heute undenkbar klingenden Maßnahmen.
Laxe Geldpolitik droht Wirkung zu verfehlen
Betrachten wir die Entscheidung lieber – erstens – auf kurzfristige Sicht: Es gibt vermutlich kaum einen Anleger weltweit, der in den vergangenen Wochen nicht von den Risiken gehört hat, die von steigenden Leitzinsen gerade für die Schwellenländer ausgehen könnten: Höhere Leitzinsen führen meistens zu einem festeren US-Dollar und höheren US-Kapitalmarktzinsen– beides Entwicklungen, die für gerade stark verschuldete Schwellenländer gefährlich sind. Dass die US-Notenbank mit dem expliziten Verweis auf die von den Schwellenländern ausgehenden Risiken auf einen Zinsschritt verzichtet, ist ein Hinweis darauf, dass sie die Lage in den aufstrebenden Ländern und China womöglich für noch gefährlicher hält, als es die meisten anderen Kapitalmarktteilnehmer tun. Schließlich wäre kein Schwellenlandinvestor vor Schreck aus dem Bett gefallen und hätte in Panik verkauft, wären die Leitzinsen tatsächlich leicht gestiegen.
Nehmen wir – zweitens – die mittlere Sicht: Seit einigen Monaten mehren sich unübersehbar die Zeichen, dass selbst eine unverändert extrem laxe Geldpolitik am Kapitalmarkt ihre Wirkung zu verfehlen droht – selbst wenn man die Realwirtschaft außen vor lässt. So zeigten sich die Renditen von Staatsanleihen in Deutschland unbeeindruckt von den Turbulenzen an den Aktienmärkten wie auch dem lauten Nachdenken der EZB über eine Ausweitung des Anleihenaufkaufprogramms – naheliegender wäre ein Zinsrückgang gewesen. Auch die Inflationserwartungen – deren Anhebung das explizite Ziel des Programms ist – sind zuletzt für die Eurozone wieder gesunken.
Zudem droht die EZB auch an einem wichtigen impliziten Ziel des Aufkaufprogramms – die Schwächung des Euros, um damit die Wirtschaft anzukurbeln – zu scheitern, denn statt zu fallen ist der Euro seit Wochen auf Klettertour zum US-Dollar.
In Japan wiederum, wo das Prinzip des billigen Geldes aggressiver als in jedem anderen Industrieland praktiziert wird, summieren sich die Kapitalabflüsse ausländischer Investoren auf Beträge, die weit über den Abflüssen unmittelbar nach dem Kobe-Beben 2011 oder sogar der Finanzkrise 2008 liegen. Einer der Hauptgründe für diese Entwicklungen: Unter dem Strich haben staatsnahe Investoren und Notenbanken nach einem zuvor jahrelangen Aufbau bereits Ende 2014 mit der Liquidation von Reserven begonnen. Sie kontern damit Wachstumsschwächen oder wegbrechende Erlöse etwa von Rohstoffexporten.
Sehnsucht nach Normalität
Nach sieben Jahren extrem niedriger Zinsen und großzügiger Notenbankhilfen sehnen sich viele Investoren nach einem kleinen bisschen Normalität in der Geldpolitik – eine Normalität, deren Einkehr gerade die US-Notenbank im Zweifel lieber auf später verschiebt.
Fraglos haben Investoren davon jahrelang profitiert, haben Niedrigzinsen und Anleihenaufkäufe zum starken Anstieg der Aktien- und Immobilienpreise beigetragen. Nun muss man allerdings auch nicht studiert haben für die Erkenntnis, dass extrem niedrige Zinsen die Gefahr großer Fehlallokationen und Spekulationsblasen bergen – ein Risiko, dass der Vorstandsvorsitzende einer deutschen Bank in der vergangenen Woche im informellen Kreis als das größte wirtschaftliche Risiko der kommenden Dekade bezeichnet hat.
Und je länger die Phase der extrem niedrigen Leitzinsen anhält, desto größer wird diese Gefahr und umso schmerzhafter die Prozesse, Fehlallokationen wieder zu korrigieren. Dass die Notenbankeingriffe und Regulierungsschritte der letzten Jahre die Liquidität in vielen Märkten dramatisch hat schrumpfen lassen, potenziert die Gefahr erratischer Ausschläge. Dazu zwei Beispiele: Offiziell werden schon heute gerade einmal ein Prozent aller US-Unternehmensanleihen nur einmal pro Tag gehandelt – inoffiziell berichten Händler, dass an turbulenten Tagen selbst für Euro-Staatsanleihen von Peripherieländern kaum Kurse zu bekommen sind.
Es knirscht wieder hörbar im Finanzsystem
Hinzu kommt, dass sich Investoren nun auch häufiger fragen, was eigentlich passiert, wenn die Niedrigzinsen doch keine Episode sind, sondern auf lange Sicht gekommen sind, um zu bleiben. Gut zu beobachten war dies in den vergangenen Tagen im dramatischen Absturz der Versorgeraktien Eon und RWE, hinter dem auch eine einfache Frage steht: Wie tragfähig sind Schulden auf lange Sicht, wenn das für den Schuldendienst, Rückbau und Endlagerung von Atomabfällen zurückgestellte Kapital womöglich doch nicht so rasch wächst wie erwartet und Zahlungsverpflichtungen durch eine milde Deflation womöglich eher mehr als weniger Wert werden? Dabei handelt es sich um ein Problem, das sich noch in vielen anderen Bereichen der Wirtschaft wie Pensionslasten, Versicherungsansprüchen und mehr in den kommenden Jahren für Aufsehen sorgen wird.
Nun ist es natürlich leicht, nach sechs sehr starken Jahren am Kapitalmarkt als Mahner dazustehen. Wir bei Capital sehen auch keinerlei Grund, an unserer grundsätzlich konstruktiven Haltung gegenüber langfristig rentablen Formen des Vermögensaufbaus über Aktien oder Wohnimmobilien zu zweifeln, sofern Anleger die damit verbundenen Risiken und Ausschläge tragen können. Und mehr noch: Nimmt man wie ein guter an Substanz interessierter Investor die aktuellen Bewertungen und nicht etwa das Grundrauschen der Märkte als Indikator für künftige Renditen, dürften Anleger über die kommenden fünf bis zehn Jahre mit Schwellenländern vermutlich attraktivere Renditen einfahren als mit Aktien und Anleihen aus Industrieländern. Zu diesem Komplex haben wir auch unsere aktuelle Titelgeschichte in CapitalL recherchiert und ausführliche Interviews mit dem Verhaltensökonom Prof. Thorsten Hens und dem Deutsche Asset & Wealth Management-Chefstrategen Asoka Wöhrmann über optimale Anlagestrategien geführt, die ich Ihnen sehr empfehle.
Dass es im Finanzsystem und der Weltwirtschaft wieder hörbar knirscht, können nach dem Notenbankbeschluss der US-Fed am Donnerstag aber selbst Optimisten kaum in Zweifel ziehen.