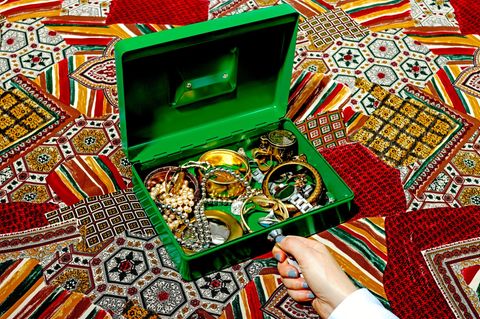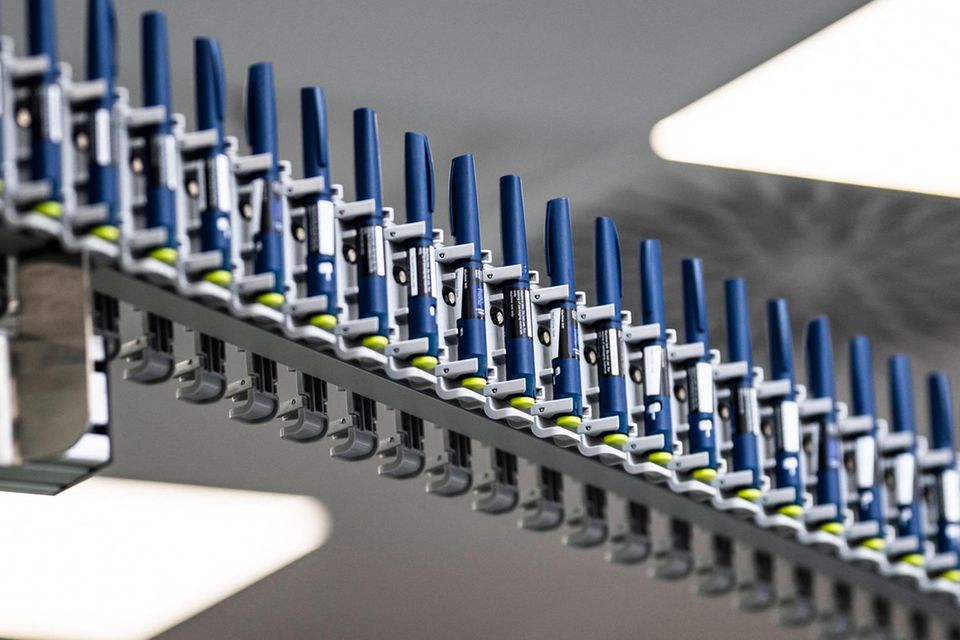Länder mit einer offenen Wirtschaft und einem robusten Privatsektor tendieren zu einer Dollarisierung, um so den Handel und die wirtschaftliche Stabilität zu verbessern. Zuletzt war der Vorschlag des argentinischen Präsidenten Javier Millei zur Dollarisierung Argentiniens in der Öffentlichkeit diskutiert worden. Bei der Einführung einer Fremdwährung, zumeist dem US-Dollar, stellt die Geldwertstabilität den wichtigsten Katalysator dar. Länder mit wirtschaftlichen Schwierigkeiten wie Währungsabwertungen und Hyperinflation betrachten die Dollarisierung als einen Weg zur Wiederherstellung des wirtschaftlichen Gleichgewichts. Doch es gibt auch Schwierigkeiten, wie das Beispiel von Simbabwe zeigt.
Argentinien: Dollarisierung im Blick
Präsident Milei wurde aufgrund seiner radikalen Wirtschaftspolitik gewählt, die unter anderem die sofortige Einführung des US-Dollars als alleinige gesetzliche Währung und die faktische Abschaffung der argentinischen Zentralbank vorsah. Seit seinem Amtsantritt hat die tiefgreifende Wirtschaftskrise eine umgehende Dollarisierung verhindert, dennoch verfolgt er mittelfristig das Ziel, die Wirtschaft des Landes durch die Abschaffung des Peso nachhaltig zu stabilisieren.
In der argentinischen Währungsgeschichte gab es zwei Phasen, in denen der Wert des Peso an einen ausländischen Vermögenswert gebunden war: Von 1899 bis 1914, als ein Währungsgremium den Peso an den Goldstandard band, und von 1991 bis 2001, als der Peso an den US-Dollar gebunden war. Obwohl der Zusammenbruch des Goldstandards einen äußeren Anlass für das Wiederaufleben der argentinischen Währung darstellte, blieb die orthodoxe Wirtschaftspolitik weitgehend bestehen, was zu niedrigen Inflationsraten und einem starken Peso führte. Die Wirtschaft verschlechterte sich aufgrund der Weltwirtschaftskrise und der Einführung einer Zentralbank 1935, doch der wichtigste Faktor war die erneute Machtübernahme der populistischen Kräfte unter Juan Peron 1943.
Das Auslaufen der Konvertierbarkeit 2001 fiel zeitlich mit der Umkehr der Kapitalströme in die Schwellenländer infolge der Währungskrisen in diesen Ländern zusammen, während auf nationaler Ebene die finanziellen Schieflagen der Provinzen, die sich verschlechternde Haushaltslage des Staates und die Währungsinkongruenzen im Bankensektor den Untergang des Currency-Board-Systems auslösten. Dies führte zu einer Abwertung des Peso sowie zum Einfrieren und zwangsweisen Umwandlung von Dollareinlagen, was langfristig betrachtet verheerende Folgen hatte.
2023 herrscht in Argentinien Hyperinflation, die Währung befindet sich im freien Fall, die Zentralbank verfügt über keinerlei Glaubwürdigkeit und die Wirtschaft weist ein hohes Maß an Liquidität in Dollar auf. Das Ergebnis der Präsidentschaftswahlen bestätigt, dass ein dritter Versuch der Dollarisierung dringend in Betracht gezogen werden sollte. Aufgrund der bisherigen Misserfolge kann jedoch nur eine dauerhafte vollständige Dollarisierung ein langfristiges Bekenntnis des Landes zu einer orthodoxen Geldpolitik garantieren. Sollte es gelingen, die Wirtschaftskrise einzudämmen und eine Hyperinflation zu vermeiden, so stellt sich die Frage, ob der entsprechende politische Wille für diesen Schritt vorhanden ist. Angesichts der jahrelangen Wirtschaftskrise, unter der Argentinien leidet, und der relativen Erfolge, die andere Länder mit einer offiziellen Dollarisierung erzielt haben, dürfte diese Frage wohl bejaht werden.
Simbabwe: System der verschiedenen Währungen
Simbabwe sah sich 2009 in Folge mehrerer kritischer Ereignisse und politischer Maßnahmen mit einer Hyperinflation und dem Verfall des Simbabwe-Dollar konfrontiert. Um die Wirtschaft zu stabilisieren, führte die Regierung 2009 ein System mit mehreren Währungen ein. In der Absicht, die Währungsstabilität wiederherzustellen und das Wirtschaftswachstum zu fördern, erlaubte das Regime zunächst die Verwendung ausländischer Währungen wie des südafrikanischen Rand, des Euro, des britischen Pfunds, des US-Dollars, des mosambikanischen Metical und des sambischen Kwacha, was eine faktische Verdrängung des Simbabwe-Dollar zur Folge hatte.
Der Wechsel zu einem System mit mehreren Währungen stabilisierte zwar zunächst die Wirtschaft, führte jedoch zu unvorhergesehenen Komplikationen. Infolge sinkender Devisenreserven wurde die Wirtschaft zunehmend von Überweisungen und Exporten in US-Dollar abhängig. Diese Abhängigkeit sorgte für eine gewisse Volatilität, da die Devisenströme unvorhersehbar waren und oft nicht ausreichten. Dies machte eine wichtige Voraussetzung für eine erfolgreiche Dollarisierung sichtbar: die Notwendigkeit eines stabilen und substanziellen Zugangs zu Devisen.
Das Fehlen einer solchen Grundlage führt, wie das Beispiel Simbabwes zeigt, zu einer Lähmung der Wirtschaft. Darüber hinaus verschärfte eine negative Handelsbilanz die Lage, da sie die Versorgungskette belastete, die Kosten für Exportgüter in die Höhe trieb und somit die globale wirtschaftliche Wettbewerbsfähigkeit Simbabwes beeinträchtigte. Dieses Szenario ist kein Einzelfall. Auch andere Länder hatten im Zuge der Dollarisierung mit ähnlichen Problemen wie wachsenden Handelsdefiziten, wirtschaftlicher Stagnation und hoher Inflation zu kämpfen, da sie wesentliche Voraussetzungen wie ausreichende Devisenreserven und eine umfassende Finanzplanung nicht erfüllten.
Auswirkungen schwer vergleichbar
Da die Gründe für eine Dollarisierung nicht exogen sind, lassen sich die langfristigen Auswirkungen eines solchen Schrittes nur schwer bestimmen. Die heterogene Faktenlage in Bezug auf die Auswirkungen bedeutet, dass eine Übertragung der in den dollarisierten Volkswirtschaften beobachteten Phänomene auf andere Länder aufgrund der besonderen Merkmale der jeweiligen Länder und der mangelnden externen Validität früherer Untersuchungen nicht uneingeschränkt möglich ist. Daher muss ein Land vor dem Schritt zur Dollarisierung die eigenen spezifischen Umstände bewerten und sicherstellen, dass es bestimmte Voraussetzungen erfüllt, bevor es einen solchen Schritt wagt.