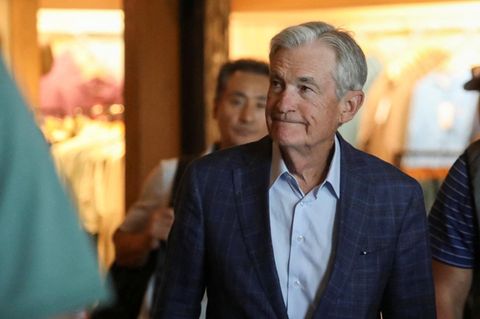Nichts beschäftigt Ökonomen stärker als die Inflation und ihre Beschleuniger. In den vergangenen beiden Jahren wurden eine ganze Reihe dieser Beschleuniger ermittelt – vom Angebotsschock durch den Ukrainekrieg, über eine vermeintliche „Gierflation“ der Unternehmen, bis hin zur Niedrigzinspolitik. Sie alle, so die jeweiligen Denkschulen, hätten einen Sickerungseffekte durch die gesamte Wirtschaft – gewissermaßen wie die berühmte Flut, die alle Boote hebt.
Inzwischen, da die Inflation global eigentlich auf dem Rückzug schien, warnen einige Ökonomen aber bereits vor dem nächsten Beschleuniger. Dieses Mal aus den USA. Und dieses Mal könnte er sehr unterschiedliche Effekte auf die weltweite Bekämpfung der Inflation haben, denn vom US-Dollar als vermeintlichen Beschleuniger, wären andere Länder außerhalb der USA zunächst stärker betroffen. Durch den steigenden Dollar erhöhen sich die Importkosten anderer Länder, was wiederum die Preise im entsprechenden Land erhöht. So die Theorie.
Grund für die Sorgen, die unter anderem das Editorial Board der „Financial Times“ äußerte, ist der Anstieg des Dollars auf ein Sechs-Monats-Hoch in der vergangenen Woche.
Für einen Dollar erhielten Investoren zwischenzeitlich wieder über 0,9419 Euro. Noch kurz vor dem Jahreswechsel hatte dieser Wert gerade einmal bei 0,9042 Euro gelegen. Diese Entwicklung setzte ein, obwohl die US-Wirtschaft brummte und die Inflation gleichzeitig in Richtung des Zielwerts von zwei Prozent tendierte. Damit eine Währung steigt, muss vor allem die Renditeerwartung der Investoren steigen. Das tut sie (unter anderem), wenn die Zinsen in den USA längerfristig hoch bleiben, und diese eben auch höher liegen als in anderen Erdteilen. Eine brummende Wirtschaft bei tendenziell sinkender Inflation spricht aber nicht für steigende Zinsen, sondern eher für das Gegenteil.
Die Entwicklung setzte vor allem ein, weil andere Währungsregionen, die zuvor noch stärker unter der Inflation litten, mit der eigenen Preisbekämpfung vorankamen. Die Märkte preisten in der Folge Zinssenkungen für diese Regionen ein, die sie zuvor schon in den USA eingepreist hatten. Es folgte in gewisser Weise eine Angleichung an einen Zustand, der über einen längeren Zeitraum als normal galt. Denn ein Wechselkurs von 0,9419 ist im Zwei-Jahres-Vergleich alles andere als hoch, wenngleich historisch sehr wohl. Zeitweise war der Euro sogar unter die Parität zum Dollar gefallen. Dabei wird die obige Rechnung umgekehrt und gefragt, wie viel US-Dollar man für einen Euro bekommt. Im Oktober 2022 bekamen Investoren dabei gerade einmal 0,97 Euro für einen Dollar. Heute sind es 1,0711 Dollar.
Dass ein anziehender Dollar Nachteile für die Inflationsbekämpfung hat, ist nicht neu. Die Wirkungskette ist kurz und simpel: Weil der Dollarkurs steigt, müssen andere Länder mehr für Importe zahlen. Das gilt natürlich für Waren aus den USA – aber eben nicht nur hierfür. Der Dollar ist mehr oder weniger die globale Leitwährung. Eine Vielzahl der transatlantischen Handelsgeschäfte wird in Dollar gezahlt. Beispielsweise viele Öllieferungen aus dem Mittleren Osten. Wertet also der Dollar auf, werden auch Öllieferungen nach Europa teurer.
Gefährliche Spirale?
Über die letzten zehn Jahre lag der Euro/Dollar-Wechselkurs bei 1,1284 Euro – also noch deutlich über dem aktuellen Stand. Was manchen Beobachtern, wie der „Financial Times“, jetzt trotzdem Sorgen bereitet, ist die Spirale, die in Gang kommen könnte. Denn das jüngste Hoch ergab sich vor allem aus schlechten US-Inflationsdaten, die im Kontrast zu den weltweiten Erfolgsmeldungen stehen. Investoren erwarten also, dass die Zinsen in den USA aufgrund der Inflation längerfristig hoch bleiben.
Zeitgleich profitieren sie von der weiter boomenden US-Wirtschaft. Da die Märkte nun darauf wetten, dass die US-Zinsen hoch bleiben, während die Zinsen anderswo fallen, werden Anleger verstärkt zum Dollar greifen, um von den besseren Renditen und dem überragenden amerikanischen Wachstum zu profitieren. Dadurch droht ein weiterer Aufwärtsdruck auf den Wert des Dollars, was Risiken für die Weltwirtschaft mit sich bringt.
Neben den genannten höheren Import- und Handelskosten für das Ausland, gilt das vor allem für die Verschuldung von Entwicklungsstaaten, die meistens in US-Dollar notiert sind. Die geschäftsführende Direktorin des IWF, Kristalina Georgieva, hat bereits davor gewarnt, dass hohe US-Zinsen zu einer Reihe von Zahlungsausfällen führen könnten – mit der Möglichkeit eines regionalen oder globalen Übergreifens auf andere Länder.
Auch in den USA ist ein starker Dollar nicht unbedingt gewünscht. Denn, was in vielen Ländern als Vorteil einer starken Währung angesehen wird – billigere Importe aus dem Ausland – widerspricht den amerikanischen Bemühungen, möglichst viel im eigenen Land zu produzieren. Es ist daher auch kein Zufall, dass sowohl Joe Bidens Finanzministerin Janet Yellen Bedenken anmeldete wie auch Bidens Konkurrent und Ex-Präsident Donald Trump. Der drückte es, kaum überraschend, etwas drastischer aus, und sprach von einem „Desaster“.