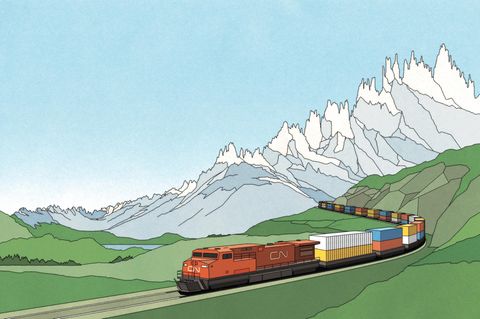Nach der üblichen Sommerflaute sieht es derzeit an den Börsen nicht aus, soweit die halbgute Nachricht für Anleger. Eine Flaute herrscht nämlich, wenn kein Wind weht und sich die Wellen nur leicht dahin kräuseln.
Momentan allerdings frischt der Luftzug an den Finanzmärkten deutlich auf, vor allem aber hat er sich gedreht: Aus der Böe, die in den vergangenen acht Wochen den Kursen Rückenwind verlieh und sie um immerhin rund acht Prozent noch oben drückte, ist inzwischen eine recht steife Brise geworden, die nun von vorn weht:
Erst machten sinkende Geschäftsklimazahlen die Runde, dann verschlechterten sich die Auftragsdaten der Industrie, schließlich meldeten mehrere Leitbranchen wie die Chemie, Maschinenbau und die Autoindustrie schwächelnde Absatzzahlen. Und dann schockte die Gewinnwarnung von BASF den Markt, vom Niedergang der Deutschen Bank einmal ganz zu schweigen
Und damit nicht genug: Auch FuchsPetrolub, Siemens und Deutz lieferten allenfalls trübe Ausblicke. Mit schlechten Zahlen bei ThyssenKrupp wird ebenfalls gerechnet. Die neue Großwetterlage ist klar: Den Anlegern bläst nun der Wind ins Gesicht.
Stimmung der Anleger so schlecht wie seit 2014 nicht mehr
Allein auf Wochensicht warf es den deutschen Leitindex Dax um zwei Prozent zurück. Er notiert jetzt bei rund 12.350 Punkten. Damit ist der letzte Vorwärtsdrall, der Ende Mai, Anfang Juni einsetzte erst einmal wieder jäh beendet.
Zwar hat er seit seinem Tief vom Jahresende rund 1500 Punkte wieder gut gemacht, doch seit einem Jahr und auch auf Zweijahressicht tritt der Dax damit nun mehr oder weniger auf der Stelle. Und wenn es so etwas wie die Wettervorhersage für Börsen gibt, dann sieht die leider nicht gut aus.
Diese Funktion erfüllt nämlich das Anleger-Barometer Sentix, das die Stimmung der Marktbeteiligten misst und regelmäßig fragt: Sind sie positiv oder negativ gestimmt und rechnen sie mit steigenden oder fallenden Kursen?
Seine Aussage ist sehr eindeutig: Es braut sich etwas zusammen, denn die Stimmung deutscher Anleger ist so schlecht wie seit 2014 nicht mehr. Sie ist auf dem Fünfjahrestief angekommen mit minus 4,8 Punkten zurzeit.
Sentix-Wert so schlecht wie zuletzt vor zehn Jahren
Europaweit sieht es sogar noch düsterer aus: Auf minus 5,8 Punkte ist der Sentix in der Eurozone gefallen, bei der vorigen Messung erreichte er noch 3,3 Minuspunkte. Das war ein recht abrupter Rückgang. Zudem sind die minus 5,8 Punkte der schlechteste Wert seit zehn Jahren, seit November 2009 nämlich. Die Laune der Anleger ist also so trüb wie seit dem Abflauen der Finanzkrise nicht mehr.
Ökonomen fassen das zur markigen Prognose zusammen: Die Rezession – die viele ja bereits am Jahresende erwartet hatten und zwar entweder für dieses oder spätestens fürs nächste Jahr – sie ziehe nun endgültig auf. Zumindest scheint der Wirtschaftsabschwung nun so gewiss im Anmarsch zu sein wie das nächste Sommergewitter, es ist nur noch die Frage: Wie stark wird es sich entladen und wo?
Wird es auch bei uns mächtig krachen, also zum größeren Rückgang bei Wachstum und Beschäftigten kommen? Oder ziehen Blitz und Donner vielleicht in einiger Entfernung an der deutschen Wirtschaft vorbei und bescheren ihr nur eine kurze Schlechtwetterphase, die für zwei Quartale die Bilanzen verregnet oder verhagelt? Ein entscheidender Punkt dabei werden die Notenbanken sein. Und das ist leider keine gute Nachricht.
US-Notenbank stellt Leitzinssenkung in Aussicht
Schon am Mittwoch machten die Aussagen von US-Notenbankchef Jerome Powell klar, dass die amerikanische Fed mit einer Abkühlung des Wachstums in Amerika und dem Rest der Welt rechnet. Denn Powell stellte eine baldige Leitzinssenkung in Aussicht. Die erste seit immerhin zehn Jahren: Seit dem rasanten Absenken des Zinsen in der Finanzkrise 2008/2009 von über 5 Prozent auf fast Null Prozent herrschte in Amerika bis 2016 die große Zinsflaute.
Seitdem hob die Notenbank den Referenzzins in mehreren Schritten auf immerhin wieder 2,25 bis 2,5 Prozentpunkte an. Das galt als Ausweis der Stärke für die US-Wirtschaft. Auch wenn Präsident Trump den Notenbankchef mehrmals aufforderte, die Zinsen wieder zu senken und ihm sogar mit Abberufung drohte, sollte er dies nicht tun und damit den Aufschwung der Wirtschaft bremsen – Powell blieb hart. Er richtete sich allein nach Wirtschaftsdaten und Fakten. Nicht nach den zweifelhaften Anweisungen von oben.
Man darf es daher als ernstzunehmendes Signal sehen, wenn er jetzt die Zinsen wieder senken will. Denn ein Einknicken vor Trump ist das sicherlich nicht. Es bedeutet, dass er auch er dunkle Wolken heraufziehen sieht. Powell selbst sprach von „Gegenströmungen“, die der globalen Wirtschaft zuschaffen machten. Er verwies auf Unsicherheiten, Handelsströmungen, den Brexit. Die Wirtschaft laufe bereits schwächer, deshalb sei eine Zinssenkung angebracht.
Bisher keine Aussicht auf Zinswende in Europa
Einerseits wird die neue Phase billigen Geldes bewirken, dass auch wieder (noch) mehr Geld in den Aktienmarkt fließen wird. Denn liquides Kapital wird weiter im Überfluss vorhanden sein und sich nach rentierlichen Anlageformen umsehen. Und das Absinken der Zinsen bei US-Staatsanleihen wird Aktien wieder umso attraktiver machen.
Das Problem ist nur: Wenn der Einbruch der Wirtschaft wirklich kommt, dann werden die Aktienkurse fallen. Und zwar bald. Denn die Gewinne der Unternehmen tun es ja dann später auch und die Kurse laufen ihnen stets etwas voraus.
Immerhin aber, so muss man mit Blick auf die Lage in Amerika sagen, hat die Fed die Möglichkeit der Zinssenkungen überhaupt. Gerade weil sie bereits in der jüngsten Aufschwungphase wieder die Zinsen auf über 2 Prozent angehoben hat.
Das sieht in Europa nämlich ganz anders aus. Hierzulande notieren die Zinsen noch immer auf der Nulllinie. Selbst Großbritannien hat sich inzwischen einen Spielraum von 0,75 Prozent verschafft. Die europäische Zentralbank EZB dagegen hat die Chance bisher verstreichen lassen, auch wenn seit Jahren immer wieder spekuliert – und gehofft – wurde, dass die Zinswende kommt.
An der Stelle kommt jetzt die Personalie der Woche ins Spiel, also die neue Zentralbankchefin Christine Lagarde. Inzwischen haben sich die EU-Finanzminister darauf geeinigt, dass sie Noch-Chef Mario Draghi im Herbst nachfolgen soll. Die endgültige Bestätigung im Oktober gilt nur noch als Formsache.
Verfechterin der Nullzinsen bald EZB-Chefin
Damit aber steht auch etwas anderes bald vermutlich bloß noch auf dem Papier: das Wort Zinsen wird es zwar in Zukunft noch geben, zumindest als theoretisches Konstrukt. Doch in der Praxis werden die europäischen Sparer in den kommenden Jahren wohl keine positiven Leitzinsen mehr oberhalb der Nulllinie erleben. Und damit auch so gut wie keine Sparzinsen fürs Tages- und Festgeld, für Bundesanleihen oder andere Festverzinser. Die Nulldiät bei Spareinlagen und Anleihen geht also weiter, so darf man schwer annehmen, wenn man sich die bisherigen Äußerungen von Christine Lagarde vergegenwärtigt.
Die bisherige Chefin des Weltwährungsfonds IWF ist sicherlich eine glänzende Besetzung für die Spitze der EZB. Schließlich versteht sie es, die unterschiedlichsten Interessen gegeneinander abzuwägen und auszutarieren. Lagarde gilt als durchsetzungsstark und gleichzeitig als große Diplomatin. Auch in Finanzdingen. Aber auch in Zinsfragen ist ihre Meinung klar: Ihrem Amtsvorgänger Draghi sprach sie viel Lob für dessen Krisenpolitik aus.
Die designierte EZB-Chefin gilt als ausdrückliche Verfechterin der Nullzinsen. Mehr noch: Selbst Zinsen unterhalb der Nulllinie befürwortet sie. Negativzinsen seien „insgesamt positiv“ für die Weltwirtschaft. Sie hätten die Welt in der letzten Finanzkrise gerettet, hat sie einmal gesagt.
Schlechte Nachrichten für Sparer
Für Banken und Sparer bedeutet das: In Zukunft zahlt vermutlich derjenige Geld, der sein Kapital beim anderen parkt, in Form von Bankeinlagen, Spargeldern oder als Käufer von Staatsanleihen – wer dagegen Schulden macht, der wird belohnt.
Dass Minuszinsen künftig nicht nur Banken treffen könnten – wie bisher schon – sondern auch Privatsparer, gilt zumindest als wahrscheinlicher, wenn man sich die Diskussionspapiere des IWF ansieht, die jüngst lanciert wurden. Man darf bei solchen Papieren nämlich davon ausgehen, dass sie nicht nur eine rein wissenschaftliche Diskussion anstoßen sollen, sondern gleichfalls als eine Art Testballon fungieren sollen, um auszuloten wie die Öffentlichkeit auf verschiedene Ansätze regiert.
Neben den Minuszinsen war auch die Abschaffung des Bargelds darin immer wieder ein Thema. Denn geben Notenbanken künftig nur noch digitales Geld aus, dann lassen sich Minuszinsen viel leichter auch bei den Privatsparern umsetzen. Für die Bargeldabschaffung hat sich Lagarde bereits ebenso ausgesprochen.
Neuerdings scheint außerdem der Kampf der Währungshüter gegen den Goldbesitz in den Fokus geraten zu sein. Auch damit beschäftigen sich ihre Papiere, denn die Fluchtwährung würde ebenfalls die Einführung von Minuszinsen behindern.
Einzige Fluchtwährung, die profitiert sind Aktien
Was aus alledem folgt? Man darf ziemlich gespannt sein, mit welchem Kurs Notenbankchefin Lagarde eine künftige Rezession bekämpfen wird. Sie könnte die Minuszinsen für alle einführen und die EZB könnte noch mehr Staatsanleihen von Mitgliedsländern aufkaufen – das wäre die eine Option. Sie könnte auch versuchen, die europäischen Staaten zu massiven Ausgabeprogrammen zu überreden, wogegen sich zumindest die Bundesrepublik mit ihrer Suche nach der schwarzen Haushaltsnull arg wehren wird – das wäre eine zweite Option.
Vielleicht lässt sich die EZB auch etwas völlig Neues einfallen, das bleibt abzuwarten. Die einzige Fluchtwährung, die von den Kontermaßnahmen profitieren würde, scheinen aus heutiger Sicht die Aktien zu sein. Auch wenn viele Ökonomen warnen, dass die viele Liquidität nur die Überbewertung an den Aktienmärkten noch weiter in die Höhe treibe.
Klar scheint: Auf steigende Zinsen zu hoffen, wäre bei diesen Aussichten ungefähr so, als segle man mit voll gesetzten Segeln einem Gewitter entgegen und halte sich dabei ausgerechnet am Metallmast fest.