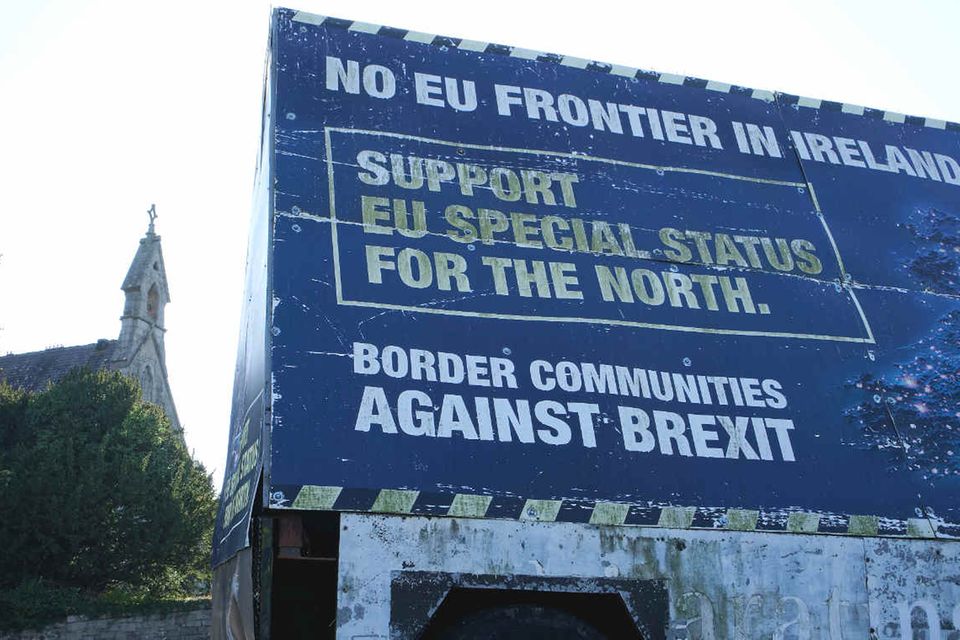Jedes Jahr im Februar verwandelt Wolfgang Ischinger München in eine Hochsicherheitszone. Aus aller Welt kommen dann Staatschefs, Minister, Militärs und Diplomaten für ein Wochenende in die Stadt, um auf der Sicherheitskonferenz die Lage der Welt zu beraten. Seit 2008 leitet Ischinger das Treffen. Zuvor arbeitete der Diplomat als Botschafter in London, Washington und als Staatssekretär im Auswärtigen Amt.
Herr Botschafter, alle Welt verkündet heute über Twitter, was er oder sie so meint, auch Staatschefs. Braucht man da noch die klassische Diplomatie?
Dringender denn je sogar, würde ich sagen! Die große Kunst bei Twitter ist ja, das, was man eigentlich sagen möchte, besser für sich zu behalten. Man muss den Drang zu twittern unterdrücken. Das ist eine gewaltige Herausforderung und gelingt ja nicht immer, wie Donald Trump beweist. Durch Twitter hat sich die Umlaufgeschwindigkeit der Weltpolitik dramatisch gesteigert.
Man hat den Eindruck, dass die Twitterei Konflikte eher anheizt.
Das Potenzial für Missverständnisse ist tatsächlich gewaltig.
Passend zur aufgeheizten Stimmung haben Sie ein Buch geschrieben, es trägt den dramatischen Titel: „Welt in Gefahr“. Ist die Lage wirklich so brenzlig?
In den letzten zehn Jahren hat die Zahl schwer oder kaum beherrschbarer internationaler Krisen und Konflikte dramatisch zugenommen, und sie überlagern sich: Zum einen die militärischen Konflikte wie in Syrien, in Libyen, in Mali oder in der Ukraine, und wir erleben ökonomische Krisen wie in der Eurozone oder derzeit in der Türkei. Das meine ich mit: Die Welt ist in Gefahr.
Woher rührt diese Verdichtung?
Es gibt zwei Ursachen für diesen giftigen Brei. Zum einen haben die beiden entscheidenden großen Mächte, nämlich die USA und Russland, seit gut fünf Jahren jegliches gegenseitige Vertrauen verloren. Dass Russland und die USA in Syrien nicht zusammengearbeitet haben, liegt daran, dass die Amerikaner mit den Russen keinerlei Informationen teilen wollten. Man fürchtet sich regelrecht vor der Zusammenarbeit. Wir erleben ein permanentes fundamentales gegenseitiges Misstrauen.
Und die zweite Ursache?
Die andere Ursache ist der Trend zur Ein-Mann-Diktatur: Wir haben einen russischen Präsidenten Putin, der sich vor keinem Politbüro mehr rechtfertigen muss. Wir haben einen US-Präsidenten, der sich bewusst über seine Partei und die wichtigsten Institutionen des Landes erhebt. Wir haben in der Türkei einen Präsidenten Erdogan, in China Xi Jinping, in Ungarn Viktor Orban und in Polen Jaroslaw Kaczynski. Von der Idee, dass Regeln und Institutionen Frieden, Stabilität und Zusammenarbeit ermöglichen, ist in der Welt nicht mehr viel übrig geblieben. Wir erleben gleichsam einen Kollaps der Global Governance. All dies erzeugt eine Lage, die ich für gefährlicher halte als alles zuvor seit dem Kalten Krieg.
Halten Sie auch eine große Konfrontation zwischen den Atommächten Russland und USA wieder für möglich?
Nein, von einem großen Krieg will ich gar nicht reden. Aber es häufen sich kleine Vorkommnisse, Zusammenstöße zwischen russischen und amerikanischen oder anderen westlichen Flugzeugen und Schiffen. Die Gefahr, dass einer mal auf den falschen Knopf drückt und aus kleinen Missverständnissen große werden, ist deutlich gewachsen.
Gab es nicht in früheren Jahrzehnten genauso viele Konflikte und Krisen? In den 90er-Jahren etwa, die viele nach dem Mauerfall als friedlich erinnern, tobte im zerfallenden Jugoslawien noch ein Bürgerkrieg auf europäischem Boden. Es gab den Völkermord in Ruanda, die Asien- und Russlandkrise 1997 und 1998. Verklären wir nicht die Vergangenheit?
Ohne jeden Zweifel gab es auch damals eine Vielzahl an Konflikten und Krisen, aber mit einem gravierenden Unterschied. Wenn Sie die Kommunikation zwischen Boris Jelzin und Bill Clinton aus den 90er-Jahren lesen, stellen Sie fest, dass es da ebenfalls hoch herging. Auch da wäre es beinah zur Konfrontation zwischen Amerikanern und Russen gekommen. Aber der Unterschied ist, dass damals das Grundvertrauen nie kaputt war. Die Drähte waren intakt. Jedes Jahr wurden russische Offiziere nach Harvard eingeladen. Davon ist heute nichts übrig geblieben. Minister, Botschafter, Beamte, die Abgeordneten – auf allen Ebenen herrscht heute völlige Funkstille.
Wie konnte es so weit kommen?
Das ist wie mit einer Infektionskrankheit, die sich langsam entwickelt. Es begann mit Putins Brandrede im Jahr 2007 auf der Münchner Sicherheitskonferenz. Darin unterstellte er den USA ein Streben nach „monopolarer Weltherrschaft“, die NATO warnte er vor „ungezügelter Militäranwendung“ bis an Russlands Grenzen. Als keiner im Westen reagierte, zettelte er den kleinen Georgienkrieg an. Viele erwarteten, mit dem US-Präsidenten Obama renke sich das wieder ein. Aber das Vertrauen hatte einen Knacks. Und 2014 mit der Krim war es dann zappenduster, das war der Scheitelpunkt. Heute herrscht zwischen den Administrationen beider Länder praktisch Kontaktsperre. Schlimmer noch, an der russischen Militärakademie wird den Offizieren beigebracht, dass es im Falle einer direkten Konfrontation mit dem Westen eine gute Idee sei, schon am ersten Tag die Nuklearwaffe einzusetzen, um dem Gegner den Schneid abzukaufen.
Das heißt, wir brauchen wieder Kommunikation auf den mittleren und unteren Ebenen.
Ja, wir bräuchten zum Beispiel dringend Gespräche über die Rüstungskontrolle. Die nuklearstrategischen Vereinbarungen zwischen Russland und den USA laufen im Jahr 2021 aus. Das heißt eigentlich übermorgen. Aber da tut sich gar nichts. Seit Ende der 80er-Jahre haben wir den Vertrag zur Eliminierung nuklearer Kurz- und Mittelstreckenraketen in Europa. Dieser Vertrag wird im Augenblick von russischer und amerikanischer Seite infrage gestellt.
In den Konflikten, die Sie angesprochen haben, schwingt immer wieder eine Frage mit: Wie soll sich Deutschland verhalten? Im Hintergrund an Kompromissen arbeiten – oder selbstbewusst eigene Interessen formulieren?
Da wir ohnehin der Dickste, Größte und Wohlhabendste in der EU sind, rate ich dazu, nicht als deutsche Führungsmacht aufzutreten. Wir sollten unsere ökonomische und militärische Macht in den Dienst einer handlungsfähigeren EU stellen. Damit die EU das nächste Mal, wenn wieder etwas wie der Syrienkrieg ausbricht, sagen kann: Das ist unsere Krise, wir können handeln.
Was bedeutet das konkret?
In der Handelspolitik konnte Jean-Claude Juncker nach Washington fahren und Donald Trump sagen: „Ich besitze das Verhandlungsmandat für 500 Millionen Europäer.“ Dieses Gewicht brauchen wir auch in der Außenpolitik – und das erreichen wir nur durch Mehrheitsentscheidungen. Heute funktioniert Außenpolitik in der EU so: Der amerikanische Kongress beschließt zum Beispiel Sanktionen gegen die Nord-Stream-2-Pipeline. Dann fährt der deutsche Außenminister nach Washington, um zu protestieren – doch andere EU-Staaten pflichten Washington bei. Mit diesem Vorgehen kann doch die Außenpolitik der EU nicht ernst genommen werden.
Ist das nicht ein Symptom für die Isolation Deutschlands in Europa?
Genau deshalb müssen wir mehr in Europa investieren. Wir Deutschen haben uns in Europa keinen guten Ruf erworben: In militärischen Dingen gelten wir als Trittbrettfahrer, das dirty business überlassen wir anderen. In finanziellen und ökonomischen Dingen dagegen legen wir den anderen Daumenschrauben an. Bei politischen Problemen – nehmen Sie die Flüchtlingsfrage – heißt es, die Deutschen zwängen den anderen ihre Meinung auf. Deswegen wäre es aus meiner Sicht ein Befreiungsschlag, wenn Deutschland sagen würde: Wir akzeptieren Mehrheitsbeschlüsse.
Auch die Politik einer Achse Salvini-Orban-Kaczynski?
Das müssen wir verhindern, durch kluge Politik. Ich stelle mit großer Freude fest, dass sich in der Bundesregierung etwas bewegt – bis hin zur Bundeskanzlerin, die sich aufgeschlossener zeigt.
Angela Merkel ist ein gutes Stichwort. Die neue Große Koalition ist angetreten, Europa nach Jahren des Stillstands endlich voranzubringen. Doch passiert ist nichts.
Ja, diese Koalition ist mit einer gewissen Lustlosigkeit zustande gekommen. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron dagegen ist mit großer Energie ins Amt gestartet, im Hintergrund hörte man gefühlt immer Beethovens Neunte.
Und bei uns den Trauermarsch.
(lacht) Ja, aber ich habe die Hoffnung, dass die Bundesregierung imstande ist, diese einmalige Chance mit Macron zu ergreifen, der EU neues Leben einzuhauchen und zu zeigen: Wir wollen diese EU, egal was da kommt.
Egal was es kostet?
Was nützt uns die schwarze Null, die wir quasi zu den zehn Geboten zählen, wenn uns der Zusammenhalt in der EU um die Ohren fliegt? Auch wenn das unpopulär ist: Wir werden in die beiden zentralen außenpolitischen Säulen unseres Landes, die EU und die NATO, deutlich mehr Geld investieren müssen. Das wird teuer, womöglich sehr viel teurer.
Also zwei Prozent des BIP für die Verteidigungsausgaben, so wie es die NATO fordert?
Wir müssen mehr investieren, und zwar europäisch. Mir sagen ganz viele Diplomaten: Ihr Deutschen produziert jedes Jahr diesen irrsinnigen Handelsüberschuss, aber wenn über Syrien Bomben abgeworfen werden müssen, dann lasst ihr das die Dänen machen, und ihr macht nur die Fotos. Das kann nicht richtig sein. Da verstehe ich die Kritik Donald Trumps.
Hat der US-Präsident also recht, wenn er Deutschland angreift?
Diese Investitionen sollten wir nicht für Herrn Trump machen, sondern aus eigenem Interesse. In Artikel 42 des Lissabonner Vertrags für die EU haben wir die gleiche Beistandsverpflichtung wie in der NATO, das wissen viele nur nicht. Aber wie wollen wir das leisten, wenn keines unserer U-Boote fährt und keiner unserer Eurofighter fliegt?
Seit der Wahl von Donald Trump sind unsere Beziehungen zu den USA gestört. Wie nachhaltig ist das Verhältnis beschädigt?
Amerika ist mehr als Donald Trump. Wir haben nach wie vor vielfältige und sehr gute Beziehungen auf allen Ebenen in die USA. Nehmen Sie nur all die deutschen Unternehmen, die dort eine Million Arbeitsplätze geschaffen haben. Doch wir brauchen eine Offensive: Wir sollten eine Allianz der deutschen Wirtschaft in den USA schmieden: Alle, von Siemens, Bosch, BMW bis zu den Mittelständlern, sollten die lokalen Abgeordneten in ihre Fabriken holen. Diese schlummernden Ressourcen müssen wir jetzt nutzen.
Mehr PR für Deutschland?
Ja, das funktioniert in den USA. Ich habe das selbst erlebt, als ich in der schwierigen Phase des zweiten Irakkriegs 2003 Botschafter in Washington war. Da haben wir mithilfe einer sehr guten amerikanischen PR-Agentur die Stimmung zugunsten von Deutschland fördern können. Die französischen Luxuskonzerne haben damals schwer gelitten, die deutschen Autobauer hingegen kaum. Zur Wahrheit gehört allerdings auch: So, wie es mal war, wird es nicht mehr werden.
Der Streit hinterlässt Narben?
Für die Briten und Franzosen waren die USA nie so wichtig, die waren immer selbst schon groß. Aber für uns in Deutschland ist der Einschnitt größer, für uns waren die USA nach dem Weltkrieg das Symbol für die Zugehörigkeit zum Westen. US-Präsidenten wie John F. Kennedy oder Bill Clinton waren oft moralische Symbolfiguren. Heute kann ich meiner 14-jährigen Tochter unmöglich noch erklären, dass dieser US-Präsident die Symbolfigur für unsere Werte ist.
Das Getöse um den Handelskrieg ist zuletzt ja etwas abgeflaut. Glauben Sie, dass Trump noch zur Vernunft kommt und von seiner Großmannssucht ablässt?
Ich glaube nicht, dass sich ein Mann mit Anfang 70 noch ändert. Trump ist zutiefst überzeugt, dass es richtig ist, die Leute erst mal in Angst und Schrecken zu versetzen, egal ob Freund oder Feind. Vielleicht merkt er, dass er seine Wähler auch dann nicht verliert, wenn er seine besten Partner nicht so gnadenlos unverschämt behandelt. Ich habe diese leise Hoffnung, dass er ein kleines bisschen „softer“ wird mit uns Europäern. Aber es kann auch schlimmer werden, bei Trump muss man leider mit allem rechnen.