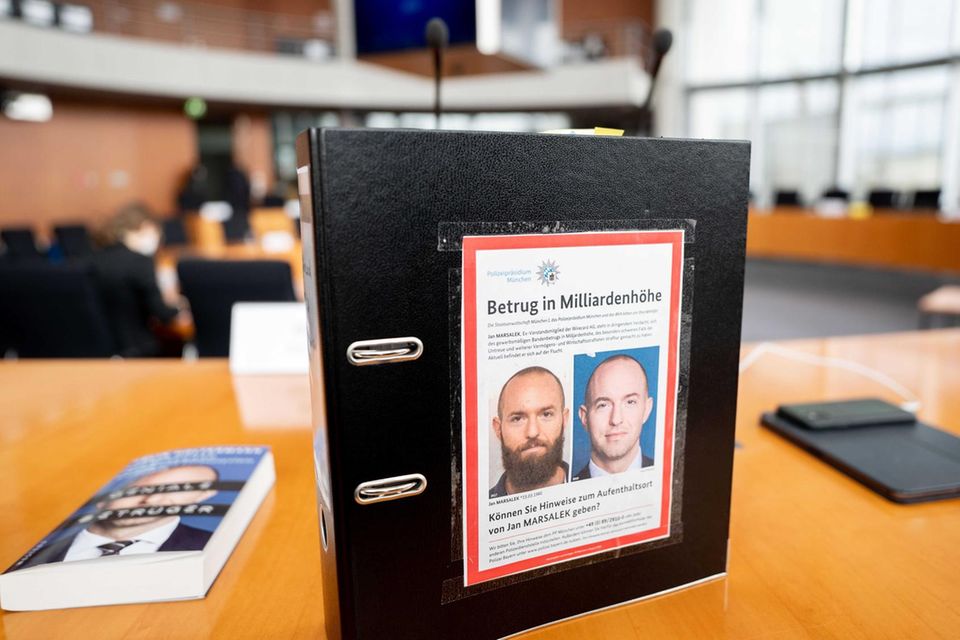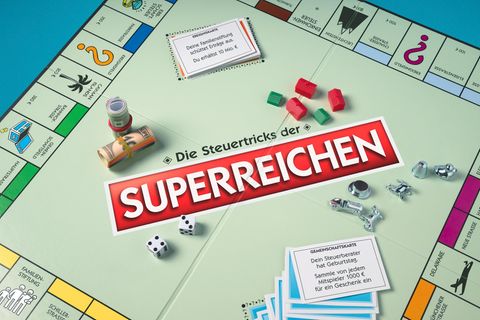Während in manchen Rechtsanwaltskanzleien noch ein Faxgerät steht, fußt bei anderen das gesamte Geschäftsmodell auf IT-Lösungen. Sogenannte Legal Techs setzen auf Software, um ihre Fälle zu bearbeiten. „In den vergangenen Jahren sind immer mehr solcher Unternehmen an den Markt gegangen. Und ich erwarte, dass das Angebot weiter wächst“, schätzt Michael Sittig, der für die Stiftung Warentest Legal Techs beobachtet. Pioniere waren die sogenannten Fluggasthelfer-Portale. Die Anbieter helfen Passagieren dabei, eine Entschädigung für verspätete oder abgesagte Flüge durchzusetzen. Längst gibt es mehrere Nachahmer auch in anderen Bereichen. Ob Knöllchen oder Glücksspiel – Verbraucher können sich bei Legal Techs rechtliche Unterstützung holen.
Eines haben die Portale gemeinsam, beobachtet Sittig: „Voraussetzung ist immer eine klare Rechtslage, die leicht zu prüfen ist. Es ist ein Massengeschäft. Fälle, bei denen eine individuelle Einschätzung nötig ist, werden nicht übernommen.“ Ganz verdrängen werden die Unternehmen die Arbeit klassischer Juristen also nicht. Aber in einigen Bereichen bieten sie Verbrauchern einen niedrigschwelligen Rechtsservice an.
Etwa bei der Entschädigung für Flugverspätung. Dort gibt es klare Regeln: Ab drei Stunden besteht ein Anspruch. Die Höhe der Entschädigung richtet sich nach der Länge der Flugstrecke, bis zu 600 Euro sind möglich. Die Fluggast-Portale prüfen die Angaben der Kunden und auch, ob alle Voraussetzungen erfüllt sind. Etwa dass nicht „außergewöhnliche Umstände“ wie schlechtes Wetter oder ein Streik den Flug verhindert haben – das spräche gegen eine Entschädigung. Sind aber alle Bedingungen erfüllt, übernehmen Unternehmen wie EUClaim, Flightright oder Fairplane den Fall und setzen die Zahlung für die Kunden durch.
Ähnlich sehen die Geschäftsmodelle der anderen Legal Techs aus: Conny zum Beispiel hilft dabei, zu hohe Mieten zu senken. Auch hier ist der Fall einfach zu prüfen: Die ortsübliche Miete laut Mietpreisspiegel plus zehn Prozent. Andere Unternehmen setzen auf aktuelle Rechtsprechung zu Online-Casinos. Noch vor ein paar Jahren war solches Glücksspiel in Deutschland verboten. Deshalb können sich Zocker ihre Verluste von den Anbietern zurückholen, versprechen Plattformen wie Rightnow oder Casinogeldzurueck.de. Und geblitzt.de und Myright helfen dabei, fehlerhafte Knöllchen anzufechten. Myright etwa setzt dafür auf eine hauseigene Datenbank. Darin sammelt das Unternehmen Daten über Blitzgeräte und will so einschätzen können, ob es richtig gearbeitet oder vielleicht unzuverlässige Bilder geliefert hat.
Rechnung kommt am Schluss
Während sich die meisten Anbieter auf einen bestimmten Rechtsstreit konzentrieren, hat Myright das System auf verschiedenste Bereiche ausgerollt. Ob Entschädigungen für Diesel-Fahrer, Mietpreisbremse oder Abfindungen nach Jobverlust – bei aktuell acht verschiedenen Ansprüchen vertritt das Legal Tech Verbraucher.
Der Vorteil für verhinderte Passagiere, enttäuschte Glücksspieler oder abgezockte Mieter: Sie müssen sich nicht selbst durch den Papierkram pflügen und mit Unternehmen herumschlagen, die sich manchmal gegen eine Zahlung wehren. Außerdem brauchen sie nicht in Vorleistung zu gehen. Wer selbst einen Anwalt beauftragt, um sein Recht durchzusetzen, muss diesen nämlich erstmal bezahlen. Erst wenn der Fall gewonnen ist, übernimmt die Gegenseite die Rechtskosten. Deshalb scheuen viele den Gang zu einem Juristen – vor allem bei vergleichsweise kleinen Summen, um die es bei den Fällen oft geht. Die Legal Techs arbeiten anders. Sie sind für Kunden zunächst kostenlos, die Rechnung kommt am Schluss. Denn sie finanzieren sich in der Regel über eine Provision. Fließt eine Entschädigung, behalten sie einen Teil davon ein. Meist sind es zwischen 25 und 50 Prozent der Summe. Mitunter fallen für Verbraucher auch gar keine Kosten an, sofern bei Erfolg die Gegenseite die Verfahrenskosten bezahlen muss. Das hat Folgen: „Die Unternehmen übernehmen in der Regel nur Fälle, die wie ein Elfmeter sind: eigentlich immer erfolgreich. Alles andere wäre zu riskant für die Legal Techs“, erklärt Sittig. Mit einem aussichtslosen oder rechtlich nicht eindeutigen Fall kommen Verbraucher bei den Unternehmen also meist nicht weiter.
Das heißt auch, dass Kunden theoretisch diese Fälle auch selbst durchfechten könnten – und dafür nichts von ihrer Entschädigung abtreten. Schließlich ist die Aussicht auf Erfolg hoch. Kostenlose Unterstützung gibt es im Streitfall auch bei verschiedenen Schlichtungsstellen . „Viele Verbraucher haben aber keine Lust sich selbst zu kümmern. Dann ist man bei einem Legal Tech richtig“, meint Sittig. Er empfiehlt allerdings, sich vorher zu informieren, wie hoch die Kosten sein werden. „Wichtig ist auch, dass man seinen Fall nicht parallel bei mehreren Anbietern einreicht. Das ist rechtlich problematisch, weil Verbraucher ihre Ansprüche oft an das Legal Tech abtreten.“ Die Ansprüche auf Entschädigung gehören dann also dem Unternehmen. Wer das missachtet, dem droht laut Vertrag im schlimmsten Fall sogar eine Strafzahlung.