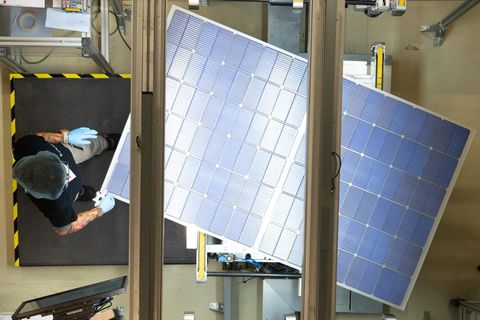Björn Vortisch ist CEO des international tätigen Energiedienstleisters Enexion Group. Er berät energieintensive Unternehmen und Datacenter, unter anderem in Fragen der globalen Energiewettbewerbsfähigkeit.
Unter Experten herrscht Einigkeit, was der Kraftakt Stromwende bringen muss: Echten Umwelt- und Klimaschutz, wettbewerbsfähige Stromkosten und hohe Versorgungssicherheit. Die Realität: Keines dieser Ziele ist bislang angemessen erreicht. Gleichzeitig verfehlt Deutschland seine Emissionsziele im Energiebereich und importiert regelmäßig Kohle- und Atomstrom, um seine Versorgung zu sichern. Wären unsere Nachbarn dem deutschen „Energiewende-Vorbild“ gefolgt, säßen wir schon im Dunkeln. Nachhaltig, vorbildlich und ökologisch ist das natürlich nicht.
Dabei werden die Kosten verschleiert, Fehler aus ideologischen Gründen nicht eingestanden und physikalische Fakten ignoriert. Weil sie vollständig von den heimischen Verbrauchern bezahlt werden, sind die Kosten der Stromwende ein rein lokaler Standortfaktor im globalen Wettbewerb. Hier fehlt es jedoch an Transparenz. So wird beispielsweise häufig nur die Gesamtsumme der Einspeisevergütung (2018 circa 11,6 Mrd. Euro) kommuniziert , anstatt auch die über die EEG-Umlage finanzierten Marktprämien an direkt vermarktete Erneuerbaren-Anlagen zu beziffern. Diese lagen 2018 bei circa 14 Mrd. Euro. Die ehrliche Summe für 2018 beträgt somit 25,7 Mrd. Euro. Seit 2006 wurden konkret nur über die EEG-Umlage circa 224 Mrd. Euro zusätzlich zu Stromsteuern und sonstigen Umlagen von den Verbrauchern aufgebracht.
Weitere Kosten für die Stromwende verstecken sich – politisch gewollt - in den Netzkosten, die deshalb in den vergangenen Jahren drastisch angestiegen sind, für Unternehmen teilweise um mehrere hundert Prozent. Denn neben den Netzausbaukosten werden zum Beispiel auch Zahlungen an notwendige Reservekraftwerke sowie Kosten für den Ausgleich der stark schwankenden Stromerzeugung durch erneuerbare Energien den Netzkosten und nicht der EEG-Umlage zugeschlagen.
Seriöse Studien gehen von weiteren, noch offenen Kosten in Höhe von 500 Mrd. Euro bis 2025 aus. Denn große Investitionen in Speicher, Transport- und Verteilnetze und sichere Kraftwerkskapazitäten müssen erst noch geschaffen werden.
Wenn es wirklich um nachhaltigen und bezahlbaren Umweltschutz geht, dann müssen die effizientesten Maßnahmen auch ideologiefrei diskutiert und die Kosten ehrlich kommuniziert werden. Ein Beispiel: Für weniger als 25 Prozent der bislang für die EEG-Umlage angefallenen Kosten hätten die vorhandenen Braun- und Steinkohlekraftwerke (2019: circa 42 Gigawatt installierte Leistung) durch moderne Gaskraftwerke ersetzt werden können. Der CO2-Einspareffekt: circa 140 Millionen Tonnen CO2 pro Jahr – und somit 20 Millionen Tonnen mehr, als das Umweltbundesamt für die Einspareffekte aus dem bisherigen Erneuerbaren-Ausbau zeitgleich ausweist.
Da alle Stromerzeuger zu 100 Prozent dem Limit des EU-Emissionshandels (EU-ETS) unterliegen und somit die Gesamtemissionen des ETS in der EU immer gleich bleiben, hat diese Einsparung einen konkreten Wert: Circa 2,4 Mrd. Euro hätte der effiziente Kauf der Einsparung gekostet (bei Preisen von 20 Euro pro Tonne in 2018). Auch dieser Wert ist mit den oben genannten 25,7 Mrd. Euro für 2018 zu vergleichen.
Abschreckende Standortpolitik
Die Stromkosten für deutsche Verbraucher und Unternehmen gehören zu den höchsten in Europa – mit ungebremst steigender Tendenz. Zudem sind sie unkalkulierbar, denn die Energiegesetze werden laufend novelliert. Energieintensive Unternehmen brauchen aber verlässliche Rahmenbedingungen bei Gas- und Stromkosten. Permanente EEG-Novellen und Energiesammelgesetze mit praxisfernen Anforderungen zerstören Planungssicherheit. Denn sie führen unter anderem zu einem erheblichen bürokratischen Aufwand. So müssen Unternehmen, um von der EEG-Umlage entlastet zu werden, plötzlich den völlig irrelevanten Stromverbrauch von Kaffeemaschinen und Getränkeautomaten ermitteln. Dabei erfahren sie erst am Jahresende, ob sie von der Umlage befreit werden oder nicht. Diese Unsicherheit ist schlichtweg abschreckend für Standortinvestitionen.
Dieselben Fehler werden derzeit übrigens mit dem Brennstoffemissionshandelsgesetz der Bundesregierung zur Einführung des CO2-Preises wiederholt. So müssen deutsche Unternehmen die zusätzlichen Kosten durch die CO2-Besteuerung bereits ab 2021 tragen. Entlastungsmaßnahmen für energieintensive Unternehmen wird die Bundesregierung jedoch frühestens 2022 definieren. Dass es ab 2026 außerdem keine Fixpreise, sondern Preiskorridore für CO2-Emissionen gibt, die jederzeit von der Regierung angepasst werden können, schafft nun auch beim Gas Planungsunsicherheit.
Viele für eine energie- und umwelteffiziente Zukunft wichtigen Schlüsselindustrien sind physikalisch bedingt sehr energieintensiv. Elektroautos und Windräder, aber auch Wärmepumpen oder Handys benötigen im steigenden Maße Kupfer, Aluminium, Silizium- oder Carbonwerkstoffe. Ganz zu schweigen von den stromintensiven Data- und Cloudcentern, ohne die die zunehmende Digitalisierung gar nicht möglich wäre. Diese Produkte werden – ob es uns gefällt oder nicht – weltweit zu einheitlichen Börsen- und Marktpreisen gehandelt. Auch wenn manche Politiker diese Deindustrialisierung Deutschlands geradezu herbeizusehnen scheinen: Sie ignorieren den Fakt, dass damit nicht nur der Wirtschaftsstandort Deutschland verliert, sondern insbesondere der globale Umweltschutz. Fachleute sprechen hier von Carbon Leakage: Die gleiche Produktionsmenge oder Leistung wird dann an Standorten mit geringeren Umwelt- und Emissionsauflagen hergestellt, der ökologische Fußabdruck deutlich verschlechtert.
Studien bestätigen, dass Deutschland zu den Ländern mit den strengsten Umweltauflagen gehört, Carbon Leakage ist somit fast immer umweltschädlich. Ein paar Beispiele: Es werden zunehmend Kupferprodukte in der EU verbraucht – allerdings verursacht eine Tonne Kupfer in Deutschland produziert nur etwa halb so viele Emissionen wie der weltweite Durchschnitt. Das Bedarfswachstum der EU wurde in den letzten Jahren jedoch im Wesentlichen durch Standortinvestitionen in außereuropäische Standorte gedeckt.
Auch die in Neuss geschlossene Aluminiumschmelze gehörte zu den energieeffizientesten und saubersten weltweit – bis ihr nicht wettbewerbsfähige Stromkosten den Garaus machten. Bei den für die IT-Zukunftstechnologien wichtigen Cloud- und Datacentern ist Deutschland international mit großem Abstand spitze – bei den Stromkosten. Alles schlecht für die Umwelt.
Kein Masterplan in der Energiepolitik
Wind- und Solarstrom sind nicht grundlastfähig – oder ganz praktisch: Egal, wie viele Solarmodule und Windräder durch Umlagen gefördert installiert werden: Nachts beziehungsweise bei Großwetterlagen mit wenig Wind fehlt der genau zu dieser Zeit benötigte Strom (sogenannte Dunkelflauten). Da hilft es auch nicht, wenn zu anderen Zeiten viel zu viel Strom produziert wird und das irrelevante „Jahressaldo“ positiv ist. Das System muss daher immer die gesamte (gegebenenfalls optimierte) Bedarfskapazität über ein zusätzliches Backup-System vorhalten, also grundlastfähige Kraftwerke, zu denen Kohle-, Gas-, Kern-, aber auch Wasser- und Speicherkraftwerke zählen.
Das kennt man aus der Praxis: Wenn Sie Hunger haben und eine Pizza bestellen, hilft es Ihnen nichts, wenn der Pizzadienst erst drei Tage später kommt, dafür aber gleich fünf Pizzen liefert. Auch der Europäische Strommarkt (ein sogenannter Energy-Only-Market) ist genauso geregelt und organisiert: Ein am EU-Markt tätiger Kraftwerksbetreiber muss im Stromnetz vereinfacht gesagt jede Viertelstunde ziemlich exakt und regelmäßig die Kilowattstunden liefern, die vorher verkauft und angemeldet wurden. Nur für die gelieferten Kilowattstunden erhält er einen Arbeitspreis. Liefert er unzuverlässig, muss er die Kosten des Ausregelns (Regel- und Ausgleichsenergiemärkte) bezahlen.
Daraus folgt rein physikalisch: Der Zubau von fluktuierenden Erneuerbaren-Anlagen muss immer halbwegs passend zum parallelen Ausbau der Transport- und Verteilnetze erfolgen. Schließlich müssen auch mal fünf Pizzen transportiert werden, obwohl nur eine benötigt wird. Noch wichtiger ist der Ausbau der verlässlich verfügbaren Backup-Kapazitäten. Denn es ist ökonomisch und ökologisch nicht intelligent oder nachhaltig, mal viel zu viel (teuer geförderten) Strom zu produzieren und diesen dann ins europäische Ausland billig zu verramschen beziehungsweise. bei Erzeugungslücken immer wieder Atom- und Kohlestrom von unseren Nachbarn einzukaufen, während man hier die – im Vergleich – sicheren und effizienteren Kraftwerke abschaltet. Soweit die physikalischen und wirtschaftlichen Fakten.
Dazu die entsprechenden Zahlen: 2018 wurden nur für die Photovoltaik-Stromerzeugung circa 10,5 Mrd. Euro EEG-Subventionen von den Verbrauchern aufgebracht, dafür wurde Strom mit einem mitteleuropäischen Marktwert von lediglich 1,2 Mrd. Euro erzeugt. Im Stromexport wurden nur rund 4,2 Cent pro Kilowattstunde erzielt, jedoch Erneuerbaren-Strom im Mittel mit circa 12,5 Cent pro Kilowattstunde subventioniert. Es macht also keinen Sinn, zu viele nicht nachgefragte Pizzen teuer zu produzieren. Zur Erinnerung: Alle Stromerzeuger sind Teil des europäischen Emissionshandels, der die Gesamtemissionen sowieso marktwirtschaftlich effizient begrenzt.
Leider fehlt der deutschen Energiepolitik der dringend notwendige, integrierte und effiziente Masterplan. Trotz permanenter Ergebnisabweichung – ökologisch wie ökonomisch – gibt es schlichtweg keinen verlässlichen Pfad zur Markt- und Systemintegration. Damit wird ein marktwirtschaftlicher Übergang verhindert, und exportfähige, intelligente Kombilösungen werden gerade nicht angereizt.
Versorgungsengpässe und Tricksereien
Der dringend notwendige Netzausbau hinkt immer weiter hinterher. Zudem schaltet Deutschland im weltweit einzigartigen parallelen Kohle- und Atomausstieg Kraftwerkskapazitäten ab, ohne angemessen neue zu realisieren – und das, obwohl Kraftwerks- und Großspeicheranlagen, aber auch neue Stromnetze in Deutschland langjährige Genehmigungs- und Bauzeiten benötigen. Experten sehen hier bereits ab 2025 eine gefährliche Deckungslücke. Schon jetzt verbietet die Bundesnetzagentur mehreren nicht wirtschaftlichen fossilen Kraftwerken die Abschaltung, da sie einen Blackout befürchtet. Die Entschädigungskosten dieser Verbote zahlen die Verbraucher über ihre Netzumlagen. Willkommen in der Planwirtschaft.
Der Ausbau der Erneuerbaren Energien erfolgt somit unkoordiniert nach dem Prinzip „Masse statt Klasse“ ohne den physikalisch notwendigen parallelen Umbau des Stromnetz- und Backup-Systems. Hier behelfen sich Lobbystudien, die sogar noch mehr Ausbau fordern, einiger unschöner Tricks, die sich wie folgt klassifizieren lassen:
Trick 1: Unrealistische Prämissen
Das Problem wird beispielsweise auf 2030 (oder 2040) geschoben, und für 2030 werden zu diesem Zeitpunkt voll laufende neue Kraftwerkskapazitäten im gigantischen Umfang angenommen, die aktuell weder in der Umsetzungsplanung (sondern häufig noch in der Laborforschungsphase), geschweige denn in der Historie jemals so schnell realisiert worden sind. Wenn man natürlich große neue Kraftwerkskapazitäten in ein Modell hineinsteckt, kommt danach wissenschaftlich richtig ein stabiles System heraus. Dann man kann jetzt der Politik suggerieren, schon mal Wind und PV vorlaufend stärker zu fördern, ohne die anderen physikalischen Herausforderungen angemessen gelöst zu haben.
Ein konkretes Beispiel: Die häufig zitierte Greenpeace-Energy-Studie zum Thema Dunkelflaute nimmt als Prämissen unter anderem 231 Gigawatt (GW) in Deutschland installierte PV-Leistung an. Derzeit, nach 20 Jahren Förderung, sind allerdings nur 48,8 GW installiert. Im vergangenen Jahr lag der Zubau bei 2,6 GW. Für Windkraft an Land geht die Studie von 190 GW aus (derzeit installiert: 53 GW, letztes Jahr Zubau von 2,3 GW). Hinzu kommen circa 40 neue Gaskraftwerke mit 67 GW (derzeit: 29,8 GW) sowie Wasserstoff-Speicherkraftwerke mit fantastischen 43 GW (derzeit praktisch 0 und großtechnisch gesehen Neuland). Wie diese gewaltigen Kapazitäten – allein 25.000 neue Windräder bei mangelnder Akzeptanz und inzwischen 1000 Bürgerinitiativen – schnell geschaffen werden sollen, und wer die Investitionen von vielen 100 Mrd. Euro stemmen soll – dazu gibt es in der Studie wie auch bei vielen anderen Experten keine Aussage. Ohne wirtschaftliche und gesellschaftliche Tragfähigkeit scheitern aber die Stromwende und der damit verbundene Umweltschutz.
Trick 2: Hoffen auf das Ausland
Ganz dreist wird für 2030 einfach davon ausgegangen, dass unsere Nachbarländer in fossile und nukleare Kraftwerkskapazitäten investieren und wir uns bei deren Produktion bei Bedarf bedienen können. Im Klartext bedeutet das: Keiner unserer Nachbarn darf die gleiche Stromwende nach deutschem Vorbild umsetzen. Eine solche Prämisse ist allerdings weder nachhaltig noch ökologisch noch ökonomisch, sondern schlichtweg ein Eingeständnis, dass der deutsche Sonderweg als Exportschlager nicht funktioniert. Faktisch ist es schlimmer: Unsere Nachbarländer realisieren mit Phasenschiebern bereits neue elektronische Grenzzäune gegen Deutschland, um von den Risiken nicht angesteckt zu werden. Deutschland verursacht mit seinem Energiewende-Egoismus eine Markt-Desintegration statt Markt-Integration in Europa.
Trick 3: Studien werden themenfremd herangezogen
Außerdem werden Studien themenfremd herangezogen. Ein Beispiel aus einem Gastbeitrag der DIW-Ökonomin Claudia Kemfert : Es wird mit Hilfe einer Studie, die sich vorrangig mit den sogenannten Hellbrisen (also Zeiten mit viel zu viel Wind- und PV-Strom) beschäftigt, argumentiert, dass eine Dunkelflaute kein Problem sei. Nun ist es physikalisch aber viel einfacher, etwas, das zu viel da ist, wegzuschmeißen (etwa durch Abregeln von Windenergieanlagen), als etwas, was fehlt , herbeizuzaubern. Das ist beim Strom nicht anders als bei dem Beispiel mit den Pizzen.
Deutschlands Anteil an den weltweiten Emissionen beträgt lediglich zwei Prozent und liegt somit klar unter dem Anteil Deutschlands am weltweiten Bruttosozialprodukt. Die deutsche Energiewende kann ihre Vorbildfunktion daher nur dann entfalten, wenn sie ökologisch und ökonomisch erfolgreich ist. Statt Fake-News und gefährlichem Halbwissen brauchen wir dringend eine technisch-wissenschaftliche Diskussion und eine ehrliche Analyse, wie wir den Erfolg der Energiewende doch noch ökonomisch und ökologisch verlässlich sicherstellen beziehungsweise retten. Ein unkoordiniertes „Weiter so“ können wir uns – auch im Hinblick auf die nachfolgenden Generationen - nicht leisten.
Kennen Sie schon unseren Newsletter „Die Woche“ ? Jeden Freitag in ihrem Postfach – wenn Sie wollen. Hier können Sie sich anmelden