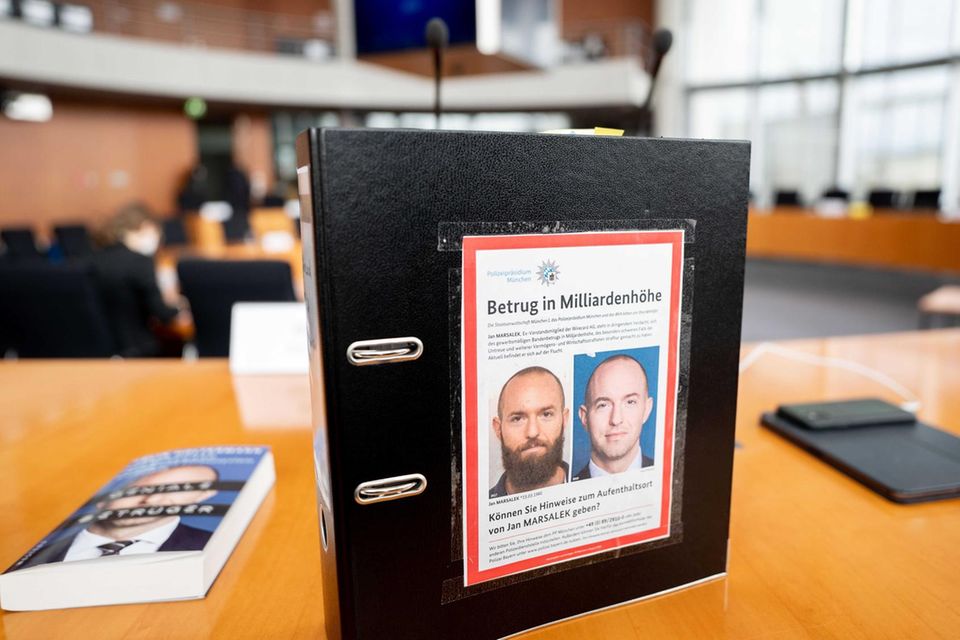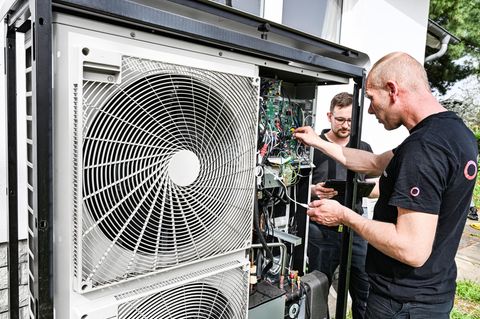„Die Sonne schickt uns keine Rechnung“ war Leitmotiv der Energiewende: Sobald die Technik ausgereift ist, sind die Kosten günstig. So der Anspruch. Aber trotz einer enormen technischen Entwicklung über 30 Jahre ist Strom für Verbraucher und Industrie heute teuer. Die Energiewende ist aber nur erfolgreich in einem kosteneffizienten Gesamtsystem. Preisbremsen finanziert aus Steuermilliarden, wie sie jetzt die Industrieverbände und der DIHK fordern, sind eine Illusion. Stattdessen müssen wir genauer auf die Fehlsteuerungen schauen.
Folgende Fehlanreize müssen dringend behoben werden:
Stromerzeugungskosten Windenergie
In einer CO2-freien Stromversorgung wird die Windenergie den größten Einzelbeitrag liefern müssen. Daher ist der Blick auf die Stromkosten aus Wind besonders wichtig.
In Deutschland werden Pachten für Windstandorte von bis zu 30 Prozent vom Umsatz bezahlt. Einzelne Grundeigentümer erhalten Jahrespachten von mehreren 100.000 Euro pro Jahr. Diese Pachten sind ein direkter Indikator für zu hohe Erlöse infolge des nicht funktionierenden Wettbewerbs. Die Pachthöhe sollte auf maximal fünf Prozent vom Umsatz beschränkt werden. Das ist dann immer noch ein Vielfaches einer Landwirtschaftspacht. Das ist einfach zu regeln im Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG): Wer mehr zahlt, erhält keine Vergütung aus dem EEG.
Das praktizierte Ausschreibungsmodell für Wind ist falsch. Es täuscht einen Wettbewerb nur vor, wenn das Ausschreibungsvolumen höher ist als die Menge der angebotenen Projekte. Die Anbieter orientieren sich immer an der veröffentlichten Preisobergrenze von zurzeit 7,35 Cent pro Kilowattstunde. Diese Grenze ist zu hoch. Und es muss einen Anreiz geben, Angebote günstig zu kalkulieren. In jeder Ausschreibungsrunde sollten die teuersten 20 Prozent keinen Zuschlag erhalten. Sie können sich dann später wieder bewerben. Nur so entsteht ein Preiswettbewerb.
Das Referenzertragsmodell im EEG soll die Vergütung pro Kilowattstunde nach der Windhöffigkeit des jeweiligen Standortes staffeln und so überall einen ausreichend wirtschaftlichen Betrieb zu ermöglichen, ohne dabei gute Standorte zu überfördern. Heute wird das Modell „missbraucht“: Die Flächen werden extrem dicht bebaut. Die Verluste durch gegenseitige Windwegnahme gleicht das EEG dann durch höhere Vergütung aus. Preis aus Zuschlag aufgrund der Ausschreibung (maximal 7,35 Cent) mal 1,4. Dann liegt die reale Vergütung für Windstrom bei über 10 Cent pro Kilowattstunde. Die dichte Bebauung macht den Windstrom teuer. Zudem beeinträchtigen die Turbulenzen der Anlagen die Lebensdauer und führen somit später nochmal zu höheren Kosten. Das muss sofort geändert werden.
Das EEG sichert heute eine Mindestvergütung. Wenn wie im Jahr 2022 die Preise nach oben schießen, geht auch der Erlös aus Erneuerbare-Energien-Anlagen steil mit nach oben, obwohl die Betreiber keine Energierohstoffe einkaufen müssen. Das ist falsch. Markterlöse, die deutlich über die Mindestvergütung hinausgehen, sollten zur Entlastung der Stromkosten zurückgeführt werden. Diese Entlastung steht den Stromkunden schon deshalb zu, weil sie die Entwicklung der Windenergie über 25 Jahre durch die EEG-Umlage finanziert haben.
Die Kosten für Windstrom können durch diese Korrekturen um mindestens 3,5 Cent je Kilowattstunde gesenkt werden. Bezogen auf die Ausbauziele bis 2035 wäre das allein für Wind an Land eine Kostensenkung um 43 Mrd. Euro. Der Kostenblock Marktprämie für Wind an Land könnte auf ein Drittel sinken.
Netze und Netzentgelte
Auch im Bereich der Netze kann die Korrektur von Fehlanreizen die Kosten senken.
Optimierte Netznutzung vor Ausbau: Viele Netze werden immer noch blind gefahren. Die Auslastung wird so beschränkt, dass im Worst Case die technischen Grenzen nicht erreicht werden. Es fehlen einfache Temperaturüberwachungen an Ortsnetztrafos und Freileitungen. Durch eine falsche Auslegung des n-minus-eins-Sicherheitsprinzips werden Hochspannungsleitungen nur zu 50 bis 70 Prozent ausgelastet. Ein Monitoring ist kostengünstiger und schneller, als neue Netze zu bauen. Und es ist auch kosteneffizienter, als Windenergieanlagen abzuschalten und die Kosten der Abschaltung auf alle Stromkunden umzulegen (derzeit rund 6 Mrd. Euro jährlich).
Ein Beispiel: Die Eon-Tochter Avacon betreibt im Kreis Paderborn Hochspannungsnetze, in die viele Windparks einspeisen. Seit acht Jahren werden hier Windparks wegen Netzüberlastung abgeschaltet. Es handelt sich um die meisten Abschaltungen in ganz Nordrhein-Westfalen. Avacon verspricht seit Jahren, eine neue Leitung zu bauen, hat aber noch nicht angefangen. Dabei wird die bestehende Leitung nicht durch ein seit Jahrzehnten bekanntes Leiterseilmonitoring zu 100 Prozent ausgelastet. Es grenzt an Satire, dass jetzt das Fraunhofer IEE veröffentlicht, es gebe neue Ansätze für eine höhere Auslastung bestehender Leitungen: Neue Ansätze für die kurative Systemführung sollen höhere Auslastung der Verteilnetze ermöglichen. Das wird anderswo lange schon so praktiziert.
Beschwerden bei der Bundesnetzagentur (BNetzA) über diese Verzögerungen führen lediglich dazu, dass die BNetzA an die Eon-Tochter freundliche Briefe schreibt. Von konsequentem Handeln einer Aufsichtsbehörde kann hier nicht die Rede sein.
Die BNetzA muss die Netzbetreiber verpflichten, ihre bestehenden Netze so zu betreiben, dass sie innerhalb der technischen Grenzen ausgelastet werden. Netzbetreibern, die das verweigern, sollte die BNetzA keine Umlage der Redispatch-Kosten auf die Netzentgelte erlauben. Sie sollten die Kosten aus ihren Gewinnen bezahlen. Ungeachtet dessen ist aber klar, dass wir neben der besseren Auslastung auch einen Ausbau der Netze brauchen.
Einführung dynamischer Netzentgelte auf allen Spannungsebenen. Im Jahr 2023 wurden rund 14,5 Mrd. Kilowattstunden Strom aus Solar- und Windkraftanlagen abgeregelt. Starre Netzentgelte verhindern, den Strom dann zu nutzen, wenn das Angebot hoch und die Börsenpreise niedrig sind. Wenn die Netzentgelte pro Kilowattstunde höher sind als der Gaspreis, kann der Strom selbst dann nicht wirtschaftlich in Power-to-Heat-Anlagen (PtH) fließen, wenn er verschenkt wird.
Diese Absurdität wird seit Jahren vom Gesetzgeber und der BNetzA ignoriert. Lediglich in der Niederspannung werden jetzt ab 2025 nach Tageszeit unterschiedliche Entgelte angeboten. Viele Anwendungen wie PtH oder E-Autoladen können regional ohne Umweg über Übertragungsnetze stattfinden.
Örtliche Verteilnetze sind heute im Schnitt nur zu 20 Prozent ausgelastet. Wenn der zusätzliche Strom über die 24 Tagesstunden richtig verteilt wird, braucht es viel weniger Ausbau der Verteilnetze. Dafür sind flexible Tarife erforderlich. Mehr Kilowattstunden über ein vorhandenes Netz zu schicken, müsste für diese Netze sogar eine Senkung der Entgelte ermöglichen.
Die gesetzliche Vergütung wird heute nur gewährt, wenn der Windstrom in öffentliche Netze eingespeist wird. In vielen Fällen bietet es sich aber an, den Windstrom über Direktleitungen unmittelbar an Industriebetriebe zu liefern. Es gibt keinen sachlichen Grund, für diese Fälle die Zahlung von Marktprämien zu versagen. Ungestört von starren gesetzlichen Netzentgeltvorgaben könnte Windstrom zu sehr wettbewerbsfähigen Preisen an die Industrie geliefert werden und gleichzeitig die allgemeinen Netze entlasten.
Neue Akteure im Netzbetrieb: Die Aufhebung des Fernmeldemonopols 1998 hat Wettbewerb und sehr viel günstigeren Preisen geführt. Wir sollten den gleichen Schritt für die Stromnetze gehen.
Und schließlich: Die Investitionskosten für den Ausbau der Übertragungsnetze insbesondere für die Hochspannungsgleichstromübertrag (HGÜ) werden aktuell auf 320 Mrd. Euro geschätzt. Die Umlage dieser Kosten auf die Netzentgelte wird diese nochmals um mehrere Cent pro Kilowattstunde verteuern. Der größte Kostentreiber dabei ist die Erdverkabelung anstelle von Freileitungen. Netzbetreiber schätzen, dass Errichtung und Betrieb von Erdkabeln (HGÜ) um das Siebenfache teurer sind als Freileitungen. Die Vorschrift, HGÜ nur als Erdkabel zu verlegen, muss abgeschafft werden.