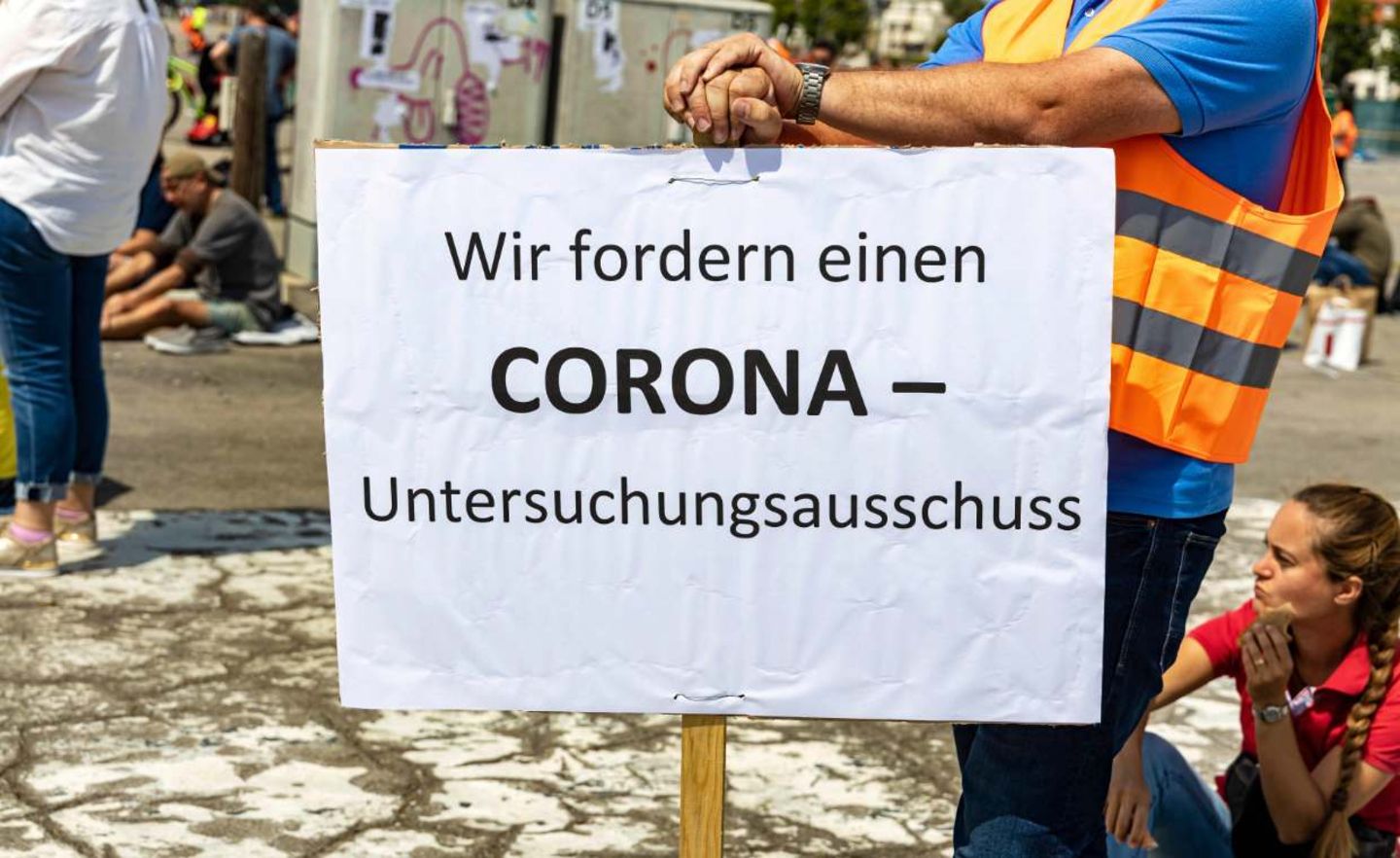Die Kritik an den Maßnahmen, die von der Bundesregierung und den Landesregierungen gegen eine Verbreitung des Covid-19-Virus beschlossen wurden, wird derzeit lauter. Dabei ist die Gruppe der Kritiker sehr heterogen. Es gibt solche, die nicht an der Gefährlichkeit des Virus zweifeln und auch die gesellschaftlichen Risiken sehen, die etwa mit einer Überlastung des Gesundheitswesens verbunden sind. Gleichzeitig halten sie aber die Spielräume für verantwortungsvolle Lockerungen für größer, als die Regierungen es derzeit tun. Andererseits gibt es aber auch eine Gruppe von Kritikern, die fundamental bestreiten, dass mit der Verbreitung des Covid-19-Virus überhaupt erhebliche Gefahren verbunden sind.
Während die erste Gruppe an einer rationalen Debatte über die Sinnhaftigkeit der noch bestehenden Maßnahmen teilnimmt, gilt dies für die zweite Gruppe kaum. Hier bewegt man sich an der Grenze zu Verschwörungstheorien, oder man überschreitet diese Grenze sogar. Die Expertise von Epidemiologen und Virologen wird von Laien und fachfremden Wissenschaftlern beiseitegeschoben. Soweit die verfügbaren Daten überhaupt zur Kenntnis genommen werden, betrachtet man diese mit einfachsten Mitteln, was zu schweren Fehlern in der Interpretation führt.
Ein Beispiel die Behauptung, die sogenannten Lockdown-Maßnahmen seien völlig wirkungslos. Diese Behauptung wird mit einem Hinweis darauf unterfüttert, dass in der Zeitreihe der Covid-Todesfälle und der Covid-Infektionen in Deutschland kein klarer Bruch im Sinne eines schnellen Absinkens der Zahlen nach Inkrafttreten der Maßnahmen zu sehen sei. Diese reine Beobachtung ist zwar zutreffend, die Schlussfolgerung jedoch durch die Beobachtung nicht gedeckt, da sie zahlreiche weitere Einflussfaktoren ausblendet.
Die Corona-Einschränkungen haben etwas bewirkt
Wir wissen beispielsweise, dass viele Bürgerinnen und Bürger in Deutschland ihr Verhalten bereits vor Inkrafttreten der formalen Regeln geändert haben. Sie wuschen sich häufiger die Hände, mieden größere Gruppen, oder bewegten sich eher mit dem PKW als mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Solche freiwilligen Verhaltensanpassungen wurden dann vermutlich durch die politischen Maßnahmen verstärkt und vor allem über längere Zeit stabilisiert. Es gab also im tatsächlichen Verhalten keine plötzliche, dramatische Änderung an einem Stichtag, sondern ein schrittweises Einschleichen vorsichtigen Handelns.
Ein anderes Argument der Skeptiker ist, dass alle Verläufe von Epidemien einen logistischen (S-förmigen) Verlauf in der Zeit haben, also die Zahl der Infizierten von selbst irgendwann abflacht. Auch das ist zunächst einmal richtig. Aber die für die Politik relevante Frage ist, ob sie durch kluge Maßnahmen den Wert, gegen den die Zahl der Infizierten konvergiert, senken kann. Es macht einen Unterschied, ob die Zahl der Todesopfer wie in Deutschland bei 7533 Toten (Stand 12.5.2020) steht, oder wie in Italien und Großbritannien bei jeweils über 30.000 Toten.
Kennen Sie schon unseren Newsletter „Die Woche“ ? Jeden Freitag in ihrem Postfach – wenn Sie wollen. Hier können Sie sich anmelden
Zwar ist in allen drei Ländern grob der logistische Verlauf zu erkennen, aber die Behauptung, politische Eingriffe und institutionelle Rahmenbedingungen hätten keinen Einfluss auf die Werte, gegen die solche logistischen Verläufe konvergieren, erscheint angesichts der dramatischen Unterschiede im Länderquerschnitt absurd. Man muss also auch hier wieder genauer hinschauen, die jeweils besonderen Bedingungen einzelner Länder berücksichtigen und erst dann überlegen, welchen Effekt die Maßnahmen im Zusammenspiel mit all diesen Bedingungen hatten.
Hat etwa Italien nicht strikte Lockdown-Maßnahmen beschlossen, aber dennoch eine hohe Zahl von Infizierten und Verstorbenen? Durchaus. Aber auch hier steckt der Teufel im Detail. Es ist möglich, dass Italien durch gesellschaftliche und demographische Einflüsse von vornherein gefährdeter war. Dazu zählen etwa das engere Zusammenleben von älteren und jüngeren Familienmitgliedern, sowie generell der höhere Anteil älterer Menschen an der Bevölkerung.
Corona-Kritik missachtet die Komplexität
Man darf, und das ist der Punkt, nicht einfach nur behaupten, Italien habe einen strikteren Lockdown, aber mehr Infizierte, also seien Lockdowns unsinnig. Man muss sich vielmehr auch die weiteren Faktoren anschauen, die unterschiedliche Verläufe in unterschiedlichen Ländern erklären. Dann könnte man zu dem Schluss kommen, dass Italien ohne politische Maßnahmen in einen noch viel katastrophaleren Verlauf hätte abgleiten können.
Wie es bei Populisten oft der Fall ist, so verweigern auch die radikaleren Kritiker der Corona-Politik eine angemessene Berücksichtigung von Komplexität im Zusammenspiel zahlreicher Einflussfaktoren. Inzwischen gibt es allerdings auch die ersten Analysen der Wirksamkeit politischer Maßnahmen mit modernen statistischen Methoden. Die Evidenz, die etwa für Italien und Spanien vorliegt, deutet auf eine starke Wirksamkeit der sogenannten Lockdown-Maßnahmen hin. Und auch für Deutschland findet eine aktuelle Studie von Tobias Hartl, Klaus Wälde und Enzo Weber eine deutliche Wirksamkeit einiger Lockdown-Maßnahmen, indem sie regionale Unterschiede in den Zeitpunkten der Umsetzung von Maßnahmen als Ausgangspunkt der Analyse nimmt.
Vor dem Hintergrund der seriösen wissenschaftlichen Diskussion ist die Behauptung einer Wirkungslosigkeit der Lockdown-Maßnahmen also derzeit überhaupt nicht haltbar. Man benötigt keine exzentrischen Verschwörungstheorien, um zu verstehen, wieso fast überall in Europa Regierungen temporäre Einschränkungen für die Bewegungsfreiheit ihrer Bürgerinnen und Bürger eingeführt haben. Es handelte sich dabei schlicht um eine rationale Reaktion auf die medizinische Gefährdungslage und die erhebliche Unsicherheit, die mit dieser verbunden war.
Bei Lockerungen ist Vorsicht geboten
Entsprechend rational sollte nun auch evidenzbasiert diskutiert werden, welche Lockerungen in welcher Reihenfolge sinnvoll sind. Die oben erwähnte Studie von Hartl, Wälde und Weber gibt Hinweise darauf, dass Schulschließungen, Kontaktverbote und die Einschränkung von Profi- und Breitensport die Ausbreitung des Virus besonders stark verlangsamt haben. Eine Öffnung europäischer Außengrenzen scheint dagegen relativ bedenkenlos möglich zu sein. Und auch andere Bereiche des öffentlichen Lebens könnten ohne große Nebenwirkungen wieder geöffnet werden.
Es ist sicherlich sinnvoll, hierbei vorsichtig vorzugehen und nach jedem überschaubaren Lockerungsschritt erst einmal die weitere Entwicklung der Zahl der Infizierten zu beobachten, bevor wiederum neue Schritte eingeleitet werden. Dabei sollte man auch darauf achten, eine mögliche Abwägung zwischen medizinischen Risiken und wirtschaftlichen Kosten der Corona-Maßnahmen realistisch vorzunehmen. Der wirtschaftliche Nutzen sehr schneller Lockerungen sollte nicht überschätzt werden, zumal es auch aus ökonomischen Erwägungen heraus unbedingt gilt, eine starke zweite Infektionswelle zu vermeiden.
Zwar ist es zu erwarten, dass Lockerungen in einzelnen Branchen, wie etwa der Gastronomie, dort zu spürbaren Verbesserungen der wirtschaftlichen Lage beitragen. Die exportorientierte Industrie dagegen ist stärker von einer Erholung der ausländischen Nachfrage als von der Aufhebung inländischer Corona-Maßnahmen abhängig. Hier darf man von einer Änderung der Politik bloß in Deutschland keine schnellen Wunder erhoffen.
Wenn es nach dem Ende der Krise zu einer umfassenden, rückblickenden Bewertung der deutschen Corona-Politik kommt, wird man sicherlich einige berechtigte Ansatzpunkte für scharfe Kritik finden. Dazu gehört etwa die fehlende Vorsorge bei der Beschaffung von Vorräten an Material und Gerät, die vor allem in der Frühphase der Krise zum Problem wurde. Ebenso gehört dazu die desaströse Informationspolitik hinsichtlich der Wirksamkeit von Schutzmasken. Die Implementation von Lockdown-Maßnahmen im März ist dagegen nach dem heutigen Stand des Wissens rückwirkend als angemessen und effektiv zu bewerten.
Man sollte daher keinesfalls der populistischen Versuchung erliegen, Maßnahmen, die einen schwereren Krisenverlauf verhindert haben, für unnütz zu erklären, weil die Katastrophe ausgeblieben ist.
Jan Schnellenbach ist Wirtschaftswissenschaftler und Professor an der Brandenburgischen Technischen Universität in Cottbus