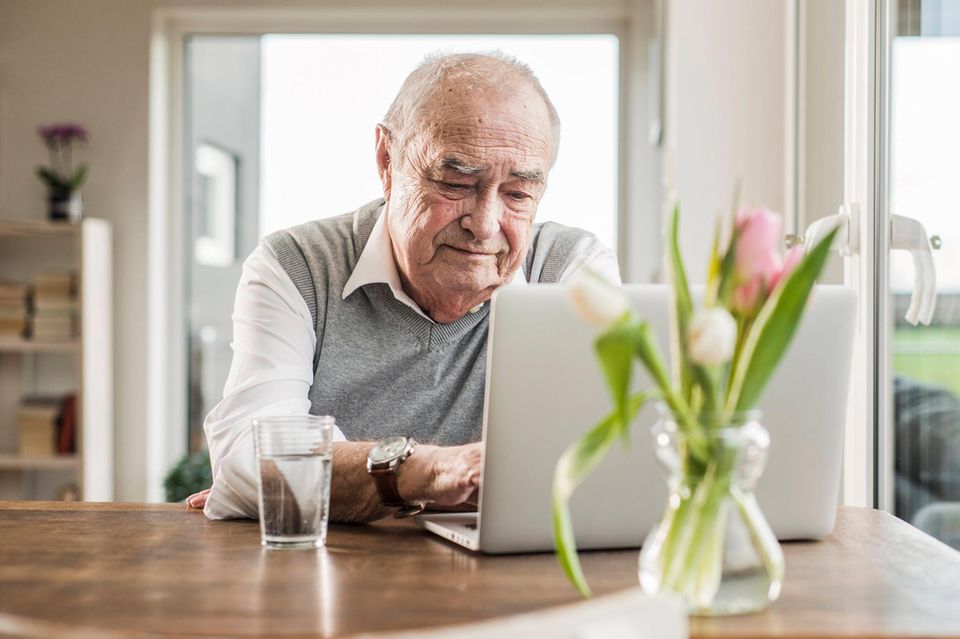If it’s not on Instagram, it didn’t happen.
Ohne Frage hat eine Umverteilung stattgefunden, bei der das Dokumentieren von Erlebtem das tatsächliche Erleben in seiner Bedeutung überlagert, bisweilen beinahe ganz ablöst. Irgendwie ist uns allen klar, dass es im Leben um die tatsächlich erlebten Erfahrungen geht – und dennoch kann man es nicht von der Hand weisen: da hat sich was erstaunlich weit verschoben. Anscheinend wollen wir der virtuellen Darstellung eine solch große Bedeutung beimessen, wir wollen ein Stück weit auf die uns präsentierte Fake-Realität reinfallen und auch selbst damit spielen.
Wir nehmen die Verschmelzung von realem und digitalem Leben immer weiter in Kauf, vielleicht ist es ja auch gar nicht so schlimm. Und natürlich, viele von uns lassen ihr Leben in den sozialen Medien etwas aufregender und schöner aussehen als es tatsächlich ist. Das überrascht jetzt auch nicht wirklich, man mag das gut oder schlecht finden, ist eigentlich egal. Solange es nur darum geht, zu zeigen, wie aufregend das eigene Leben ist und wie toll unsere Freunde aussehen, wenn sie in den Infinity-Pool springen – geschenkt, alles gut.
Problematisch wird es aber, wenn es sich um eine gesellschaftlich relevante Causa handelt, um politische oder soziale Statements. Wenn es um Haltung, um Kritik und um die eigene Positionierung in sozialen und politischen Fragen geht. Dann kann diese Umwertung gefährlich sein oder zumindest bedenklich. Vor allem, weil es so bequem ist. Ein Quick-Win sozusagen: Schnell ist mal ein schwarzes Quadrat gepostet und ein paar schöne Fotos von der Black Lives Matter Demo, eine lustige AfD-Kritik, ein Rainbow-Post, Solidarität zur LGBTQ-Community gezeigt, schnell noch ein Statement fürs Impfen gegen Covid oder ein schwarz-weiß Portrait mit dem Hashtag #challengeaccepted, um Female Empowerment zu supporten und zugleich auf Femizide in der Türkei aufmerksam zu machen. Und wie die Menschen an den Außengrenzen Europas behandelt werden, ist auch nicht okay, dazu habe ich erst mal einen Post gemacht!
Und schon kann man sich ein bisschen besser fühlen, ein ganz klein wenig zurücklehnen – man hat ein Statement gesetzt, virtuell Flagge gezeigt, teilgenommen für die gute Sache. Und unsere Bubble spiegelt uns das auch zurück (toll, wie du deine Reichweite nutzt für dieses wichtige Thema!) Dazu ein paar Herz-Emojis und wir können uns dem nächsten Thema im Feed zuwenden: neue Pflanzen für den Balkon!
Ein gutes Signal, aber was dann?
Natürlich kann ein sozialer oder politischer Haltungspost durchaus viel bewegen, kann nötig und richtig sein und wir können damit Aufmerksamkeit auf wichtige Themen lenken, gar keine Frage. Es gibt keinen Grund, das schlecht zu reden. Und dennoch ist da diese schleichende Aushöhlung des tatsächlich ernstgemeinten Engagements, die bedenklich ist. Bedenklich in dem Sinne, als dass wir uns selbst das Gefühl vermitteln, damit bereits etwas geleistet zu haben. Aber was passiert dann? Bleibt es bei dem kurzen Signal an die Followerschaft oder geht die Beschäftigung mit dem Thema weiter?
Wirkliche Auseinandersetzung mit einem Thema ist unbequemer, dauert länger, erfordert mehr Recherche. Sich einlesen, Dinge hinterfragen, vergleichen und sich eine fundierte Meinung bilden, ist nicht so easy instagramable. Zudem unterstützen die Belohnungsmechanismen der sozialen Medien keine tiefgehende Auseinandersetzung, sondern funktionieren an der Oberfläche. Ein kurzer Post kann mehr Bestätigung bringen als jahrelange Auseinandersetzung, von der niemand etwas mitbekommt.
Aber viele Themen erfordern eben genau diese tiefere Auseinandersetzung, zwingend. Ein Beispiel ist der im Sommer letzten Jahres wieder aufgeflammte Nahostkonflikt. Kaum flogen die Raketen über dem Gaza-Streifen, hatten sich zahlreiche Influencer (und dann auch schnell ihre Follower) schon auf die eine oder andere Seite geschlagen, ihre Meinung blitzschnell gefunden und ergriffen Partei, posteten ihre Statements, ohne wirklich Ahnung zu haben. Vor dem Hintergrund des historisch gewachsenen und sehr komplexen Konflikts zwischen Israelis und Palästinensern, ist das natürlich völlig absurd. Ohne fundiertes Wissen über ein solches Thema sollte man sich im Zweifel doch lieber zurückhalten und erst mal tiefergehend informieren.
Warum aber posten wir trotzdem? Weil wir zeigen wollen, dass wir uns kümmern und dass es uns nicht egal ist? Dass wir nicht nur Avocado-Toasts posten, sondern auch relevanten Content? Sowas ähnliches, vermutlich.
Gefühlte Partizipation
Im digitalen Raum verschwimmen manchmal die Grenzen zwischen dem tatsächlichen Handeln in einer Sache und dem Darstellen von Handlungen und Positionen. Natürlich ist ein Social-Media-Post auch eine Handlung und kann sehr sinnvoll und ein starkes Statement sein, das Menschen beeinflusst, inspiriert, wachrüttelt und zum Nachdenken anregt. Aber vielleicht unterschätzen wir manchmal, wie diese Handlung auf uns selbst zurückwirkt. Wir haben plötzlich das Gefühl, es geht voran, wir bewegen etwas, wir sind aktiv, stehen gegen Unrecht auf. Die Autorin Fabienne Sand hat es treffend formuliert: „Sich heute fühlen, als würde man sich politisch positionieren und für Dinge einstehen, muss nicht mal mehr bedeuten, sich tatsächlich mit einer Materie auseinanderzusetzen. Wir nutzen politische Haltungen, Forderungen, Strukturkritik oder Einzelschicksale als performatives Mittel, weil es leicht und bequem ist und weil es innerhalb einer visuellen, selbstbasierten Darstellungsweise einfach dazu gehört. Mein Hund, meine Designercouch, meine Meinung zu Black Lives Matter, Transrights, Lukas Mokwitsch oder dem Hijab ban.“
Nun wird manch einer sagen: Ist das denn so schlimm? Nicht unbedingt, aber wir sollten uns dessen doch zumindest bewusst sein. Das eigene Selbstverständnis wird mehr und mehr von gefühlter Partizipation bestimmt. Und das konstante Gefühl von „es tut sich was“ kann trügerisch oder wie Sand sagt, „verheerend“ sein, denn: „Es nimmt das Gefühl der Notwendigkeit von realem politischen Engagement. Es vermittelt Fortschritt und erzeugt gleichzeitig Stagnation.“
Wir sind gefordert
Wollen wir tatsächlich etwas verändern oder geht es uns darum, der Welt zu zeigen, dass wir uns engagieren? Geht es um das Anliegen der Demo oder um die Fotos, die wir von der Demo posten? Darf Engagement zum Lifestyle werden? Darf das Darstellen eines Anliegens sich über das Anliegen selbst erheben? Wie nachhaltig wirken unsere Social-Media-Posts wirklich? Unser tatsächlicher Einsatz ist gefragt, viele wichtige Anliegen brauchen dringend unser reales Engagement. Die kommunikative Power unserer Generation ist vielleicht größer als wir denken, aber eben auch unsere Verantwortung: Raus aus der Selbstdarstellung, hin zum realen, nachhaltigen Engagement. Ja, es klingt old school und ist sicher der mühsamere Weg. Und ja, unter Umständen müssen wir uns dann mal wieder intensiver mit einer Materie auseinandersetzen und kriegen nicht haufenweise Likes und instant Bewunderung.
Wir haben zu allem schnell eine Meinung – das Problem ist nur, dass sie immer öfter auf Dingen basiert, die wir selbst in unserer Social-Media-Bubble erfahren haben. Beim beiläufigen Durchscrollen und Swipen, wenn wir die Quellen nicht unbedingt hinterfragen und uns bereitwillig auf die für uns vermeintlich passende Content-Auswahl der Algorithmen einlassen. Lasst uns öfter mal nicht so schnell eine Meinung haben, sondern erst mal wirklich Interesse zeigen und eine Meinung nach und nach herausbilden.
Wir sind aktuell mehr gefordert denn je und das überall, nicht nur in den sozialen Medien. Auch im analogen Leben auf der Straße, in Initiativen, Vereinen, in der Uni, in der S-Bahn, im Supermarkt und im Büro. Es können schließlich auch Dinge eine Wirkung erzeugen, die wir nicht sharen. Man kann auch demonstrieren, Solidarität zeigen, spenden, helfen, recherchieren, aufklären, nachhaken und Haltung zeigen, ohne es jedem per Insta-Story mitzuteilen. Wenn das Teilen der eigenen Haltung wichtiger wird als die Haltung real zu leben, läuft etwas schief. Wer weiß, wie soziales Engagement in Zukunft noch aussehen kann. Aber eines ist sicher: die nächste Challenge kommt bestimmt.
Malte Bülskämper ist Texter und Kreativdirektor aus Berlin. In seiner Kolumne schreibt er über die kleinen Absurditäten des Alltags in unserer Kommunikationsgesellschaft.