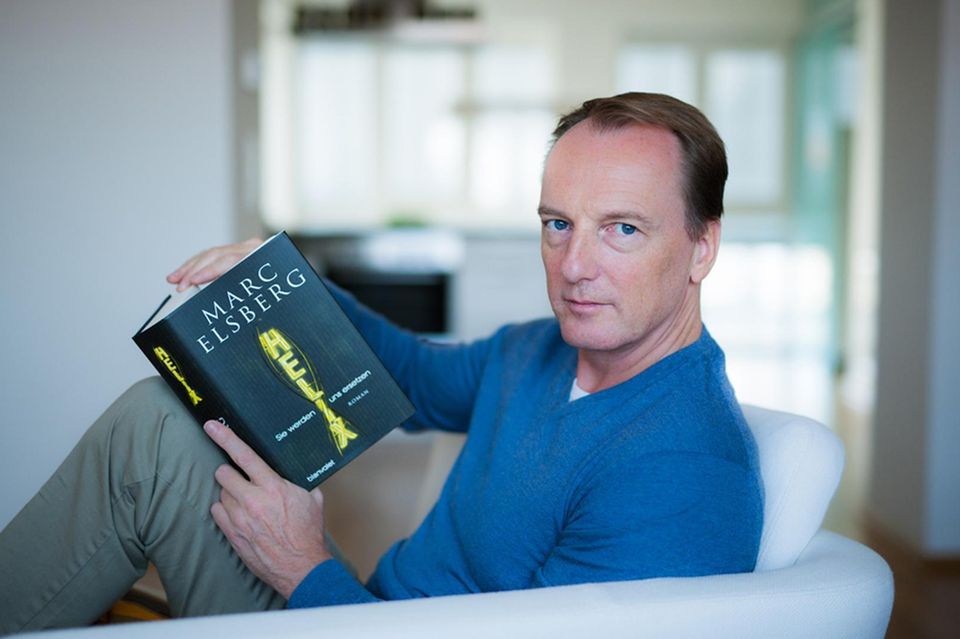Der Anleihenmarkt ist ein binäres Wesen: Es sieht jedes Ereignis entweder als inflationär oder deflationär an. Er hat schnell die Schlussfolgerung gezogen, dass Donald Trumps überraschender Sieg ersteres sei: inflationär. Seitdem sind die Renditen zehnjähriger US-Staatsanleihen um einen Drittelprozentpunkt geklettert. Davon lässt sich ungefähr die Hälfte auf gestiegene Inflationserwartungen zurückführen.
Das ist eine Überreaktion. Präsidenten und die Politik vollziehen gelegentlich 180-Grad-Wenden, Inflation und Wirtschaftswachstum tun das nicht. Die USA und die Weltwirtschaft stecken seit 2009 in einem Umfeld niedrigen Wachstums, niedriger Zinsen, und auch Donald Trump wird dies nur marginal ändern können.
Trumps Wahl ist ein Zeichen für den globalen Aufstieg des Populismus, ein Phänomen, das in der Vergangenheit häufig zu Inflation geführt hat – ein Risiko, das stets später folgen sollte.
Auf den ersten Blick sieht Trump wie ein Politiker aus, der eine neue Ära fiskalischer Impulse einleitet, die mit neuen Schulden finanziert werden sollen. Er hat einige Steuersenkungen in Aussicht gestellt, deren fiskalische Defizite sich laut Analysten auf ein Gesamtvolumen von 6 Billionen US-Dollar über ein Jahrzehnt summieren. Hinzu kommen noch hunderte von Milliarden über weitere Steuer- und neue Infrastrukturmaßnahmen.
Überschaubarer Wachtumsimpuls
Das ist sehr viel, aber auf der Welt gibt es auch einen strukturellen Überhang an Ersparnissen und einen Mangel an Investitionen. In diesem Jahr werden alleine die Eurozone, China und Japan kombiniert einen Leistungsbilanzüberschuss von rund 850 Mrd. Dollar ausweisen. Er ist definiert als die Bilanz sämtlicher Handels- und Investitionsumsätze mit dem Ausland. Kurz: Die Defizite, die Trump mit Anleihen finanzieren muss, werden Käufer finden.
Der tatsächliche Einfluss auf das Defizit der USA könnte sogar kleiner ausfallen als erwartet. Trump scheint keine besonders große Affinität zu genauen Zahlen zu haben. Kevin Brady, republikanischer Vorsitzender des Steuerausschusses des Repräsentantenhauses, erklärte am vergangenen Dienstag noch, die Steuerreformen würden das US-Budgetdefizit nicht erhöhen.
Der Impuls für das Wachstum dürfte auch überschaubar sein. Steuererleichterungen wird es vor allem für große Firmen und Vermögende geben, deren Ausgabenverhalten nicht sonderlich stark von der Höhe der Steuerlast abhängt. Niedrigere Steuern sollten eigentlich Investitionen und Wachstum fördern, aber dieser Effekt ist unsicher und greift nur allmählich.
Makroökonomische Analysten schätzen, dass eine Steuersenkung um 4,5 Billionen US-Dollar, die sich grob aus Trumps Vorschlägen errechnen, das Wachstum über die kommenden drei Jahre um 0,2 Prozentpunkte erhöhen könnte. Bei Infrastrukturprojekten wird Trump sich der gleichen trüben Realitäten stellen müssen wie sein Vorgänger Barack Obama vor sieben Jahren: Es gibt recht wenige Projekte, die nur darauf warten, die Schaufel in den Boden zu rammen, also sofort in Angriff genommen werden können.
Inflationserwartungen langfristig niedrig
Anders als noch im Jahr 2009 träfe ein fiskalischer Impuls aber auf eine Wirtschaft, in der nahezu Vollbeschäftigung herrscht mit eher geringen Überkapazitäten. Dennoch wäre es vorschnell geurteilt, dass daher auch die Inflation anspringe. Im vergangenen Jahrzehnt ist die Inflationsrate – wenn man die Sprünge durch Energiepreise außen vor lässt – erstaunlich träge gewesen. Sie hat kaum auf die hohe Arbeitslosigkeit reagiert. Also dürfte das gleiche auch für einen möglichen Fall der Arbeitslosigkeit unter ihr „natürliches“ Niveau gelten.
Genau das wird auch die Antwort der US-Notenbank prägen. „Ich glaube nicht, dass wir sagen sollten: wenn es einen fiskalischen Impuls gibt, wissen wir, dass er zu einem bestimmten Anstieg der Inflation führen wird“, erklärte der Notenbankgouverneur Daniel Tarullo noch am Dienstag.
Natürlich beschleunigt ein fiskalischer Impuls dennoch den Prozess der Zinserhöhungen durch die Notenbank. Es wird aber wahrscheinlich nicht die Höhe ihres Endpunkts verändern. Langfristig werden die Zinsen und die Inflation durch strukturelle Faktoren wie eine alternde Bevölkerung und langsameres Produktivitätswachstum niedrig gehalten.
Zwar könnten auch Trumps Antiglobalisierungs-Pläne die Inflation anheizen. Aber wie stark? Goldman Sachs schätzt, dass Zölle von 35 bis 45 Prozent auf chinesische und mexikanische Importe, wie sie Trump androhte, weitere 0,2 Prozentpunkte auf die Inflation draufschlagen. Die sofortige Abschiebung von 2,5 Millionen illegalen Immigranten würde über die Verknappung des Angebots an Arbeitskräften die Inflation um 0,1 Prozentpunkte erhöhen.
Wichtig ist das Gesamtbild
Aber wird Trump überhaupt so weit gehen? Obwohl er klar ein Protektionist ist, haben Trump und seine Berater die Androhung der Zölle vor allem als Faustpfand für Verhandlungen bezeichnet und nicht das Vorspiel eines Handelskriegs. Sie wollen damit Konzessionen erreichen. Und schließlich hat Trump seine Pläne zu Abschiebungen wiederholt verändert. Zwar würde eine restriktivere Einwanderungspolitik einen negativen Einfluss auf die Produktivität haben, was wiederum die Kosten antreibt. Aber die niedrigeren Unternehmenssteuern und eine laxere Regulierung sollten genau in die andere Richtung wirken, schließlich sollen diese ja die Investitionen fördern.
Dennoch ist ein Sezieren von Trumps Plänen gefährlich. Wichtig ist das Gesamtbild. Er ist nur der letzte Politiker einer regelrechten Welle von Populisten, die weltweit das bestehende politische System herausfordert und sich dabei der Sympathie vieler sich entfremdet fühlender Menschen sicher sein kann.
In Schwellenländern haben Populisten häufig einen anfänglichen Wirtschaftsboom entfachen können, den eine laxe Fiskal- und Geldpolitik befeuert hat. Oft folgten Inflation und Krisen. In den USA gibt es hingegen weit stärkere Institutionen, einschließlich einer unabhängigen Notenbank. Und ein republikanisch beherrschter Kongress war schon immer ein harscher Kritiker zu laxer Geldpolitik und wollte diese sogar zum Gegenstand einer politischen Überprüfung machen.
Aber mit einem der ihren im Weißen Haus dürften sich die Republikaner im US-Kongress ohnehin weniger Gedanken um Wachstum und Inflation machen. Vor einem halben Jahrhundert begann die Inflation ihren Anstieg, als der angeblich unabhängige US-Notenbankchef dem politischen Druck dahingehend nachgab, zunächst unter Präsident Lyndon B. Johnson, dann unter Richard Nixon. Falls der US-Kongress die Unabhängigkeit der US-Notenbank nun beschneidet, könnte sie versehentlich damit den Weg für einen künftigen Anstieg der Inflation pflastern.
Copyright The Wall Street Journal