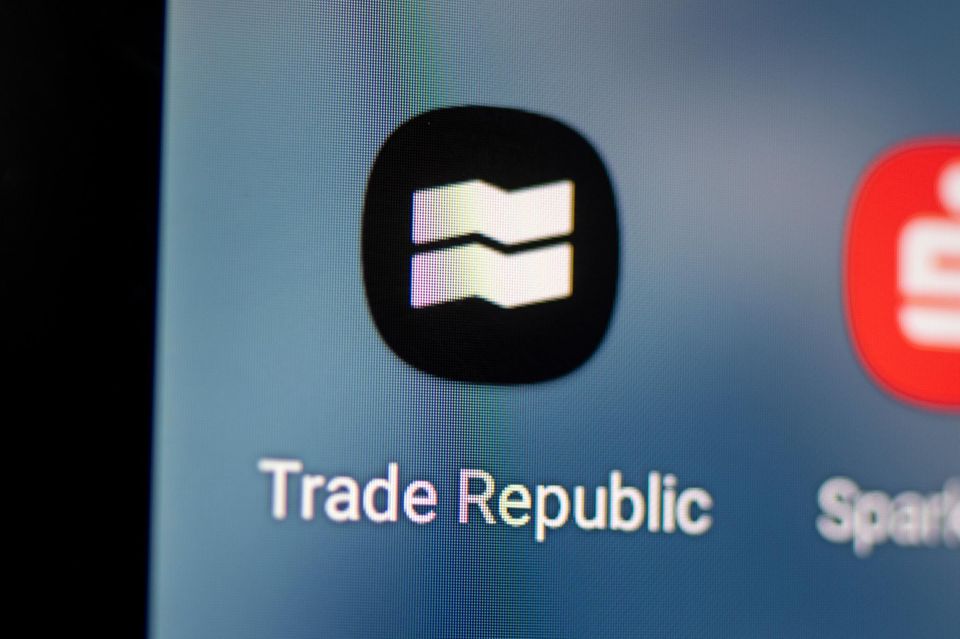Wenn man der russischen Führung eins zugestehen muss, dann ist es ein Sinn für Symbolik. Seit der Annexion der Krim im Jahr 2014, spätestens aber seit Beginn des Angriffskrieges gegen die Ukraine wird versucht, diplomatischen Schritten und Sanktionen des Westens mit Vergeltungsmaßnahmen zu begegnen – oder ihnen mit Drohungen zuvorzukommen. Ob diese Reaktionen dann sinnvoll oder angemessen sind, ist häufig eher zweitrangig: Es geht um das Signal.
Es dürfte daher kein Zufall sein, dass Russlands Staatschef Wladimir Putin gerade jetzt, Ende April, eine Anordnung unterzeichnete, mit der die russische Tochtergesellschaft des Haushaltsgeräteherstellers Bosch, BSH, sowie auch die des italienischen Unternehmens Ariston unter „temporäre Verwaltung“ des Gazprom-Konzerns überstellt werden.
Eine solche Halbenteignung ist nach internationalem Recht fragwürdig, worauf der Auswärtige Dienst der Europäischen Union in einer Stellungnahme auch umgehend hinwies. Allerdings wird aktuell in den USA und der EU ein weitreichender Schritt erwogen, der ebenfalls rechtliche Probleme aufwirft. Der Westen hatte nach dem Angriff auf die Ukraine russische Vermögenswerte eingefroren, insgesamt geht es um 300 Mrd. Dollar, zu denen der Zugang verschlossen wurde. Am 24. April unterschrieb US-Präsident Joe Biden ein Gesetz, das es erlauben würde, in den USA liegendes Kapital der Russen zu übernehmen und zur Unterstützung der Ukraine einzusetzen.
Europa diskutiert Verwendung russischer Gelder
Auch in Europa wird ein solches Modell diskutiert, allerdings sind die Vorbehalte hier deutlich größer als in den USA. Innerhalb der EU besteht in der Frage keine Einigkeit, was auch daran liegt, dass es kein historisches Vorbild dafür gibt, Vermögenswerte eines anderen Staates vollständig zu enteignen. Schon der Plan, lediglich Kapitalerträge aus dem eingefrorenen Vermögen zu verwenden, wie er aktuell diskutiert wird, hat Gegner. „Es gibt kaum ökonomische oder rechtliche Beispiele für die Übernahme ausländischer Währungsreserven“, heißt es in einer Analyse der Denkfabrik Brookings. „Und auch die langfristigen Effekte sind unsicher.“
In diesem Zusammenhang ist interessant, dass Putins Dekret gerade ein deutsches und ein italienisches Unternehmen trifft. Beide Staaten gelten in der EU eher als Zauderer in der Enteignungsfrage, weshalb der Schritt der Russen als Warnschuss zu verstehen sein dürfte. Ex-Präsident Dmitri Medwedew, mittlerweile eine Art dauerbellender Kettenhund des Kremls, hatte gleich nach Bidens Unterschrift damit gedroht, sein Land könne sich westliches Privateigentum einverleiben, falls die USA Ernst machten.
Dass die EU-Staaten in dieser Frage verletzlich sind, liegt auch daran, dass nach wie vor eine große Zahl an Unternehmen in Russland aktiv ist. Seit Beginn des Krieges veröffentlicht die US-Universität Yale eine Liste, in der genau darüber Buch geführt wird, wer Russland tatsächlich verlassen hat und wer seine operativen Geschäfte im Wesentlichen fortsetzt.
26 deutsche Firmen machen noch Geschäfte in Russland
In dieser „Business as Usual“-Kategorie sind Ende April immer noch 26 deutsche Unternehmen aufgeführt. Darunter finden sich Größen wie der Landmaschinenhersteller Claas, der Medizintechnik-Anbieter B. Braun und der Stahlkonzern Salzgitter. Im Fall Italiens sind es zwölf Unternehmen. Nicht alle diese Ableger produzieren vor Ort, aber in einer Reihe von Fällen gibt es tatsächlich noch etwas zu holen.
Auch dass ausgerechnet der Gazprom-Konzern nun erst einmal den Zugriff auf die beiden Unternehmen bekommen soll, hat symbolischen Wert. Der russische Gasriese hatte infolge der Umstellung der europäischen Energieversorgung seinen wichtigsten Markt eingebüßt und ist nun im Grunde auf der Suche nach einem neuen Geschäftsmodell. Die Haushaltsgeräte-Tochter „Bytowyje Systemy“, traditionell eher im Schatten des Gaskonzerns aktiv, dürfte dabei eine untergeordnete Rolle spielen. Als Akteur für Warnschüsse mit denkbar großem Effekt aber eignet sie sich gut.