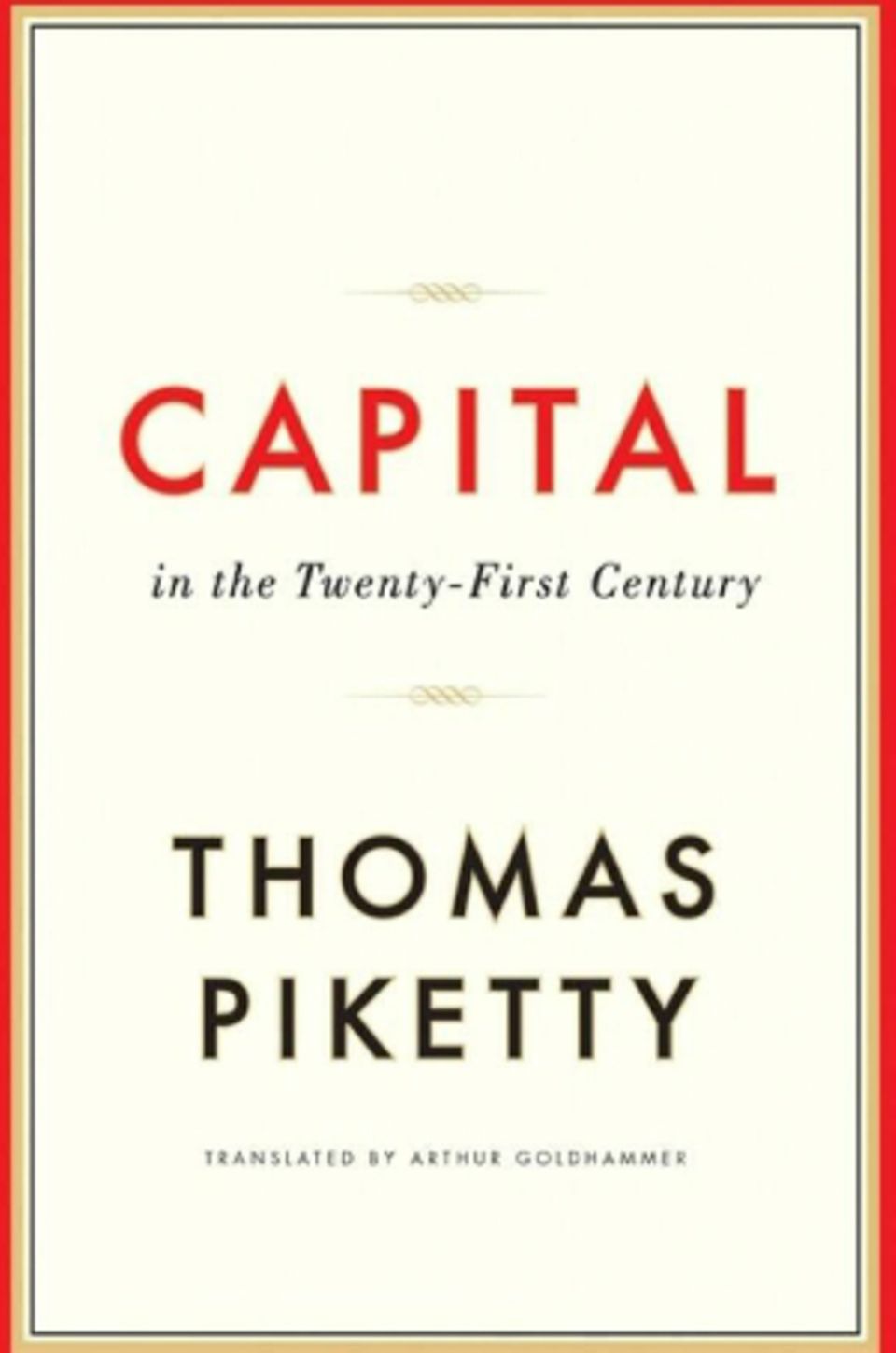Gert G. Wagner ist Professor für Volkswirtschaftslehre an der TU Berlin, Vorstandsmitglied des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW Berlin) und Max Planck Fellow am MPI für Bildungsforschung. Laut dem FAZ-Ranking der in der Politikberatung einflussreichsten deutschen Ökonomen liegt er auf Platz 10 der Ökonomen, auf die gehört wird.
Nicht nur in den Wirtschaftsteilen, sondern vor allem auch in den deutschen Feuilletons wird das Buch „Capital in the Twenty-First Century“ des französischen Ökonomieprofessors Thomas Piketty breit gewürdigt. Das ist erstaunlich - zumal das Werk zurzeit nur in englischer, aber noch nicht in deutscher Fassung vorliegt. Ein bemerkenswertes mediales Phänomen.
Ich gestehe: Freiwillig hätte ich nie zu einem 685 Seiten dicken akademischen Wälzer gegriffen, der ab Seite 579 Fußnoten und den Schlagwortindex enthält. Aber die Capital-Redaktion hat mich um eine Besprechung gebeten, also habe ich das voluminöse Werk zumindest quer gelesen. Ich unterstelle mal, dass viele Leser auch nicht mehr schaffen werden, denn das dicke Buch ist keine leichte Kost. Ausführlich beschäftigt es sich mit Statistiken zur Einkommens- und Vermögensverteilung.
Die vielen Statistiken kann man sich übrigens dankenswerterweise auf Pikettys Webseite kostenlos anschauen und herunterladen. Kurzzusammenfassungen gibt es im Netz einige, zum Beispiel beim Economist.
Es mag sein (und ist sogar ziemlich wahrscheinlich), dass ich nur auf den medialen Erfolg des Buches neidisch bin. Ich schreibe meine ganz persönliche und subjektive Einschätzung hier trotzdem: Die größte öffentliche Leistung des Buches (oder der Verlags-PR-Maschinerie?) besteht ohne Zweifel darin, dass das Thema „Verteilung“ wieder einmal in aller Munde ist. Das ist sicherlich nicht nur in Deutschland, sondern insbesondere auch in den USA, wo traditionell das Wachstum und nicht dessen Verteilung im Vordergrund steht, gesellschaftlich und politisch notwendig. Aber Überraschendes ist – zumindest für einschlägig interessierte Leser – in dem Buch kaum zu finden. Für Neulinge, die sich bislang nicht mit Verteilungsfragen und Chancengleichheit beschäftigt haben, bietet „Capital in the Twenty-First Century“ sehr interessante beschreibende Passagen.
Reiche werden in Statistiken kaum erfasst
Kurz zusammengefasst zeigt Piketty, dass die Reichen dieser Welt (wobei er sich auf die USA, Großbritannien und Frankreich konzentriert) im Durchschnitt zwei Weltkriege bestens überstanden haben, obwohl in etlichen Staaten die Kriegslasten (wie zweimal in Deutschland) durch Inflation faktisch zu Enteignung von Geldbesitzern geführt haben. Was aber auch heißt: Die Besitzer von Boden und Produktivkapital kamen gut durch.
Heutzutage gibt es immer stärkere Tendenzen, dass die Reichen und insbesondere Superreichen, die von den normalen Statistiken (etwa im Armuts- und Reichtumsbericht der Bundesregierung) gar nicht erfasst werden, sich vom Rest der Gesellschaft so gut es geht abschotten. Dazu gehört – wie im 19. Jahrhundert – exklusive Bildung der Kinder in Privatschulen und Internaten, gerne auch im Ausland.
Die Verknüpfung von selbst zusammengetragenen und berechneten Daten zum Einkommen und Vermögen mit jeder Menge historischer Details ist die große Stärke Pikettys. In normalen Statistiken sind solche Daten kaum zu finden. Er ist ein akademisch seriöser und anerkannter Verteilungsstatistiker, der zum Umfeld von Tony Atkinson (der als Verteilungstheoretiker immer wieder als Kandidat für den Nobelpreis genannt wird) und der Luxembourg Income Study LIS (die weltweit Daten zur Einkommens- und Vermögenssituation zusammenträgt und vergleichbar macht) gehört.
Die Daten von Piketty und seinen Kollegen zur Einkommensverteilung und insbesondere zu Top-Vermögen in verschiedenen Ländern sind ebenfalls – wie die Tabellen und Graphiken des Buches – online zu finden In der Datenbank World Top Income Database, die seit 2011 im Netz steht (auch speziell für Deutschland). In dieser Datenbank sind auch sehr hohe Einkommen und Vermögen zu finden (auf Basis von Steuerstatistiken), zum Teil sind die höchsten Einkommen geschätzt. Dazu sei angemerkt: In den normalen Stichproben, so auch dem vielgenutzten deutschen SOEP, fehlen die höchsten Einkommen und Vermögen (da selbst in einer Stichprobe von 10.000 Haushalten die Top 100 oder Top 1000 der Reichen im Normalfall nicht vertreten sind. Um einen aus den Top 1000 in einer Stichprobe zu haben, müsste die Stichprobe in Deutschland etwa 40.000 Haushalte umfassen! Um über die 1000 Reichsten etwas statistisch halbwegs sicheres sagen zu können, müssten aber zumindest über 30 in der Datenbasis sein!
Dies führt mich zu einer selbstkritischen Anmerkung im Hinblick auf wissenschaftliche Analysen: Da in den üblichen statistischen Erhebungen die wirklich Reichen fehlen, konzentriert sich der wissenschaftliche Sachverstand auf die Mitte der Gesellschaft und auf die Armut (Arme gibt es viel mehr als Reiche!). Man darf gespannt sein, ob der kommende Armuts- und Reichtumsbericht neue und bessere Informationen zum Reichtum in Deutschland liefern wird als die ersten vier Berichte.
Kritiker Pikettys, die darauf verweisen, dass es innerhalb der amerikanischen Gesellschaft jede Menge Ab- wie Aufstiege gibt (wenn auch nicht so viele wie in Skandinavien) haben recht. Allerdings erfassen alle diese Studien – weltweit – nicht die Reichsten. Das oberste Prozent der Einkommensbezieher und Vermögenden – das sind in Deutschland immerhin 800 Tausend Menschen – fehlt in statistischen Erhebungen fast immer. Dort finden sich aber die wirklich reichen Familien, die Superreichen, die ihre Vermögen zusammenhalten, hohe Einkommen – unabhängig von Begabung und Fleiß einzelner Familienmitglieder – erzielen und, wenn sie wollen, enormen politischen Einfluss nehmen können.
Ein politisches Programm?
Am Ende seines Werks fordert Piketty eine höhere Besteuerung der Reichen. Nun: Dass eine hohe Progression bei der Einkommenssteuer und eine spürbare Vermögensbesteuerung politisch erstrebenswert sein können, ist nicht gerade neu. Und Bierdeckelrechnungen, die zeigen wie groß die mobilisierbaren Steuereinnahmen sind, wenn man den Steuersatz so-und-so hoch ansetzt, gibt es reichlich. Was fehlt sind polit-ökonomische Analysen wie man solche Steuersysteme – und Bildungssysteme, die für akzeptable Chancengleichheit sorgen – in Demokratien mit vielen besorgten Eltern, die durch Bildung und Vermögen ihren Kindern bessere Lebenschancen verschaffen wollen, durchsetzen könnte. An der – wirklich interessanten Stelle – ist Piketty völlig blank.
Kapitel 15 beschäftigt sich mit einer „Global Tax on Capital“. Piketty bezeichnet seine Skizze als eine „nützliche Utopie“. Er will also eine öffentliche Diskussion anstoßen. Das ist sicherlich nicht falsch, aber wird ein frommer Wunsch ohne Details, auf die es in der Politik nun einmal ankommt, nachhaltig politisch wirken? Immerhin: Mit seiner Idee einer weltweit automatisierten Meldung von Banken-Informationen macht Piketty einen konkreten Vorschlag, den man im Detail diskutieren kann. Er weist zu recht darauf hin, dass so etwas technisch machbar ist, wenn etwa bereits in einem Land mit 300 Millionen Einwohnern (den USA) so etwas möglich ist.
Fazit
Ich persönlich bin ebenso neidisch auf den PR-Erfolg wie enttäuscht von den Politik-Empfehlungen. Man muss wieder einmal feststellen: Gute Daten und ingeniös berechnete Statistiken reichen nicht aus um gute und umsetzbare politische Vorschläge zu machen. Deswegen muss ich mich leider einem Kolumnisten des “Economist” anschließen: „Thomas Piketty’s blockbuster book is a great piece of scholarship, but a poor guide to policy.”
Mehr zu Thomas Piketty und seinem Buch gibt es in der neuen Capital. Dort finden Sie auch ein Interview mit dem Ökonomen, in dem er die Besteuerung großer Vermögen zur Sache des gesunden Menschenverstands erklärt: "Eine Steuer auf große Privatvermögen ist sozusagen die zivilisierte Form der Inflation".
Hier können Sie sich die iPad-Ausgabe der Capital herunterladen. Hier geht es zum Abo-Shop, wenn Sie die Print-Ausgabe bestellen möchten.