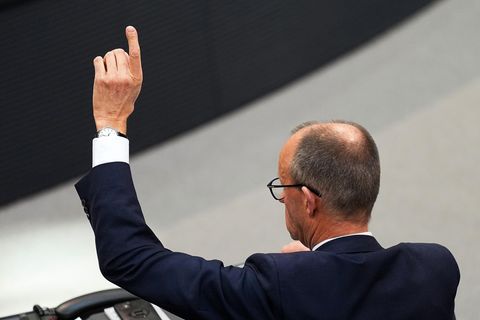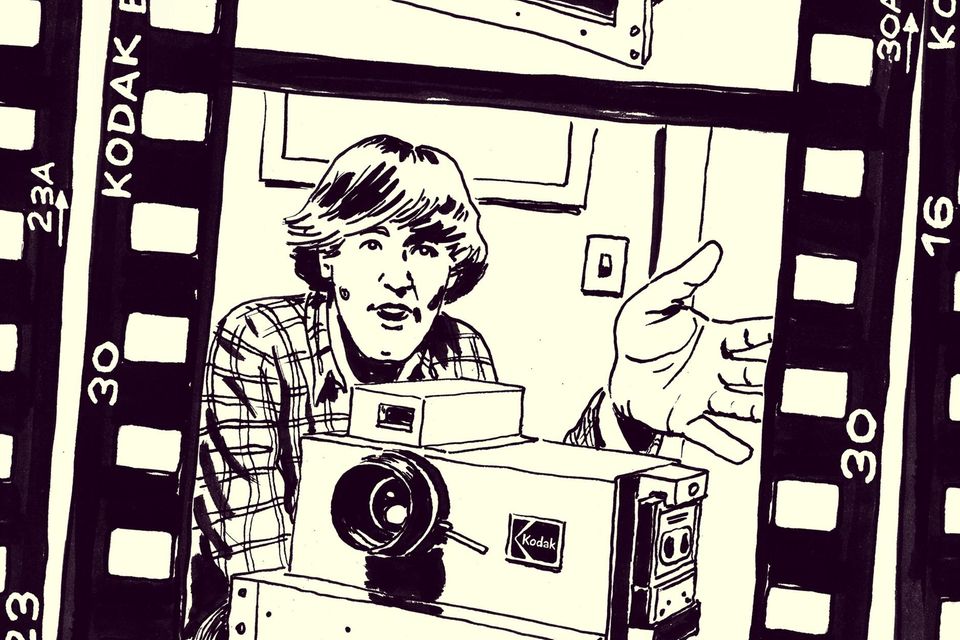Die Politik streitet sich wegen der Schuldenbremse. Es scheint dort nur zwei Positionen zu geben: glühende Anhänger und vehemente Gegner. Auf welcher Seite stehen Sie?
PHILIPPA SIGL-GLÖCKNER: Auf keiner der beiden. Es ist absolut sinnvoll und notwendig, eine Regel für staatliche Kreditaufnahme zu haben. Die Schuldenbremse ist in einem Teil sogar recht fortschrittlich, da sie keynesianische Finanzpolitik erlaubt. Der Staat darf mehr Schulden aufnehmen, wenn die Wirtschaft nicht ausgelastet und die Arbeitslosigkeit hoch ist. Im Gegenzug sollte der Staat sparen, wenn die Wirtschaft voll ausgelastet ist. Das ist eine gute Idee, die sollte man umsetzen. Dennoch sollte die Schuldenbremse unbedingt reformiert werden.
Warum?
Die Frage ist: Wann ist eine Wirtschaft voll ausgelastet? Die Antwort der Schuldenbremse: Das ist dann der Fall, wenn die Menschen ungefähr so viel arbeiten wie in der Vergangenheit.
Und das ist keine gute Grundlage?
Nein. Allein schon deshalb, weil in Deutschland die Erwerbsbeteiligung von Frauen früher niedriger war als bei Männern. Das Gesellschaftsbild hat sich mittlerweile geändert. Mehr Frauen wollen arbeiten. Noch wichtiger: Eine der größten finanziellen Herausforderungen sind die künftigen Renten. Es geht vor allem um die zu niedrigen Renten für Frauen, die in der Vergangenheit wenig eingezahlt haben und deswegen vor einer erheblichen Rentenlücke stehen. Das muss der Staat aus dem Bundeshaushalt bezuschussen. Die Zuschüsse zur Rente liegen derzeit bei 130 Mrd. Euro. Dieses Problem sollte die Bundesregierung unbedingt angehen, und zwar, indem sie dafür sorgt, dass alle, die können und wollen, in möglichst gut qualifizierten Jobs arbeiten. Denn je mehr Menschen genug für die Rente verdienen, desto weniger muss der Staat unterstützen. Investitionen in Erziehung und Bildung sind daher heute ganz besonders wichtig.
Wie sieht Ihr Vorschlag aus?
Wenn die Politik mehr unternimmt, um das Arbeitspotenzial zu erhöhen, dann sollte sie dafür mehr Verschuldungsspielraum im Rahmen der Schuldenbremse bekommen. Ein Beispiel: Wenn mehr Kitaplätze bereitgestellt werden und damit mehr Frauen arbeiten können, dann erweitert sich auch der Verschuldungsspielraum. Denn dann ist das Potenzial der Volkswirtschaft höher als früher. Das Gegenteil würde übrigens passieren, wenn man die Rente mit 60 einführt. Dann sinkt der Spielraum, weil Arbeitspotenzial verschwindet. Das ist aber nicht der einzige Grund, die Schuldenbremse zu reformieren.
Befürworter der Schuldenbremse argumentieren: Sie setze der Verschuldung des Staates enge Grenzen und verhindere, dass eine Regierung das Geld zum Fenster hinauswirft.
Die Schuldenbremse begrenzt nicht die Staatsschulden. Sie begrenzt die Neuverschuldung der Regierung, also wie viel sie im Haushalt mehr ausgibt als sie einnimmt. Die Neuverschuldung ist aber nur ein Faktor, der die Entwicklung der Schuldenquote beeinflusst – Zinsen, Wachstum, Inflation spielen oft eine größere Rolle.
Die Schuldenbremse begrenzt die Nettokreditaufnahme des Bundes auf 0,35 Prozent des Bruttoinlandsproduktes. Ist es sinnvoll, die erlaubte Neuverschuldung an eine bestimmte Kennziffer zu koppeln?
Gute Finanzpolitik lässt sich doch nicht über einen Algorithmus definieren. Die Schuldenbremse in der gegenwärtigen Form erlaubt es Politikern, sich der Verantwortung zu entziehen. Sie behaupten: Wir halten die Schuldenbremse ein und deshalb ist unsere Finanzpolitik gut. Und wird die Bremse nicht eingehalten, sei die Finanzpolitik schlecht. Aber es muss doch darum gehen, die Schuldenbremse auszulegen und das Wie und Warum der Bevölkerung zu erklären. Im Grundgesetz stehen wenige Sätze zur Schuldenbremse. Der Rest ist Auslegungssache in Form von Gesetzen und Verordnungen. Ich wünsche mir, dass darüber geredet wird, wie wir die Schuldenbremse so gestalten, dass sie in unsere Zeit passt und uns ermöglicht, auf die sehr großen Herausforderungen angemessen zu reagieren.
Was ist für Sie gute Finanzpolitik?
Sie überlegt, welche Ausgaben gegenwärtig sinnvoll, nachhaltig und finanzierbar sind. Das zu beantworten, ist wichtig. Dafür müssen zahlreiche Faktoren berücksichtigt werden. Auch Unternehmen stellen sich ständig solche Fragen: Wofür gebe ich Geld aus? Wie hoch sind meine Kapitalkosten? Wie wird das Budget gestaltet? Was wollen wir erreichen? Was sind die Risiken? Das schon ist alles sehr komplex. Deshalb wundere ich mich, wenn die Finanzpolitik der Bundesrepublik an einer willkürlichen Zahl ausgerichtet wird.
Soll der Staat aus Gründen der Tragfähigkeit der Schulden besser nur das Geld ausgeben, das er einnimmt?
Warum sollte er das? Kein Kiosk-Besitzer würde so handeln. Auch er muss investieren und nimmt dazu im Regelfall einen Kredit auf. Aber es gibt noch einen fundamentaleren Punkt: Staatsschulden sind etwas ganz anderes als Privatschulden. Der Kiosk-Besitzer muss schauen, dass er genug verdient, um seinen Kredit bedienen zu können. Der Staat stellt das Geld, mit dem er seinen Kredit bezahlt, selbst her, er kann nicht insolvent gehen.
Aus dem Finanzministerium heißt es: Deutschland habe kein Einnahmen-, sondern ein Ausgabenproblem. Statt über noch mehr Schulden müsse man darüber reden, wofür das viele Geld ausgegeben wird.
Selbstverständlich muss darüber geredet werden, ob der Staat das Geld sinnvoll ausgibt. Hierzulande könnten wir sicher bessere Prozesse haben, um das sicherzustellen. In anderen Ländern ist man da schon sehr viel weiter, hat zum Beispiel Institutionen außerhalb der Regierung, die einzelne Ausgaben unter die Lupe nehmen. Ausgabenqualität spielt hierzulande leider eine deutlich geringere Rolle als die absolute Verschuldungsgrenze.
Können Sie das an einem Beispiel erläutern?
Nehmen wir das geplante Intel-Werk in Magdeburg. Der Bund fördert die Fabrik mit 10 Mrd. Euro. Bei so viel Geld sollte man vorher klären, was diese Subvention tatsächlich bringt. Wie viele Arbeitsplätze entstehen? Wie hoch werden die Steuereinnahmen sein? Wie profitieren Zulieferer und andere Wirtschaftszweige? Meine Hoffnung ist immer noch, dass diese Kalkulation existiert, ich sie nur nicht kenne.
Hat Deutschland also nur ein Ausgabenproblem, und die Schuldenbremse zwingt, die richtigen Prioritäten zu setzen?
Das wird ja immer wieder behauptet. Aber der Mechanismus erschließt sich mir weder theoretisch, noch hat er in der Praxis funktioniert. Auch unter der Schuldenbremse haben die Ausgaben, hinter denen die stärksten politischen Interessen stehen, nicht die mit dem größten ökonomischen Nutzen Vorrang. Nehmen wir das Beispiel umweltschädliche Subventionen – darunter etwa das Dieselprivileg und die Pendlerpauschale. Die haben einen Umfang von 40 Mrd. Euro. Wir fördern also CO2-Emissionen mit 40 Milliarden, anstatt das Geld in die Dekarbonisierung des Verkehrs und der Autoindustrie zu stecken. Das widerspricht den Klimazielen. Doch hinter jeder einzelnen Subvention steht eine politische Kraft. Deswegen ist es auch so schwer, diese Subventionen tatsächlich zu reduzieren. Dabei hilft nicht die Schuldenbremse, sondern der direkte Blick auf die politischen Kräfteverhältnisse.
Aber sollten die rasant gestiegenen Zinsen nicht eine Warnung sein?
Man muss auf die Zinsen schauen. Aber so rasant steigen die Zinsen nicht. Die Zahlen des Bundesfinanzministeriums sehen aufgrund einer speziellen Buchungstechnik besonders hoch aus. In den vergangenen Jahren wurden viele Staatsanleihen zu einem sehr hohen Preis, dafür aber auch hohen Zinssatz verkauft. So zahlten Investoren dem Staat für eine Anleihe, die eigentlich nur 100 Euro wert war, 130 Euro und bekamen dafür einen hohen Zins. Diese 30 Euro Extra-Einnahmen werden in der Buchhaltung des Bundes komplett mit den heutigen Zinszahlungen verrechnet und lassen diese besonders niedrig aussehen – die zukünftig höheren Zinsausgaben werden dabei ignoriert. Verbucht man die Zinsen so, dass sie tatsächlich annäherungsweise die aktuellen Kosten der Staatsverschuldung wiedergeben, stiegen die Zinsen innerhalb von zwei Jahren nicht von 4 auf 40 Mrd. Euro, sondern von 21 auf 34 Milliarden.
Gehört es zur Generationsgerechtigkeit, den künftigen Generationen keinen Schuldenberg aufzutürmen?
Wie kann es generationengerecht sein, unseren Kindern marode Schulen, eine miese Infrastruktur und eine Wirtschaft, die Wachstumspotenzial verliert, zu hinterlassen? Deutschland hat das Glück sehr niedrige Zinsen auf die Staatsschuld zu zahlen. Solange wir Wachstum haben, fallen die Schulden von alleine. Ein Verlust an wirtschaftlicher Substanz ist aber sehr schwer wieder aufzuholen. Finanzpolitik ist immer mit Risiko behaftet, es ist eine Frage der Abwägung. Und aus meiner Sicht setzen wir hier zu oft die falschen Prioritäten.
Das Interview ist zuerst bei ntv.de erschienen