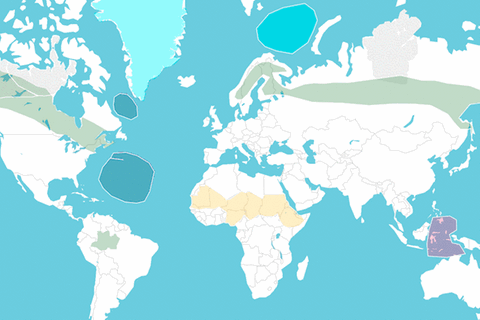Dieter Janecek ist Mitglied im Deutschen Bundestag und wirtschaftspolitischer Sprecher der Bundestagsfraktion Bündnis 90/Die Grünen
Teilen, leihen, weiterverkaufen – das ist in der Ökonomie nichts Neues. Neu ist, dass die Digitalisierung diese Formen des ökonomischen Austauschs (wieder)belebt hat und sich derzeit vielfältige Geschäftsmodelle der Share Economy entwickeln. Nutzen statt Besitzen, Ökonomie des Teilens, vermittelt über Online-Plattformen und Apps werden Privatpersonen zu Entrepreneuren. Derzeit tut sich viel in der Share Economy Szene, immer mehr Menschen beteiligen sich an der alternativen Wirtschaftsform. Doch neben der Faszination der Nutzer, lassen sich immer mehr kritische Stimmen gegenüber der wachsenden Ökonomie des Teilens wahrnehmen. So warnt Roland Tichy in seinem Artikel „KAppitalismus: App-Kapitalismus in der Share-Ökonomie“ vor dem unkontrollierten Kleinkapitalismus der Share-Ökonomie. DGB-Chef Reiner Hoffmann wiederum spricht im Interview mit dem Spiegel „Moderne Sklaverei“ die Risiken an, die die neuen Geschäftsmodelle der Share Economy für Arbeitnehmerrechte mit sich bringen. Die Debatte um den Limousinen-Service Uber oder die Zimmervermittlungsplattform Airbnb machen etablierten Taxifahrer oder Hoteliers mächtig Druck. Und so haben einige Städte-Verwaltungen ihre Dienste vorsorglich untersagt. Und die Politik auf Bundesebene? Sie schaut ratlos vom Spielfeldrand zu. Der kritische Blick auf die Share Economy ist richtig. Und wenn Missstände, wie ungleiche Marktzugangsbedingungen oder fehlende Besteuerungsregelungen bezüglich Einnahmen aus Share Economy Tätigkeiten festgestellt werden, muss selbstverständlich über eine geeignete Regulierung diskutiert werden.
Digitale Vermarktung ist keine Sharing Economy
Jedoch wird in der aktuellen Debatte wenig differenziert. Wenn Handwerker, Künstler oder Hand-Made-Produzent auf Plattformen wie DaWanda ihre Dienstleistungen und Produkte anbieten, hat das erst mal nicht viel mit der Ökonomie des Teilens zu tun. Dann nutzen sie schlicht die Möglichkeiten der Digitalisierung für Marketing und Vertrieb. Digitalisierung ermöglicht neue Formen von Klein- und Kleinstunternehmen. Nur: Produkte und Dienstleistungen digital zu vermarkten macht noch keine Share Economy. Wenn jemand einfache handwerkliche Tätigkeiten online anbietet, dann ist das auch nichts anderes als die Kleinanzeige in den Gelben Seiten oder der Abrisszettel am Laternenmast – höchstens schneller, praktischer, billiger – digital eben. Prinzipiell tendiere ich dazu, solche neuen Geschäftsmodelle als Erweiterung, als Bereicherung unserer bisherigen Wirtschaft zu begreifen. Inwieweit die Digitalisierung die Gründung von Klein(st)unternehmen vorantreibt, darüber lohnt die Diskussion mit Sicherheit. Und auch darüber, was das für Sozial-, Arbeitsmarkt- und Qualitätsstandards bedeutet.
Worum geht es bei Share Economy?
Der Nutzen der Share Economy lässt sich am Beispiel Auto am besten darstellen. Rund 30 Minuten am Tag wird ein Pkw in Deutschland am Tag bewegt, viele Stadtbewohner nutzen ihr Fahrzeug nur ein bis zweimal Mal die Woche. Die restliche Zeit braucht ein Auto einfach viel Platz, der oft einfach nicht da ist oder viel zu wertvoll ist. Statt Parkplätzen lassen sich kleine Parks schaffen, Spielplätze, vielleicht auch Wohnraum – auf jeden Fall lässt sich der Raum sinnvoller nutzen. In München beispielsweise stehen rund 800.000 Fahrzeuge größtenteils nur so rum – bei 1,4 Millionen Einwohner. Ökologisch wie ökonomisch sinnlos! Carsharing, möglichst unkompliziert via Smartphone, ist da die deutlich bessere Option.
Aber wie sieht’s mit dem Rebound-Effekt aus? Steigen Rad- und ÖPNV-Nutzer vielleicht doch gelegentlich aufs Auto um, wenn man nicht für teures Geld selbst eines kaufen muss, sondern auch für den kleinen Geldbeutel und problemlos via App ausleihen kann. Ja, das wird vorkommen. Trotzdem überwiegt bei weitem der ökologische Nutzen, wenn sich die Zahl der Pkw-Stellplätze durch Carsharing reduzieren und anders nutzen lässt. Bei den jungen Menschen lässt sich bereits heute gut erkennen, dass es ihnen nicht um den Besitz eines Autos geht, sondern um die Möglichkeit der Mobilität. Und so werden insgesamt weniger Autos im Individual-Verkauf nachgefragt und damit Ressourcen bei der Produktion eingespart. Um die genauen Effekte hier noch besser zu verstehen, braucht es Forschung, die diese untersucht.
Share Economy – ein Bereich voller Innovationen
Share Economy, wesentlich vorangetrieben durch die Digitalisierung, ermöglicht ressourcenschonende Lebensentwürfe, nachhaltige Mobilität, lässt neue Einstellung zu Konsumgütern entstehen, die anstatt auf dem Müll bei einer neuen Nutzung landen. Share Economy ist aber sicher nicht das Ende des Kapitalismus und neben klar ökologisch und/oder sozial motivierten Ansätzen gibt es natürlich auch vorrangig oder ausschließlich profit-orientierte Modelle. Ist das negativ zu bewerten? Kommt darauf an, wie man allgemein zur Marktwirtschaft steht. Ich sage: Die Entrepreneure der Ökonomie des Teilens sprühen vor Tatendrang und neuen Ideen. Dass Teile von ihnen und ihre Anwender auch finanzielle Anreize antreiben, sollte in einer Marktwirtschaft erst mal nicht verwerflich sein. Ich sehe auch in gewinnorientierten Geschäftsmodellen zunächst eine Erweiterung und Bereicherung unserer bisherigen Wirtschaft, auch als Raum für neue Gründer. Die Unterkunftsplattform Airbnb konnte doch nur und gerade wegen ihrer innovativen Lösungen für moderne Kundenwünsche in so kurzer Zeit so erfolgreich sein. Sicherlich schätzen die Nutzer auch die attraktiven Preise für eine Unterkunft bei einer Privatperson, ein entscheidender Mehrwert liegt aber doch auch in den persönlichen Kontakten vor Ort. Kunden schätzen die individuelle Einrichtung, professionelle Fotos der Unterkunft und eine benutzerfreundliche Website mit Umgebungskarte und Bewertungen des Gastgebers. Und zu Uber: Sicher müssen wir genau hinsehen, was der Limousinen-Dienst macht und welche Auswirkungen das auf das lokale Taxi-Gewerbe hat. Man kann aber auch kreativ auf die Herausforderung reagieren. So hat Taxi Stockholm auf Uber nicht mit Verbotsforderungen, sondern mit Innovationen und einer neuen, kundenorientierten Strategie reagiert. Und wer hindert eigentliche Städte und Regionen daran, im Verbund mit lokalen Hoteliers, mit eigenen Apps, die von Privatwohnungen bis Luxushotels alles anbieten, was Reisende interessieren könnte, in den Wettbewerb zu Airbnb zu treten?
Raum für Experimente lassen
Dem Wandel in unserer Wirtschaft durch Digitalisierung – ob durch Industrie 4.0, Share Economy und wachsende digitalisierte Dienstleistungsangebote – können wir uns nicht verschließen. Wo genau das hinführt, wissen wir heute nicht. Wir können darin aber zumindest zukünftige Marktfelder sehen und als Wirtschaftsstandort eine aktive Rolle als Akteur dabei spielen. Die Stadt Seoul zum Beispiel hat die vielfältigen Vorteile durch Share-Modelle erkannt und ihr Bürgermeister hat seine Stadt zur Sharing City erklärt und fördert entsprechende Strukturen. Sicherlich müssen wir bei digitalen Geschäftsmodellen und Share Economy auch eine Debatte regulatorischer Fragen, von Arbeitnehmerrechten bis zur Gewährleistung führen. Wir müssen die weitere Entwicklung beobachten und wo notwendig, auch regulieren. Jedoch sollten die Potenziale der Ökonomie des Teilens keinesfalls durch vorschnelle Reglementierung unerschöpft bleiben. Ich plädiere dafür den Mut und die Neugierde zu haben, der Ökonomie des Teilens Entwicklungsraum zu geben. Jedenfalls sollte ihre Innovationskraft nicht vorschnell – getrieben von der Angst vor Neuem – im Keim erstickt werden.