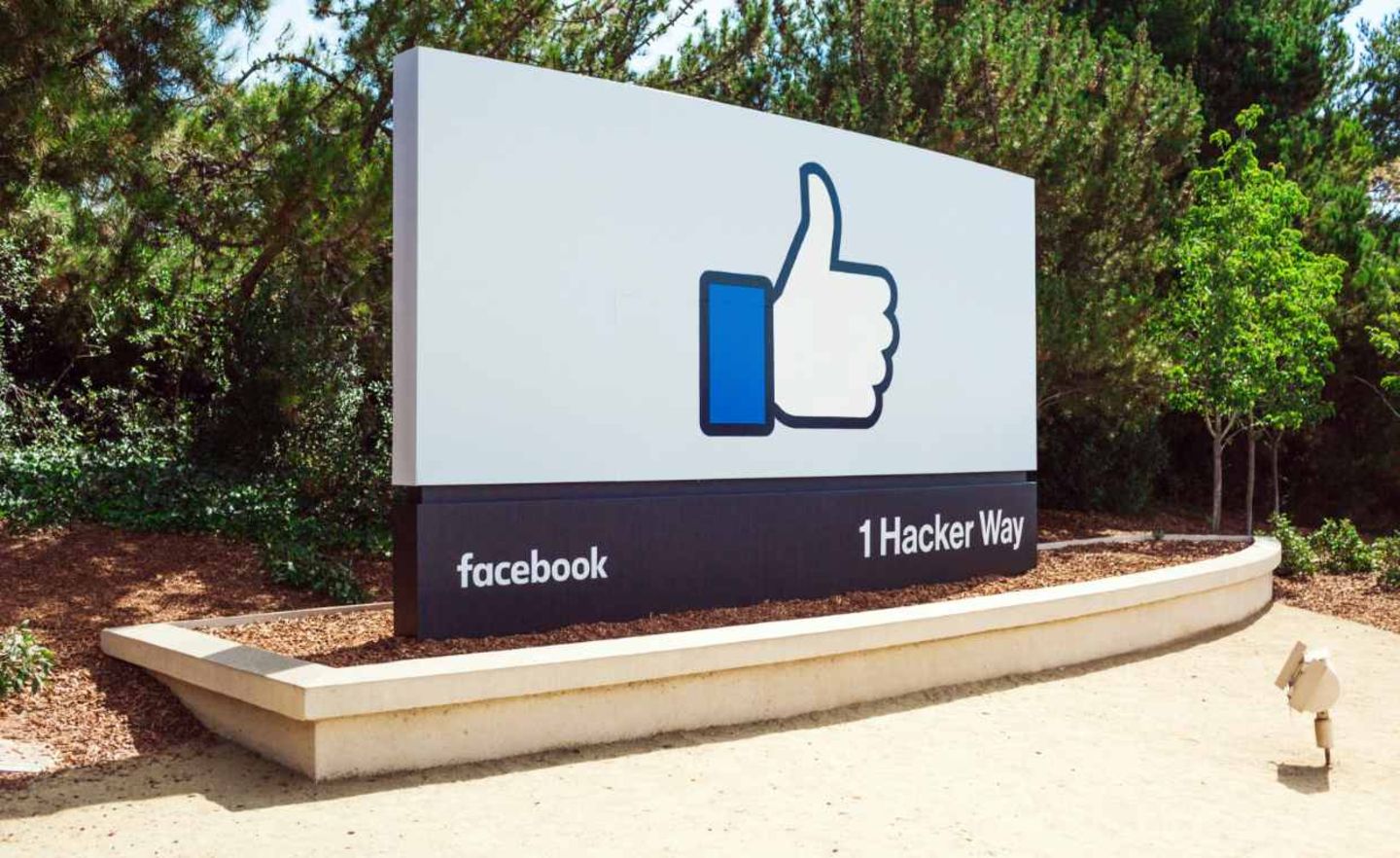Mehr als vier Wochen ist die Ankündigung nun her. Nie in der Geschichte des Finanzwesens hat eine technologische Innovation so viele Reaktionen und Aktivitäten ausgelöst wie die Vorstellung des Konzeptes zur Einführung des neuen Kryptozahlungsmittels Libra am 18. Juni 2019. Das umfassende und auch in deutscher Sprache veröffentlichte Whitepaper mit zahlreichen ergänzenden Dokumenten hat nicht nur das Potenzial das klassische Banking sowie die aufstrebende Fintech-Start-up-Szene zu verändern, sondern droht, so befürchten Skeptiker, auch die Souveränität von Staatswährungen zu untergraben. Ob es aber überhaupt so weit kommt, bleibt vorerst ungewiss.
Libra Association stellt die technologische Basis bereit
Auf Initiative von Facebook will ein Konsortium aus zur Zeit 28 Unternehmen (es sollen bis zu 100 Teilnehmer werden) über die in Genf ansässige Libra Association die Basis für einen durch Vermögenswerte unterlegten kryptografisch gesicherten Token schaffen. Mit einer Blockchain-Infrastruktur soll weltweit schnell, einfach und kostengünstig bezahlt werden können. Der digitale Token repräsentiert hier einen Anteil an einem Fonds (ähnlich einem übrigens nicht risikolosen Geldmarktfonds) mit in verschiedenen Währungen hinterlegten Bankguthaben und Finanzanlagen. Dies soll starke und von anderen Kryptoassets bekannte Preisschwankungen reduzieren .
Technisch realisiert wird der digitale Token mithilfe einer Variante der Distributed-Ledger- Technologie (DLT), konkret mit einer „ permissioned Blockchain ”, bei der nur zugelassene Teilnehmer Transaktionen verifizieren. Vertraut man der Institution, die die Transaktionen verifiziert, dann können so Rechte über materielle und immaterielle Güter manipulations- sicher dezentral und digital dokumentiert und mithilfe kryptografischer Verfahren vor Fälschung und Duplizierung geschützt werden. DLT und Blockchain dienen damit als ein digitales Vertrauensprotokoll, das freilich nur dann funktioniert, wenn insbesondere bestimmte Hard- und Software fehlerfrei zusammenarbeitet, eine Internetverbindung besteht und Strom vorhanden ist.
Einladung an Dritte für neue Angebote
Dritte werden ausdrücklich eingeladen , auf Basis der Infrastruktur eigene Wallets anzubieten und Dienstleistungen zu entwickeln. Dafür wird eine eigene Programmiersprache bereitgestellt, die auch Smart Contracts ermöglicht. Smart Contracts gelten als in Computerprogramme umgesetzte Verträge, mit denen Daten aus verschiedenen Informationsquellen überwacht und ausgewertet werden. Sind zuvor festgelegte Bedingungen erfüllt, führt der Softwarecode des Smart Contracts selbstständig einen Befehl aus, wie etwa die Anweisung einer Zahlung oder die Übertragung von Verfügungsrechten.
Facebook selbst entwickelt über das Tochterunternehmen Calibra eine eigene Wallet, also eine Art digitales Portemonnaie, um Zahlungen zu empfangen, aufzubewahren, zu versenden und umzutauschen. Solche Wallets können in andere Anwendungen ( third-party apps ) integriert werden. So lassen sich etwa aus dem beliebten Kommunikationsprogramm WhatsApp heraus Zahlungen auslösen, empfangen und speichern. Ebenso könnte beispielsweise aus einer App zum Ausleihen (neudeutsch Sharing) von E-Scootern oder Autos heraus mit Libra bezahlt werden. Das könnte die vielen heute an Bezahlprozessen beteiligten Unternehmen wie Kartengesellschaften, Paymentservicegesellschaften, Acquirer, Banken und mehr deutlich reduzieren und neue Formen des Risikomanagements und der automatisierten Gestaltung von Verträgen ermöglichen.
Manche erwarten daher ein neues Ökosystem aus Bezahlverfahren und rechtssicherer in dem sich künftig immer mehr Finanzdienstleistungen wiederfinden ( WeChat aus Asien lässt grüßen). Dazu könnten neben verschiedenen Formen der Zahlungsabwicklung auch die Geldanlage und die Aufnahme von Krediten gehören.
Regulatoren bremsen Libra
Selten zuvor haben in so kurzer Zeit so viele Politiker, Notenbanker und Aufseher ausführlich Stellung zu einer technologischen Ankündigung genommen (eine Auswahl findet sich hier und hier im Handelsblatt sowie hier im BitcoinBlog ). Das dürfte nicht nur an den sehr bekannten Partnern der Libra Association (darunter Paypal, Mastercard, Visa, Spotify, Uber und Booking) liegen. Manche wie zum Beispiel der Bankenverband befürchten, Libra könne die Souveränität einzelner nationaler Währungen bzw. der Euro-Geldpolitik untergraben.
Das Bundesfinanzministerium soll gar ein Risiko für die staatliche Hoheitsgewalt sehen. US-Demokraten wollen gar große Technologie-Konzerne ganz davon abhalten, Finanzdienstleistungen anzubieten.
Wenn massiv inländischen Zahlungen und Einlagen zu Libra abwandern und sogar Kredite in dem digitalen Token aufgenommen werden können, kann ein dadurch entstehendes Finanz-Ökosystem auf Libra-Basis nicht nur die Geschäftsmodelle und Planungen der Banken verändern, sondern auch viele Fintech-Start-ups und Blockchain-Initiativen bedrohen. Manche hoffen daher, Regulatoren oder Gesetzgeber würden diesen neuen Finanzkreislauf verhindern oder zumindest beschränken. Offen ist ebenfalls wie im Detail die hohen Regulierungsstandards in Bezug auf Geldwäsche, KYC (know your customer) und gegebenenfalls Einlagen- und Wertpapierregulierung erfüllt werden.
Facebook möchte die bestehende Finanzmarktregulierung nicht umgehen, stellte David Marcus, Chef der Payment und Blockchainaktivitäten von Facebook, vor dem US-Senat Mitte Juli fest. Allerdings musste Marcus auch in der Befragung einräumen, dass man noch nicht wisse, welche der vielen Vorgaben zahlreicher nationaler und internationaler Behörden einzuhalten seien. Es habe aber bereits erste Gespräche mit Aufsichtsbehörden in verschiedenen Ländern gegeben. Möglich ist aber, dass Facebook und die anderen Unternehmen die Wucht der staatlichen und sich derzeit in den USA, Europa und Asien formierenden Bedenken unterschätzt hat. Die rechtlichen Beschränkungen haben zum Beispiel in Indien dazu geführt, dass Libra dort vorerst nicht verwendet werden kann.
Libra macht ein Dilemma der internationalen Finanzordnung sichtbar. Weltweit gelten für Finanzdienstleistungen sehr unterschiedliche Vorgaben. Anforderungen formulieren vor allem Staaten aus Europa, Nordamerika und den weiteren G20-Mitgliedern. Sollten für Libra bzw. die darauf aufbauenden Leistungen hunderte verschiedene nationale und internationale Vorschriften gelten, dürfte dies die schnelle Ausbreitung erheblich bremsen. Hilfreich wäre, wie von Joachim Wuermeling, Mitglied im Vorstand der Deutschen Bundesbank, gefordert "eine globale Antwort auf die Pläne von Facebook". Es dürfte freilich Jahre dauern bis sich die etwa 160 über eine Währung verfügenden Länder bzw. Währungsräume auf eine Sichtweise verständigt haben. Die nationalen Regulierungsregimes sind bisher nicht auf weltweite unbeschränkte Finanztransaktion nach einheitlichen Standards und Kryptozahlungsmittel ausgerichtet.
Zu hohe Erwartungen?
Während sich die Fachdiskussionen auf Risiken und Regulierungsfragen konzentrieren, wird kaum gefragt, ob die hohen Erwartungen an künftigen Nutzerzahlen gerechtfertigt sind. Für europäische Kunden löst das Libra-Netzwerk zunächst keine wirklichen Probleme. Allerdings haben das Banken einst auch von PayPal gesagt. Mindestens eine Ausnahme sind aber die hohen Kosten der Zahlungsabwicklung für Remittance Payment, also Zahlungen von hier lebenden Menschen an Personen außerhalb der westlichen Industriestaaten. Allerdings erfordert der erfolgreiche Einsatz, dass erhaltenen Zahlungen zu fairen Kursen in die Heimatwährung umgetauscht werden können oder in den Empfängerländern eine Zahlungsinfrastruktur entsteht, die es erlaubt, mit Libra zu zahlen. Mit MPesa existiert dazu bereits eine entsprechende Blaupause in einigen afrikanischen und asiatischen Ländern. Hier ermöglichen als M-Pesa-Agents bezeichnete Händler die Ein- und Auszahlung von Bargeld. Für Libra wäre das noch aufzubauen.
Facebook hat aus früheren Versuchen, digitale Zahlungsmittel zu installieren ( 2010 und 2015 ), gelernt, dass man nicht allein die Finanzwelt herausfordern kann. Dass über Messengerdienste wie WhatApp eines Tages auch Zahlungen geleistet werden können, überrascht nicht (siehe Kolumnen aus 2014 und 2016 ). Facebook will aber den Einsatz von Drittwallets laut der Senatsanhörung nicht erlauben, so dass Banken und andere Dienstleister diese Kanäle nicht nutzen können, wenn nicht zum Beispiel das europäische Wettbewerbsrecht sie dazu zwingt.
Heute ist trotz der Vorschusslorbeeren längst noch nicht klar, ob Libra ein globaler Erfolg wird und das Netzwerk robust genug sein wird. Aber mit Libra verlassen die Kryptozahlungsmittel endgültig ihre nerdige Nische. Banken, Finanzaufsichtsbehörden und Gesetzgeber sehen Kryptoassets und digitales Geld nicht länger als akademisches Experiment oder als Instrument für Spekulanten . Es wäre außerdem überraschend, wenn andere BigTechs wie Google, Amazon oder Apple das Feld allein dem Libra-Konsortium überlassen. Möglich, dass andere Kryptozahlungsmittel in den Wettbewerb eintreten und ebenso Notenbanken mit eigenen Token mitmischen.
In jedem Fall wird die Technologie für Tokenization von Zahlungsmitteln, Gegenständen und Wertpapieren durch das Libra-Projekt, selbst wenn es ausgebremst wird, erheblich beschleunigt.