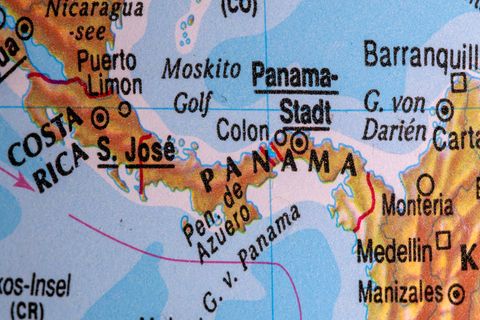Im Rhein herrscht Niedrigwasser – in Emmerich wurde am Montag ein historischer Tiefststand von null Zentimetern gemessen. Wie außergewöhnlich ist die Lage derzeit?
Das ist schon eine außergewöhnliche Situation. In den vergangenen Jahren gab es immer wieder Niedrigwasser in unseren Flüssen, wie Rhein und Elbe. 2018 wurden an vielen Flüssen die Niedrigwasser-Rekordwerte unterschritten. 2019 war es auch relativ trocken und jetzt 2022 wieder; dass das jetzt in dieser Häufigkeit vorkommt, ist schon ungewöhnlich. Man darf nicht vergessen: Wir befinden uns noch früh im Jahr. Der Spätsommer, in dem es gewöhnlich wenig regnet, kommt erst noch.
Ein niedriger Pegelstand wie dieser löst eine regelrechte Kettenreaktion aus. Welche Folgen hat das Niedrigwasser?
So ein Niedrigwasser betrifft verschiedene Bereiche. Zum einen ist da die Schifffahrt: Es kann nicht mehr so viel Ladung pro Schiff transportiert werden, Lieferketten werden unterbrochen. Das Timing ist natürlich ungünstig, jetzt wo auch Stein- und Braunkohle wieder verstärkt gebraucht werden. Auch Wasserkraftanlagen müssen eventuell abgeschaltet werden, weil nicht mehr genug Wasser durch die Turbinen fließen kann. In Frankreich sehen wir auch, dass es zum Problem werden kann, wenn Kühlwasser für Atomkraftwerke fehlt. Außerdem entnehmen viele Industrien Wasser aus den Flüssen, auch das ist nun unter Umständen nur noch eingeschränkt möglich. Und dann gibt es natürlich noch viele weitere Faktoren: Das ganze Ökosystem leidet darunter, ebenso wie der Tourismus und die Fischerei.
Für Hochwasser gibt es Frühwarnsysteme. Gibt es so etwas auch für Niedrigwasser?
Möglich wäre das sicherlich. Die Frage ist, ob man eine Art Frühwarnsystem braucht, denn Niedrigwasser ist ein eher schleichender Vorgang im Gegensatz zum Hochwasser, das – im Vergleich – dann doch „plötzlich“ kommt. Beim Hochwasser sieht man sofort und unmittelbar die Zerstörung. Vom Niedrigwasser bekommen die Menschen in ihrem Alltag erst einmal weniger mit. Im Falle von Hochwasser braucht man sofort Einsatzbereitschaft. Ein Hochwasser geht schneller vorbei als Niedrigwasser, das mehrere Monate andauern kann. Rein hydrologisch gesehen spürt man ein Hochwasser ein Jahr später nicht mehr – Niedrigwasser kann noch lange danach Auswirkungen haben, wenn das Flussbett schon wieder voll ist.
Welche sind das?
Niedrigwasser zehrt an den Grundwasserständen. In Sachsen-Anhalt zum Beispiel sind die Grundwasserstände in den letzten vier Jahren zwischen 60 Zentimeter und einem Meter zurückgegangen. Und das betrifft nicht nur die Flüsse, sondern die gesamte Fläche. Wenn diese großen Grundwasserspeicher voll sind, dann kann man auch ein trockenes Jahr überstehen, wenn sie im nächsten Jahr wieder aufgefüllt werden. Aber jetzt gab es viele trockene Jahre.
Die Auswirkungen des Niedrigwassers werden also gravierender umso häufiger wir es hintereinander erleben?
Ja, absolut. Die natürlichen (Grundwasser-)Speicher, aber auch die technischen Reservoirs wie die großen Talsperren werden nicht mehr voll, wenn es lange trocken ist. Das ist natürlich ein Problem. Bei den Talsperren, die ja oft auch Aufgaben im Hochwasserschutz haben, kommt noch ein Interessenskonflikt hinzu: Halten wir die Talsperren voll, kann im Hochwasserfall nicht viel zurückgehalten werden – sind sie weniger gefüllt, können wir Niedrigwasserphasen schlechter überbrücken.
Sie haben erwähnt, dass man aus dem Umgang mit dem Hochwasser einiges für den Umgang mit Niedrigwasser lernen kann. Was genau?
Daran forschen wir gerade im Rahmen unseres Forschungsprojektes DryRivers gefördert durch das Bundesministerium für Bildung und Forschung im Rahmen der Fördermaßnahme WaX – Wasser-Extremereignisse. Es geht darum, das Risikomanagement, das es für den Umgang mit Hochwasser schon gibt, auf Niedrigwasser zu übertragen. Im Grunde geht es darum, im Risikomanagement die Wahrscheinlichkeiten von Niedrigwasserereignissen in Kombination mit den daraus folgenden Schäden umfassend zu berücksichtigen, auch die für Ökologie und Freizeit.
Was kann man tun, um diese Schäden des Niedrigwassers zu mindern?
Zum einen geht es um Speicherung. Talsperren haben eine Art Reserve-Raum, der einen gewissen Abfluss für die Gewässer vorhält. Man kann auch versuchen, das Schwamm-Stadt-Konzept zu nutzen. Hier könnte man bei Starkregen Wasser speichern und es bei Niedrigwasser-Episoden nutzen. Das wird aber noch erforscht. Zum zweiten können bauliche Maßnahmen im Gewässer Niedrigwasserschäden vermindern: Fahrrinnen in größeren Gewässern für die Schifffahrt oder Niedrigwasserrinnen in kleineren Gewässern für die Ökologie sind Beispiele. Zum dritten könnte man auf industrieller und privater Verbraucherseite ansetzen: Wasser sparen oder auch, dass zeitweise beschränkt wird, wie viel Wasser entnommen werden darf, wäre möglich.
Der Bundesverband der Binnenschifffahrt fordert, kritische Stellen in der Fahrrinne zu vertiefen. Halten Sie diese Maßnahme für sinnvoll?
Ich denke, beim Rhein wäre das durchaus sinnvoll. Der Rhein ist viel genutzt und mit seinen Verbindungen zu den großen Seehäfen und Industrieregionen eine wichtige Verkehrsader für die Binnenschifffahrt. Es geht dabei ja nur um wenige Stellen im Verlauf des Rheins.
Müssen wir künftig häufiger mit Niedrigwasser rechnen?
Wir befinden uns in der Klimaanpassung. Ich bin sehr dafür, dass wir alles tun, um die Klimaziele einzuhalten. Aber wir müssen uns auch damit beschäftigen, wie wir mit den Folgen des Klimawandels, die wir jetzt gerade erfahren, umgehen. Da gibt es das Hochwasser, aber eben auch das Niedrigwasser.
Wie lang dauert eine Niedrigwasser-Phase wie die derzeitige im Rhein in der Regel an?
Das kann dauern. Damit die endet, muss es viel regnen, und zwar anhaltend. Da reichen ein paar Gewitter, die über das Land ziehen, nicht. Die Flusspegel steigen dann aber auch relativ schnell wieder an. Um die Grundwasserstände wiederaufzufüllen, bräuchten wir noch einen verregneten Herbst und Winter und auch das würde wahrscheinlich noch nicht reichen. Das werden wir noch Jahre lang spüren – wenn wir die Grundwasserspeicher überhaupt wieder aufgefüllt bekommen.
Woran werden wir merken, dass die Grundwasserstände niedrig sind?
Im Extremfall könnte die Entnahme von Grundwasser eingeschränkt werden, was dann zum Beispiel die Bewässerung des heimischen Gartens beträfe. Auch die Landwirtschaft könnte der Wassermangel treffen. Ich will nicht den Teufel an die Wand malen: Wir werden in Deutschland wohl kein Trinkwasser-Problem bekommen. Aber es kann sicherlich in anderen Bereichen zu Einschränkungen kommen.