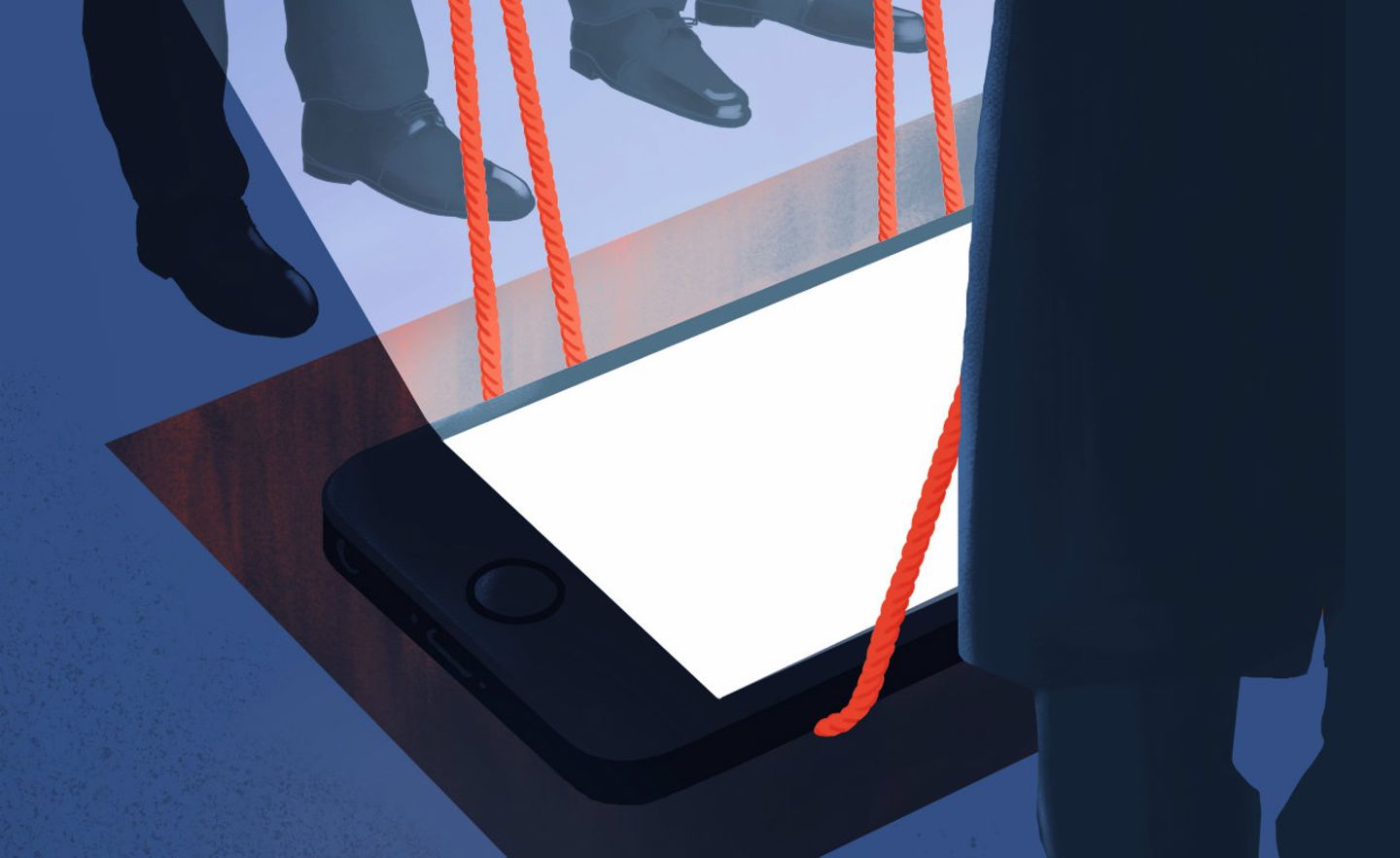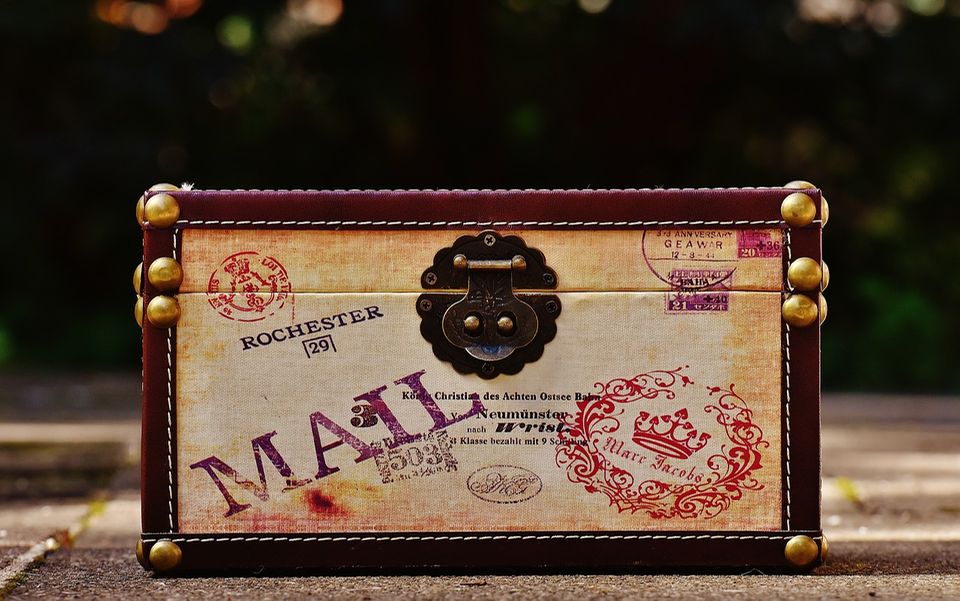Die Nachricht vom Tod ihres Bruders hatte Andrea S. im Urlaub erreicht. Nun stand sie in der leeren Wohnung und musste sehen, wie sie sein Leben aufräumt. Einige alte Unterlagen des kinderlosen Mannes waren noch abgeheftet. Es fand sich ein Geldbeutel mit EC- und Kreditkarten. Ein Großteil wichtiger Informationen aber war nicht zugänglich – und zwar alles, was sich hinter Passwortschranken auf PC und Smartphones befand. Der digitale Nachlass. „Alles lief sehr chaotisch und extrem aufwendig“, sagt die 55-Jährige. „Es ist einfach großer Mist, wenn du nicht an den Computer kommst.“
Erben, die Einblick in die E-Mails oder Onlineprofile Verstorbener suchen, stoßen auf hohe Hürden der Betreiber. Denn Erbrecht und Fernmeldegeheimnis kollidieren. Die Mutter einer verstorbenen 15-Jährigen hat gerade bis zum Bundesgerichtshof geklagt. Die Richter haben entschieden, dass Hinterbliebene auf das Facebook-Konto zugreifen dürfen. Facebook hatte das Nutzerkonto gesperrt und in den Gedenkzustand versetzt. Das Gericht entschied, dass digitale Inhalte genauso zu behandeln seien wie etwa Briefe und Tagebücher.
Dringend werden für den digitalen Nachlass ein Richtungsentscheid und neue Gesetze gefordert. Die Digitalisierung hat unsere Kommunikation revolutioniert. Sie fordert das 100 Jahre alte Erbrecht heraus. Zugriffsrechte auf E-Mail-Konten, soziale Netzwerke, Dating- und Streamingdienste? Das alles regelt kein Gesetz, sondern ein Wirrwarr aus geheimen Passwörtern und seitenlangen AGB. Wie sorglos 62 Millionen Internetnutzer in Deutschland mit ihrem digitalen Fußabdruck umgehen, zeigt diese Zahl: Acht von zehn haben sich noch nie Gedanken gemacht, wie sie mit dem virtuellen Erbe verfahren.
Ein "digitales Testament" fürs Schließfach
Für Andrea S. begann eine mühsame Spurensuche. Es war Glück, dass ihr Bruder und die Eltern Kunden in derselben Sparkassenfiliale waren. Bei den Steuern konnte sie ein gemeinsamer Freund beraten. Sie durchflöhte Kontoauszüge, kündigte Online-Abos, fand Kunden des kleinen Einmannbetriebs. Die Website des Bruders existiert noch. Nicht jeder aber findet bei der Auflösung eines digitalen Nachlasses sofort Unterstützung.
Vorausblickend lässt sich jedoch für einzelne Kommunikationskanäle durchaus Vorsorge treffen. Grundsätzlich gilt: Um den Aufwand zu minimieren, hinterlegt man handschriftlich ein „digitales Testament“ mit der Liste aller Konten. Die Passwörter werden schriftlich oder auf einem Speichermedium in einem Schließfach hinterlegt, zu dem die Erben Zugang bekommen. Worauf ist sonst noch zu achten?
I. POSTFÄCHER
Die elektronische Nachricht hat in der Privatsphäre den klassischen Brief weitgehend verdrängt. E-Mail-Accounts bergen heute oft unentbehrliche Informationen zu den privaten und geschäftlichen Aktivitäten einer Person. Hinterbliebene oder Nachlassverwalter finden dort die wichtigsten Hinweise zu allen vertraglichen Bindungen, die ein Erbe übernimmt. Hier lässt sich rekonstruieren, welche Geldanlagen zu betreuen sind, wo Mitgliedschaften laufen oder ob Rechnungen fällig sind. Offene Postfächer erleichtern es ungemein, Passwörter für andere Zugänge zurückzusetzen.
Problematisch: Können E-Mails überhaupt vererbt werden? Selbst mit Kennwort darf ein Erbe streng genommen ein Postfach nicht einfach übernehmen. Mail-Verkehr ist nach heutiger Rechtslage vom Fernmeldegeheimnis geschützt. Ohne Einwilligung des Erblassers und seiner Kommunikationspartner dürfen Anbieter Inhalte nicht preisgeben. Allein die Vorstellung, die Erlaubnis aller Mail-Parteien einzuholen, ist indes absurd. Im Schnitt sammelte 2017 jeder Nutzer 9 400 Nachrichten an.
Fraglich auch: Sind Yahoo oder Google Fernmeldedienste? „Der Gesetzgeber muss klarstel- len, dass ein Provider den digitalen Nachlass an die Erben herausgeben darf“, fordert der Deutsche Anwaltverein. Der Schutz des Erbes solle vorgehen – also das Recht auf digitale Inhalte, in welcher Form auch immer. Das Argument: Ein Mail-Wechsel ist ausgetauscht wie ein Brief, der im Postkasten liegt. Er befindet sich somit nicht mehr in Übermittlung. Im Alltag ermöglichen viele Anbieter den Zugriff, sobald ein Erbschein vorliegt. Um den zu erhalten, muss das Erbe angetreten sein – was ohne Kenntnis der Finanzlage Risiken birgt.
Was tun? Vorsorge zu treffen ist gar nicht so einfach. Eine Nachlassregelung sucht man bei den meisten Providern vergebens. Allein Google geht beispielhaft voran: In einem „Inactive Account Manager“ kann ein Inhaber Dritten das Zugriffsrecht auf sein Gmail- oder Youtube-Konto gewähren. „Es gibt ein großes Missbrauchspotenzial“, sagt Annegret König, Leiterin der Rechtsabteilung bei Google Germany. Aber so wolle man eine vernünftige Nachlass- pflege ermöglichen. „Online-Willenserklärungen müssen auf Websites ermöglicht werden.“
Web.de und GMX, bei denen jeder zweite Deutsche sein Hauptpostfach hat, leiten im Trauerfall nur zum Kundendienst weiter. Yahoo hält den Antrag zum Löschen bereit. Bei Microsoft „scheint der Tod eines Kontoinhabers nicht vorgesehen“, klagt eine verzweifelte Angehörige in der Community. Ein „Nächster-Angehöriger-Prozess“ verlangt eine förmlich zugestellte „gültige Vorladung“ oder „gerichtliche Verfügung“, um zu prüfen, ob Infor- mationen zu Adressen eines Verstorbenen auf MSN-Konten „rechtmäßig freigegeben werden dürfen“. Bestenfalls werden Daten von Mail und One Drive per DVD verschickt.
II. GELDGESCHÄFTE
Ihre Finanzen erledigen heute sechs von zehn Deutschen weitgehend am Rechner. Selbst bei Über- 65-Jährigen sind es 28 Prozent. Die Zahl der Online-Girokonten hat sich seit 2007 auf 62,8 Millionen fast verdoppelt. Jeder Zehnte verwaltet das Wertpapierdepot über Websites von Banken und Onlinebrokern. Kontoauszüge in Aktenordnern mit der Aufschrift „Bank“ sind passé – modern gestapelt wird im PC. Was dort sonst noch schlummert, ist nur zu erahnen: eine Prepaidkarte zum Onlinepoker? Ein Guthaben bei Paypal? Schon vier von zehn Konsumenten verwenden im Handel Internetbezahlverfahren.
Problematisch: Kaum ein Angehöriger weiß, wo der Verstorbene versprengt Internetkonten unterhält – noch kennt er die Passwörter, die sie schützen. Verbraucherschützer haben erfragt, dass 57 Prozent der Deutschen Kennwörter ausschließlich im Gedächtnis speichern. Gerade in volatilen Börsenzeiten möchte ein Erbe aber schnell handeln können, und sei es, um Dauer- und Last- schriftaufträge zu stoppen. Besser stehen die Chancen, dass die Num- mer des Schweizer Kontos oder der 50-stellige Code zur Bitcoin-Wallet notiert sind.
Was tun? Die gute Nachricht: Auch bei digitaler Verwaltung gelten für Vermögenswerte bei Finanzinstituten einheitliche Regeln. Der Erbe muss sich mindestens mit Sterbeurkunde und maximal mit Erbschein legitimieren. Bei bekannten Bankverbindungen reicht für den Nachweis des Erbrechts in der Regel ein Erbvertrag oder die Kopie des notariellen oder privatschriftlichen Testaments. Vermutet ein Erbe verborgene Konten oder Schließfächer, hilft nur eine Dreifachanfrage an die Bundesverbände von Banken, Sparkassen und Volks- und Raiffeisenbanken. Sollen Onlinekonten, egal wo, erst gar nicht herrenlos werden, empfiehlt sich, einer Person des Vertrauens zu Lebzeiten eine detaillierte analoge Vollmacht auszustellen.
III. ONLINE-VERTRÄGE
In welchem Maß unser Konsumverhalten digitalisiert ist, dafür ist die schiere Menge verschickter E-Mails ein gutes Indiz. 2017 waren es hierzulande 771 Milliarden, ein Großteil davon Newsletter im E-Commerce. Immer mehr Verträge werden online abgeschlossen. Sie gehören wie Festplatten, Speicherkarten und USB-Sticks zum Erbe. Umso wichtiger, rasch den Überblick zu gewinnen, wo Kosten auf einen zukommen.
Problematisch: Mit dem Eintritt in alle Rechte und Pflichten des Erblassers übernimmt ein Erbe auch alle Vertragsbeziehungen. Er muss Bestellungen auffinden und bezahlen, sonst meldet sich die Inkassofirma. Verkaufsauktionen müssen gestoppt, Reisebuchungen stor- niert werden. Kostenpflichtige Audio- und TV-Streamingdienste, Premium-Mailaccounts, Software-Abos oder Datingportale sind zu kündigen. Solche Nutzerverträge enden nicht mit dem Tod, sondern bleiben bestehen. Da kann einiges zusammenkommen.
Aber: Was etwa an Musik und Videos in virtuellen Speichern liegt, geht nicht automatisch an den Erben über. So nutzen Apple-Music- oder iTunes-Kunden standardmäßig die iCloud-Bibliothek, sobald sie Mitglied werden. Die Nutzerrechte erlöschen laut AGB aber mit dem Tod. Auch das Nutzerkonto, die Apple-ID, gilt eigentlich als nicht übertragbar.
Was tun? In der Regel besteht für Verträge im Todesfall ein Sonderkündigungsrecht. Sind die Zugangsdaten hinterlegt, funktioniert das Abwickeln von Online-Abos – meist mittels einer Sterbeurkunde – ohne großen Aufwand. Amazon und Ebay etwa nehmen sie per Fax oder postalisch unter Angabe der E-Mail- Adresse des Verstorbenen entgegen.
Wer über eine Apple-ID Musik oder Fotos aus der Cloud sichern möchte, kann das tun, solange er über die Login-Daten verfügt. Tatsächlich lassen sich in der Kontoverwaltung sogar Name und Adresse des Nutzers ändern – eine De-facto-Übertragung, die der Hinterbliebene auch ohne Zugangsdaten beantragen kann. Apple prüft dafür die Sterbeurkunde und ein Dokument des Nachlassgerichts, das den Erben und dessen Verbindung zum Verstorbenen zeigt, in der Regel den Erbschein.
IV. BERUFSNETZWERKE
Schätzungen zufolge sind fünf Prozent aller Profile in sozialen Netzwerken Toten zuzuordnen. Das schließt Businessnetzwerke wie Xing mit zwölf Millionen registrierten Nutzern und das zu Microsoft gehörende LinkedIn mit zehn Millionen Mitgliedern im deutschsprachigen Raum ein. Wie viele der zwölf Millionen Twitter-Nutzer pro Monat beruflich posten, ist nicht bekannt.
Problematisch: Auch Karrierenetzwerke verschicken Hinweise auf Personen, die man kennen könnte oder denen man zum Dienstjubiläum und Geburtstag gratulieren möchte. Es kann also mindestens irritieren, wenn die digitale Visitenkarte weiter herumgereicht wird. Aber Vorsicht bei der Abmeldung: Ein Angehöriger, der sich mit dem Passwort des Verstorbenen einloggt, riskiert eine Strafanzeige, wenn er auf dessen Daten zugreift. Nach den Nutzungsbestimmungen sind wie bei E-Mails die Interessen von Kommunikationspartnern geschützt.
Was tun? Xing deaktiviert das Profil, sobald der Betreiber vom Tod eines Mitglieds erfährt. Nur bei kostenrelevanten Premiumkonten ist eine Sterbeurkunde nötig. Linked-In bietet unter dem Stichwort „verstorben“ an, das Profil eines Kollegen, Studienkameraden oder einer nahestehenden Person zu entfernen. Neben Angaben über die URL und das Verhältnis zu der Person kann eine Urkunde hochgeladen oder die Todesanzeige verlinkt werden. Help.twitter.com/de leitet zu den Datenschutzrichtlinien, wenn ein Account stillgelegt oder gelöscht werden soll. Ein sechs Monate lang inaktives Konto wird laut AGB automatisch deaktiviert. Auf Antrag soll eine Archivierung für die Nachwelt möglich sein.
V. SOZIALE NETZWERKE
30 Millionen Deutsche sind mindestens einmal im Monat auf Facebook aktiv, die absolut meisten davon privat. Seit 2017 ist die Zahl leicht gesunken und liegt nun gleichauf mit der Plattform Youtube. Führend bleibt Whatsapp: Der Messengerdienst zählt in Deutschland mehr als 37 Millionen Nutzer. Bei der zweiten Facebook-Tochter Instagram sind 15 Millionen Menschen unterwegs – meist privat, obwohl ein Drittel der meistgesehenen Einträge von Marken und Unternehmen stammt.
Problematisch: Analog zur Maildebatte gibt es auch bei sozialen Medien einen Widerspruch zwischen Erbrecht und öffentlichem Recht. Vom Bundesgerichtshof, der den Fall von Mutter und Tochter verhandelte, werden Hinweise erwartet, ob der Gesetzgeber den digitalen Nachlass neu regeln muss. Bis dahin bleibt Facebook dabei: Ohne Namen und Passwort darf niemand das Profil einsehen oder verändern.
Nur ein rechtzeitig bestimmter Nachlasskontakt darf eine Art Todesanzeige aufgeben, das Titel- und Profilbild ändern, auf Freundschaftsanfragen reagieren – oder den Account abschalten. Sich einloggen oder nachlesen darf auch er nicht. Wenn Facebook das Konto auf Antrag von Freunden oder Angehörigen in einen „Gedenkzustand“ versetzt, ist das Profil ohnehin eingefroren. Dafür kann schon der Link zu einer Todesanzeige genügen. Freunde können dennoch Erinnerungen posten. Ähnlich verhält es sich bei Instagram. Facebook-Kritiker bemängeln, dass durch die Geschäftsbedingungen das Erbrecht ausgehebelt wird. Bei Whatsapp und Snapchat sind Vorsorgeregeln gar nicht vorgesehen.
Was tun? Solange noch Passwörter statt Iris- oder Fingerabdruckscanner über den Zugang zu virtuellen Räumen entscheiden, sollten Nutzer proaktiv die Vorbereitungen treffen: selbst entscheiden, was weiterleben soll, und einer vertrauten Person dafür die Vollmacht erteilen. Facebook erläutert im Hilfebereich, was Freunden und Verwandten möglich ist. Richtig abschalten geht nur selbst oder über den Nachlasskontakt, der übrigens – auf Verfügung – auch ein Archiv des Accounts für die Nachwelt herunterladen darf.
Die Entscheidung, ob Hinterbliebene Einblick in die digitale Privatsphäre haben sollen, und wenn ja, in welche, sollte jeder zu Lebzeiten treffen, rät der Digitalverband Bitkom. Dann kann ein Notar, Nachlassverwalter oder Bevollmächtigter Daten vernichten oder konservieren – je nachdem. In einem digitalen Testament lässt sich dies auch handschriftlich beliebig personalisieren.