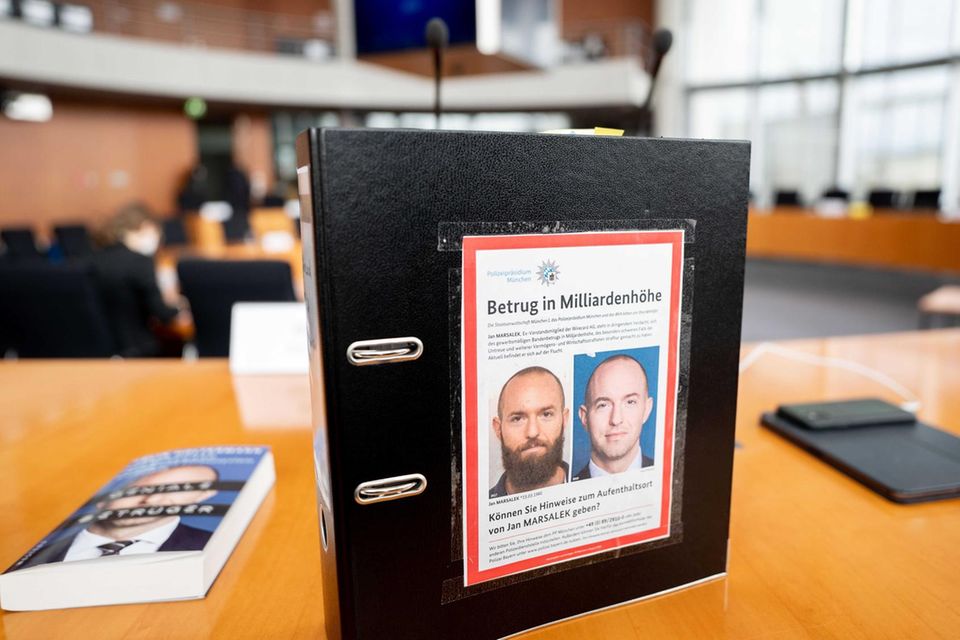Am 24. September 1937 läuft der Passagierdampfer S.S. Königstein im Hafen von New York ein, an Bord ein elfjähriger Junge mit schwarzen Locken und gemischten Gefühlen. Er ist erleichtert, weil seine Familie der Verfolgung im nationalsozialistischen Deutschland entkommen ist. Er ist verunsichert, was ihn in der unbekannten neuen Heimat erwartet. Und er ist besorgt, weil er gehört hat, an Bord des Schiffes würden sich Passagiere reihenweise mit Bindehautentzündungen anstecken, weswegen ihnen der Eintritt in die USA verwehrt werden könnte.
Um die Augenkrankheit macht sich Daniel Aaron umsonst Sorgen, sämtliche Passagiere dürfen ins Land. Doch auch wenn seiner Familie die Flucht gelungen ist, bleibt sie von den „katastrophalen Nachbeben“ des Naziterrors nicht verschont, wie Aaron über 60 Jahre später in seiner Autobiografie schreibt.
Die Geschichte von Daniel Aaron ist beides: eine Geschichte über die grausamen Nachwirkungen des Massenmords an den Juden. Und eine Geschichte „über das Überleben“, so formuliert es Aaron.
In den USA wird aus Daniel „Dan“ und aus dem schüchternen Jungen einer der erfolgreichsten Medienunternehmer der USA. Er wird zwar nie so bekannt wie CNN-Erfinder Ted Turner oder der langjährige Comcast-Chef Ralph Roberts, aber er ist auch zeitlebens keiner, der das Rampenlicht sucht. Doch aus Comcast, das Unternehmen, das Aaron gemeinsam mit Roberts und dem dritten Gründer Julian Brodsky erschaffen hat, wird ein Gigant: Comcast ist heute ein Kabel-, Internet-, Medien- und Telekomkonglomerat mit über 121 Mrd. Dollar Umsatz, fast 190.000 Mitarbeitern und einer Marktkapitalisierung von 150 Mrd. Dollar.
Vom Nazi-Regime Hitlers verfolgt
Geboren wird Daniel Aaron 1926 in eine deutsche Bürgertumsfamilie in Gießen: Der Vater ist ein vermögender Anwalt und SPD-Landtagsabgeordneter, die Mutter leitet den Haushalt. Aaron erinnert sich an ein großes, dreistöckiges Haus mit Bediensteten. Er hat einen vier Jahre jüngeren Bruder namens Frank.
Die Aarons sind Juden, die Deutschland als ihre Heimat betrachten – eine Sicht, von der der Vater auch lange nach 1933 nicht lassen will. Aber die Situation wird zunehmend gefährlich. Vor dem Haus marschieren Hitlerjungen auf und singen: „Hängt die Juden!“ Nur die Mutter versteht, dass sie fliehen müssen, doch der Vater wehrt sich. Das ändert sich erst, als man ihm verbietet, vor Gericht aufzutreten, und er seinen Beruf kaum noch ausüben kann. Dann aber wird er verhaftet.
Verzweifelt versucht die Mutter, ihren Mann freizubekommen und gleichzeitig die Ausreise in die USA zu ermöglichen. Die Familie bekommt ein Visum über eine Schwester des Vaters, die in Philadelphia wohnt. Und der Mutter gelingt es, über Beziehungen eine Freilassung ihres Manns zu erreichen. Die Aarons verlieren keine Zeit und steigen in einen Zug nach Antwerpen, von wo es per Schiff nach New York geht.
Juden, die emigrieren, dürfen nur 100 Reichsmark pro Person mit sich führen. Aarons Vater kann immerhin 10.000 Reichsmark mit in die Staaten retten – er hat sie hinter der Linse einer Leica-Kamera versteckt. Damit wagen sie den Neustart im „Land of the free“. „Das Leben muss hier besser sein“, denkt Aaron. Zunächst kommt die Familie bei Verwandten in der Bronx unter, dann bezieht sie ein Haus in Queens. Die Jungs kommen schnell an, lernen Englisch, auch der Vater – schon Anfang fünfzig – gibt sich größte Mühe. Er liest jeden Tag die New York Times und schlägt jedes unbekannte Wort nach. Doch er darf nicht als Anwalt arbeiten, und selbst als Wachmann oder Aufzugführer findet er keine Anstellung.
Den Sommer 1939 verbringt Aaron mit seinem Bruder in einem Jugendlager auf Staten Island. Eines Nachts wird er geweckt, ein Anruf aus New York: Die Mutter hat sich das Leben genommen. „Das war die Antwort meiner Mutter auf den Druck, als Immigrantin in den Vereinigten Staaten zu leben“, schreibt Aaron. Beim Begräbnis ist der Junge erschrocken über das jämmerliche Bild, das sein Vater abgibt. Und nur drei Wochen später – Aaron ist mit seinem Bruder in das Camp zurückgekehrt –, erreicht ihn die Nachricht, dass auch der Vater Selbstmord begangen hat.
„Seine frühen Lebensjahre waren problembeladen“, wird Aarons Ehefrau später recht nüchtern bilanziert. Als Aaron plötzlich zum Vollwaisen wird, ist er gerade einmal zwölf Jahre alt, allein mit seinem jüngeren Bruder, um den er sich zusätzlich kümmern muss, in einem fremden Land.
Mehrere Jahre lang ziehen die Brüder fortan von Pflegefamilie zu Pflegefamilie. Im Herbst 1944 wird Aaron in die Armee eingezogen und wenig später nach Frankreich verschifft. Er nimmt an der Schlacht in den Ardennen teil, Anfang Mai 1945 überquert er den Rhein. Er ist zurück in Deutschland, aber kein Opfer mehr.
Nach dem Krieg im Militärgeheimdienst
Weil er Deutsch spricht, kommt er gegen Kriegsende zum Militärgeheimdienst. Er hilft dabei, in befreiten Städten Militärverwaltungen zu installieren. Im Sommer soll er an die Pazifikfront verlegt werden, doch dann ist der Krieg auch dort plötzlich vorbei. 1946 wird Aaron aus der Armee entlassen: „Ich war zwanzig und ein halbes Jahr alt und hatte eine Abfindung von 363,62 Dollar in der Tasche“, erinnert er sich. „Ich freute mich auf irgendeine Art positiver Veränderung.“
Die findet Aaron in Philadelphia. Mithilfe der GI Bill kann er ein VWL-Studium beginnen, dort lernt er seine Frau Gerrie kennen. Als die beiden 1948 heiraten, muss ihm der Schwiegervater die 50 Dollar leihen, die der Rabbi für die Hochzeitszeremonie verlangt. Einen ersten Job findet er in der Wirtschafts- und Finanzredaktion des Philadelphia Bulletin, wo bald seine wöchentliche Kolumne über Unternehmen aus der Region erscheint.
Eine der Firmen, über die Aaron schreibt, ist der Elektronikfachhändler Jerrold Electronics, der gerade einen Kabelnetzbetreiber in Iowa übernommen hat. Gründer Milton J. Shapp kennt sich mit Antennen und Verstärkern aus. Die Expertise nutzt er, um in den jungen Markt für Kabelfernsehen zu expandieren. Er hat bereits einige Städte in Philadelphia, die wegen ihrer Tallage keinen Antennenempfang haben, mithilfe der CATV-Technik ans Netz angeschlossen. Dafür stellt er eine große Antenne auf einem Hügel auf und verkabelt die Haushalte dann mit Koaxialkabeln. Die Technik, glaubt er, könnte den Fernsehmarkt revolutionieren, weil damit 20 bis 30 Sender übertragen werden konnte und nicht nur fünf wie bisher. Shapp prophezeit, mithilfe von Kabel werde „der Fernsehempfang im Kleinstadtamerika so gut sein wie das Fernsehbild in New York“.
Das ist ein großes Versprechen, aber die Branche boomt tatsächlich. 1952 gibt es US-weit 14.000 Kabelabonnenten, vier Jahre später schon 300.000. Und dennoch gibt es noch massenhaft Städte und Gemeinden, die unter schlechtem Empfang leiden und erschlossen werden können. Und: Der existierende Kabelmarkt ist extrem kleinteilig, Übernahmen sind an der Tagesordnung. Zwei vielversprechende Marktchancen für findige Unternehmer.
1956 lässt sich Dan Aaron überzeugen, bei Jerrold als Pressesprecher anzuheuern. Er begleitet Shapps Expansionskurs und steigt schnell auf – ein Jahr später leitet er Jerrolds Kabelsparte, übernimmt lokale Anbieter und baut in anderen Gebieten neue Franchises auf. Er ist wie gemacht für den Job, weil er gute Verkäuferqualitäten hat, aber auch das diplomatische Geschick, mit lokalen Verwaltungen und Bürgerversammlungen umzugehen – denn die vergeben meist die Aufträge. „Er vereint ein mitfühlendes Herz mit einem eisernen Willen“, sagt sein späterer Mitgründer Ralph Roberts über Aaron.
Als sich Jerrold-Chef Shapp 1961 entscheidet, in die Politik zu wechseln, überlegt Aaron kurz, ihm zu folgen – aber er will noch mehr erreichen in diesem boomenden Markt. Zunächst macht er sich als Broker selbständig, um Deals in der Kabelbranche einzufädeln. Einmal ist er auf der Suche nach einem Käufer für eine Franchise in Mississipi, was in den unruhigen Zeiten der Bürgerrechtsbewegung nicht einfach ist.
1969 nennt Aaron die Firma Comcast
Durch einen Zufall lernt er einen umtriebigen Modeunternehmer kennen, der gerade eine Firma verkauft hat und nach Investmentmöglichkeiten sucht. Der Mann heißt Ralph Roberts – und Aaron kann ihn überzeugen, die Franchise – American Cable Systems in Tupelo, Mississippi – zu übernehmen. Roberts macht aber zur Bedingung, dass Aaron mit ins Geschäft einsteigt. Später stößt noch Julian Brodsky dazu, ein smarter junger Buchhalter, der dafür verantwortlich ist, Finanzierungen zu organisieren für den kapitalaufwändigen Expansionskurs. Das ist der Anfang von Comcast, dem Kabel-Imperium.
Die drei Gründer, die ihrem Business 1969 den Namen Comcast geben, bleiben für gut 30 Jahre ein Team. Bern Gallagher, ihr späterer Treasurer, beschrieb die Zusammenarbeit so: „Sie hatten sehr unterschiedliche Persönlichkeiten. Dan war der ‚operating guy‘ und kümmerte sich um alles. Julian war der Mann für die Finanzen, ihm musste man alles nachweisen. Und Ralph war der Visionär.“ Wenn man sich vorstellt, sagte Aaron einmal, die drei hätten ein Auto gefahren, dann hätte Roberts am Steuer gesessen, Brodsky den Fuß auf dem Gaspedal gehabt – und er, Dan Aaron, seinen Fuß auf der Bremse.
1991 geht Aaron in Rente, er stirbt 2003 an Parkinson. In seinen kurz zuvor veröffentlichten Memoiren schreibt er: „Man mag sich fragen: Wie habe ich überlebt? Meine Antwort: Ich war davon getrieben, erfolgreich zu sein. (…) Ich wurde nie verbittert, ich habe immer an Weisheit dazugewonnen. Auch wenn ich nie aus dem Schatten des Holocausts treten konnte.“