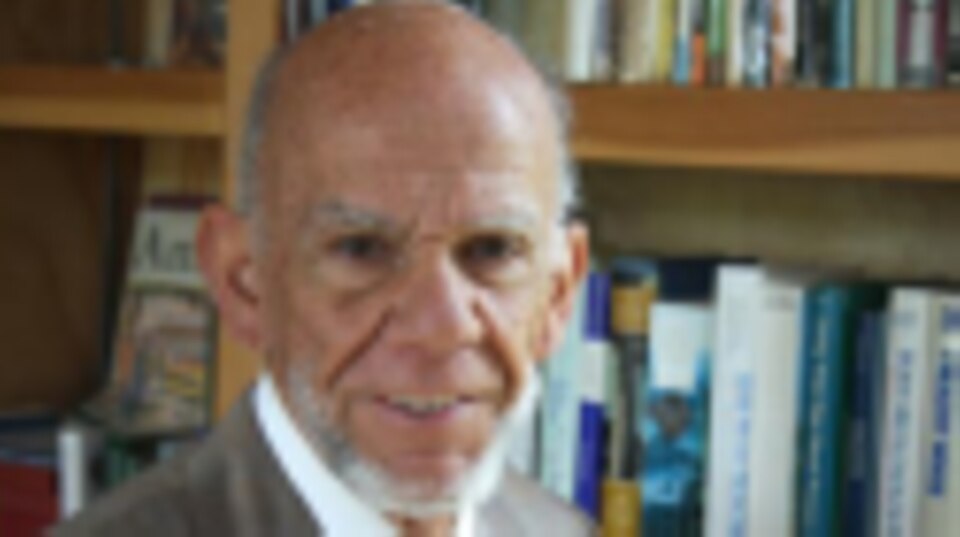Melvyn Krauss ist emeretierter Professor für Volkswirtschaft an der New York University. Er schreibt für Capital in unregelmäßigen Abständen über Geldpolitik und die EZB
Das billionenschwere Anleihenaufkaufprogramm der Europäischen Zentralbank (EZB) hat die griechische Syriza-Partei einer ihrer aggressivsten Waffen beraubt - der Möglichkeit, Gläubiger mit einer Pleite und einem drohenden Domino-Effekt in der Eurozone zu erpressen, falls sie nicht die eigenen Bedingungen für eine Umschuldung akzeptieren. Dank der Aufkäufe bleiben die Probleme Griechenlands ein lokales Problem - und das ist keine gute Nachricht für die Verhandlungsposition der Regierungspartei Syriza.
Ursprünglich sollte die monetäre Initiative der EZB die Deflationsgefahren bekämpfen. Nun hat sie allerdings einen kräftigen und vor allem unerwarteten Einfluss auf die laufenden Verhandlungen zwischen Griechenland und seinen Gläubiger. Diese neuen Machtverhältnisse lassen sich auch gut an den Kapitalmarktreaktionen ablesen: Griechische Aktien und Anleihen brachen ein, nachdem sich der Syriza-Sieg bei den Wahlen Ende Januar abzeichnete.
Zugleich kletterten allerdings die Aktien und Anleihen im übrigen Europa, und das dank der Bekanntgabe des Anleihenaufkaufprogramms. Zu beobachten war also das genaue Gegenteil einer „Ansteckung“ der Eurozone mit den griechischen Problemen. Die „Irish Times“ brachte es auf den Punkt: „Das Anleihenaufkaufprogramm übertrifft an den Kapitalmärkten in seiner Wirkung Griechenland.“
Deutschland profitiert am stärksten
Folglich finden die Verhandlungen zwischen Griechenland und seinen Gläubigern nun auch in ruhiger See an den Finanzmärkten statt und nicht inmitten eines Sturms, der politische Extremisten begünstigt.
Die neuen Machtverhältnisse erklären auch, warum die Europäische Zentralbank vergangene Woche in der Lage war, Griechenland hart anzugehen und griechische Staatsanleihen nicht länger als Sicherheit für Bankkredite zu akzeptieren: Die Notenbank musste nicht befürchten, dass diese Haltung zu Verwerfungen an den Finanzmärkten geführt hätte.
Die Ironie der Maßnahmen ist, dass Deutschland zwar an der Spitze der Kritikerländer des Aufkaufprogramms steht, als größter Geldgeber Griechenlands aber auch am stärksten von den Wirkungen der unkonventionellen EZB-Maßnahmen profitiert, die die Ansteckungsgefahren minimiert haben. Und dennoch attackiert Bundesbankchef Jens Weidmann unablässig das Aufkaufprogramm und warnt, es könnte die bislang reformunwilligen Länder demotivieren, tatsächlich Reformen einzuleiten. Die von Syriza forcierte Krise zeigt, dass genau das Gegenteil stimmt.
Mittel gegen politischen Dominoeffekt
Denn kein Land würde schmerzhafte Reformen einleiten, wenn es bemerkt, dass radikale politische Parteien wie Syriza den Gläubigerländern attraktive Umschuldungen abpressen können. Es geht dabei weniger darum, dass sich jene Schuldenländer, die tatsächlich Reformen eingeleitet haben, wie Dummköpfe fühlen würden, wenn sich Syriza mit seinen Forderungen durchsetzt. Es geht mehr darum, dass ein Erfolg Syrizas andere Länder dazu animieren könnte, sich selbst zu radikalisieren. Das ist auch der Grund, warum andere hoch verschuldete Staaten Griechenland in der aktuellen Krise politisch kaum unterstützen.
Das Anleihenaufkaufprogramm hilft daher nicht nur, einen Dominoeffekt an den Finanzmärkten zu verhindern. Es wirkt auch einem politischen Dominoeffekt entgegen, der in anderen hoch verschuldeten Ländern wie Spanien, Portugal und Irland ähnliche Regierungen wie die Syriza-Partei an die Macht spülen könnte. „Falls Griechenland einen ‚Deal’ bekommt“, schreibt die „Irish Times“, „werden Irland und Portugal auch sehen, was sie tun können“.