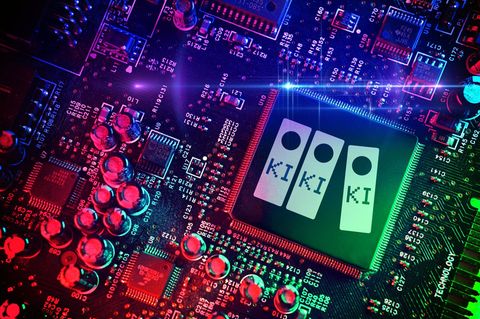Intelligente Müllentsorgung und kluge Verkehrsleitsysteme für weniger Staus in der Großstadt – smarte Städte sind schon längst keine Zukunftsmusik mehr. Barcelona und Paris sind nur zwei Beispiele, wie digitale Transformation in europäischen Großstädten funktionieren kann. Deutschland allerdings hinkt bei der Digitalisierung seiner Städte im Vergleich mit anderen Ländern noch deutlich hinterher. Durch die Urbanisierung und neue technische Anwendungen benötigen Städte und Kommunen smartere Infrastrukturen und Prozesse. Dafür bedarf es eines harmonischen Zusammenspiels von Unternehmen, Verwaltung und Start-ups, um die Großstadt von 2050 attraktiv zu gestalten. Wie aber können Veränderungen umgesetzt werden, um innovative Anwendungen im urbanen Raum zu fördern?
These 1: Kollaboration zwischen privatem und öffentlichem Sektor fördern
In einer zunehmend vernetzten Welt müssen die klassischen Grenzen zwischen verschiedenen Industriezweigen eingerissen werden, um sektorübergreifende Innovationen in Smart Citys zu fördern. Die Verbindung unterschiedlicher Branchen wie Mobility oder Energie kann einen enormen Mehrwert für die Städter bieten. Beispielsweise kann durch eine Integration von E-Ladetankstellen in Smart Buildings Mobilität mit Wohnen verbunden werden, da sich der Weg zur Tankstelle durch die Elektro-Ladestation zuhause erübrigt.
Eine intensive Zusammenarbeit zwischen privatwirtschaftlichem und öffentlichem Sektor wie etwa in Barcelona ist aus diesem Grund notwendig. Hier wurden spezielle Programme etabliert, die auf eine engere Kooperation von Unternehmen und Verwaltung abzielen. Für eine effektive Kollaboration zwischen verschiedenen Institutionen bedarf es dabei gleichzeitig einer besseren Verständigung zwischen den einzelnen Stadtverwaltungseinheiten.
These 2: Innovation in der Verwaltung voranbringen
Bisher denken gerade Start-ups bei potenziellen Auftraggebern kaum an die öffentliche Verwaltung, was vor allem den Vergabeprozessen geschuldet ist: Diese ziehen sich oft über Monate und bedeuten somit eine enorme finanzielle Belastung, die kleine Firmen in Schwierigkeiten bringen kann. Um Start-ups stärker in die Digitalisierung des urbanen Raumes einzubeziehen, muss die Verwaltung ihre Ausschreibungen neu strukturieren und interne Prozesse beschleunigen. Auf den verschiedenen Verwaltungsebenen müssen zudem neue Organisationseinheiten und Rollen geschaffen werden, die den digitalen Transformationsprozess begleiten und fördern.
Beispielsweise setzt die Stadt Paris einen Chief Data Officer ein, dessen Aufgaben auf die Realisierung der Smart City abzielen, etwa durch die Optimierung des Straßenverkehrs oder die Unfallvorhersage durch Datenauswertung. Der Fokus der städtischen Digitalisierung liegt jedoch nicht nur auf Großprojekten wie Breitband-Internetleitungen oder der Erneuerung der IT-Infrastruktur, sondern auch auf Mikro-Innovationen wie Software oder datengetriebenen digitalen Produkten, die einzelne Aspekte des Stadtlebens oder der Verwaltung verbessern können.
These 3: Culture-Shift - Kultur des Experimentierens schaffen
Zur neuen Innovationskultur gehört auch der Mut zum Scheitern. Obwohl es bei Innovatoren zum Alltag gehört, hat das Scheitern hierzulande – anders als zum Beispiel in den USA – einen schlechten Ruf. Das Zelebrieren einer Fehlerkultur als Lernmöglichkeit ist daher ein wichtiger Bestandteil des Kulturwandels und essentiell für die Beschleunigung des Fortschritts. Digitale Innovation unterscheidet sich von traditioneller Hardware-Entwicklung, da sich das Nutzerverhalten enorm schnell verändert und neue Produkte schneller entwickelt bzw. skaliert werden können. Daher muss in diesem Bereich viel experimentiert werden.
Für Stadtverwaltungen werden in diesem Kontext Methoden wie Lean Startup (Optimierung des Experimentierprozesses) und Human-centered Design (frühe Ausrichtung auf die menschliche Perspektive während des gesamten Innovationsprozesses) relevant. Zudem müssen Städte Startups das ergebnisoffene Experimentieren in kleineren Projekten ermöglichen, zum Beispiel bei Themen wie Ampeln, Beleuchtung oder dem Zugang zu Teststraßen.
These 4: Smarte Finanzierung finden
Auch die Finanzierung muss in die Überlegungen zum Innovationsprozess deutscher Städte einbezogen werden: Es sind aktive Finanzierungsfonds mit Fokus auf Smart City und Smart Government nötig, die sowohl den öffentlichen Sektor als auch die Welt der Start-ups und den Risikokapitalmarkt verstehen. Solche Fonds könnten, ähnlich wie der High-Tech Gründerfonds, aus öffentlichem und privatem Kapital bestehen. Davon profitieren zum Beispiel Startups bei der Zusammenarbeit mit der öffentlichen Verwaltung. Ebenfalls würden sie bei ihrer Positionierung auf dem Markt und einer möglichen Expansion in andere Länder und Regionen gefördert.
Fazit: Deutsche Städte haben noch Nachholbedarf
Um den Innovationsprozess in deutschen Städten zu beschleunigen, ist die Zusammenarbeit von Industrie, Verwaltung und Start-ups zentral. Im Vergleich zu internationalen Vorreitern wie Singapur oder Dubai stecken die Smart-City-Initiativen in Europa noch in den Kinderschuhen. Die Neuausrichtung der Verwaltung in Paris oder die Forcierung der sektorübergreifenden Zusammenarbeit in Barcelona kann deutschen Städten aber bereits jetzt als Orientierung dienen. Zwar gibt es zum Beispiel in München Versuche mit intelligenter Straßenbeleuchtung oder in Berlin den Aufbau von Open-Data-Netzwerken. Strukturelle Veränderungen auf Verwaltungsebene und eine Veränderung des Mindsets sind jedoch ebenfalls unbedingt notwendig, um das vorhandene Potenzial deutscher Innovatoren voll auszuschöpfen.
Das sind die zehn smartesten Städte Deutschlands
Das schwedische Unternehmen EasyPark hat sich auf die Suche nach der intelligentesten Stadt weltweit gemacht. Wir haben die globale Top Ten des Smart-Cities-Index 2017 bereits vorgestellt. Aber wer hat in Deutschland die Nase vorn?
Deutschland smarteste Städte
#9 Stuttgart kann sich beim Ranking über die Bestnote in der Kategorie „Stadtplanung“ freuen. Car-Sharing und Lebensqualität werden ebenfalls gut bewertet. In der Wahrnehmung der befragten Experten schnitt Stuttgart sehr viel besser als der Nächstplatzierte Bochum ab.
#8 Frankfurt am Main schaffte es in der globalen Top 100 auf den 33. Rang. Im nationalen Vergleich belegt die Finanzmetropole Platz acht. Sie punktete unter anderem bei Bürgerbeteiligung und Bildung. Die Digitalisierung der Verwaltung sowie der Umweltschutz sind aber nach Ansicht der Studie ausbaufähig.
#6 Hannover liegt im globalen Ranking direkt vor Köln. Lebensqualität, Expertenmeinung, öffentliche Verkehrsmittel sowie Abfallentsorgung und intelligente Gebäude werden durchweg gut bewertet. Schlechte Noten gibt es hingegen für die Zahl der WLAN-Spots in Hannover.
#5 Bayreuth ist nach Ansicht von EasyPark die 29. smarteste Stadt der Welt. Zwar steckt das Car-Sharing hier laut der Studie noch eher in den Kinderschuhen. Auch bei der Digitalisierung ist Luft nach oben. In den Kategorien „Nachhaltigkeit“ sowie „Verwaltung und Politik“ schneidet Bayreuth aber gut ab.
#3 Gerade einmal einen Platz hinter New York: München liegt im weltweiten Ranking von EasyPark auf dem 25. Rang. Innerhalb Deutschlands reicht es für einen Platz auf dem Treppchen. Die bayerische Landeshauptstadt erzielt ihre besten Bewertungen unter anderem bei Bildung und Car-Sharing.
#2 Im Smart-Cities-Index 2017 reichte es für Hamburg weltweit für Rang 14. Im nationalen Vergleich hat die Hansestadt den Sieg nur knapp verpasst. Öffentliche Verkehrsmittel, Lebensqualität und eine rundweg gute Bewertung der Experten bedeuten für die Elbmetropole Platz zwei in Deutschland.
#1 Berlin ist auch in punkto Smartness die Hauptstadt Deutschlands. Der Sieg fiel aber knapp aus. Berlin liegt in der Gesamtpunktzahl gerade einmal 0,03 Punkte vor Hamburg. WLAN-Hotspots, innovative Wirtschaft und Car-Sharing sicherten unter anderem den Sieg. Bei der Surfgeschwindigkeit – mobil und stationär – darf es in Berlin aber noch flotter zugehen.